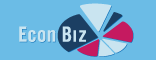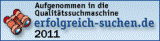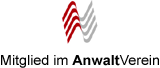- -> zur Mobil-Ansicht
- Arbeitsrecht aktuell
- Tipps und Tricks
- Handbuch Arbeitsrecht
- Gesetze zum Arbeitsrecht
- Urteile zum Arbeitsrecht
- Urteile 2023
- Urteile 2021
- Urteile 2020
- Urteile 2019
- Urteile 2018
- Urteile 2017
- Urteile 2016
- Urteile 2015
- Urteile 2014
- Urteile 2013
- Urteile 2012
- Urteile 2011
- Urteile 2010
- Urteile 2009
- Urteile 2008
- Urteile 2007
- Urteile 2006
- Urteile 2005
- Urteile 2004
- Urteile 2003
- Urteile 2002
- Urteile 2001
- Urteile 2000
- Urteile 1999
- Urteile 1998
- Urteile 1997
- Urteile 1996
- Urteile 1995
- Urteile 1994
- Urteile 1993
- Urteile 1992
- Urteile 1991
- Urteile bis 1990
- Arbeitsrecht Muster
- Videos
- Impressum-Generator
- Webinare zum Arbeitsrecht
-
Kanzlei Berlin
 030 - 26 39 62 0
030 - 26 39 62 0
 berlin@hensche.de
berlin@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Frankfurt
 069 - 71 03 30 04
069 - 71 03 30 04
 frankfurt@hensche.de
frankfurt@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hamburg
 040 - 69 20 68 04
040 - 69 20 68 04
 hamburg@hensche.de
hamburg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hannover
 0511 - 89 97 701
0511 - 89 97 701
 hannover@hensche.de
hannover@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Köln
 0221 - 70 90 718
0221 - 70 90 718
 koeln@hensche.de
koeln@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei München
 089 - 21 56 88 63
089 - 21 56 88 63
 muenchen@hensche.de
muenchen@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Nürnberg
 0911 - 95 33 207
0911 - 95 33 207
 nuernberg@hensche.de
nuernberg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Stuttgart
 0711 - 47 09 710
0711 - 47 09 710
 stuttgart@hensche.de
stuttgart@hensche.de
AnfahrtDetails
LAG Baden-Württemberg, Urteil vom 20.07.2016, 4 Sa 61/15
| Schlagworte: | Datenschutz, Überwachung, Persönlichkeitsrecht, Arbeitnehmerdatenschutz | |
| Gericht: | Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg | |
| Aktenzeichen: | 4 Sa 61/15 | |
| Typ: | Urteil | |
| Entscheidungsdatum: | 20.07.2016 | |
| Leitsätze: | 1) Eine konkrete und zielgerichtete Datenerhebung durch einen Detektiv wegen des Verdachts einer konkreten Vertragspflichtverletzung unterfällt nicht § § 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG, sondern bedarf des Vorliegens der Voraussetzungen des § 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG. 2) Der Verdacht eines Wettbewerbsverstoßes stellt in der Regel keinen Verdacht einer Straftat dar und kann deshalb eine Datenerhebung gem. § 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG nicht rechtfertigen. |
|
| Vorinstanzen: | Arbeitsgericht Heilbronn, Urteil vom 22.10.2015, 8 Ca 28/15 nachgehend: Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 29.06.2017, 2 AZR 597/16 |
|
LArbG Baden-Württemberg Urteil vom 20.7.2016, 4 Sa 61/15
Tenor
I. Auf die Berufung des Klägers wird das Teilurteil des Arbeitsgerichts Heilbronn vom 22.10.2015 (8 Ca 28/15) abgeändert.
1. Es wird festgestellt, dass das zwischen den Parteien bestehende Arbeitsverhältnis nicht durch die außerordentliche, hilfsweise ordentliche Kündigung der Beklagten vom 11.06.2015 aufgelöst wurde.
2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
3. Die Widerklageanträge zu 1), 2) und 3a) werden abgewiesen.
II. Die Kostenentscheidung über die erstinstanzlichen Kosten bleibt dem Schlussurteil des Arbeitsgerichts vorbehalten. Die Kosten der Berufung hat die Beklagte zu 68 %, der Kläger zu 32 % zu tragen.
III. Die Revision wird für die Beklagte zugelassen. Für den Kläger wird die Revision nicht zugelassen.
Tatbestand
| 1 | Die Parteien streiten in der Berufungsinstanz (nur) noch über die Wirksamkeit einer arbeitgeberseitigen außerordentlichen, hilfsweise ordentlichen Kündigung, sowie auf die Widerklage der Beklagten über Rückzahlung geleisteter Entgeltfortzahlung für den Krankheitsfall, über den Ersatz von Detektivkosten sowie über einen Auskunftsanspruch betreffend Wettbewerbshandlungen. |
| 2 | Der am 00.00.1961 geborene, verheiratete und gegenüber keinen Kindern mehr unterhaltsverpflichtete Kläger ist bei der Beklagten beschäftigt seit 04. Dezember 1978 als Mitarbeiter im Stanzformenbau. Er bezog zuletzt ein durchschnittliches monatliches Bruttoarbeitsentgelt in Höhe von 3.400,-- Euro. |
| 3 | Die Beklagte stellt Stanzwerkzeuge und Stanzformen her. Sie beschäftigt in ihrem Betrieb in H. ca. 395 Mitarbeiter. Ein Betriebsrat ist in diesem Betrieb nicht gebildet. |
| 4 | Die Beklagte kündigte das Arbeitsverhältnis mit dem Kläger mit Schreiben vom 28. Januar 2015 ordentlich zum 31. August 2015 und mit Schreiben vom 27. April 2015 ordentlich zum 30. November 2015 aus krankheitsbedingten Gründen. Gegen diese Kündigungen erhob der Kläger am 06. Februar 2015 und 06. Mai 2015 Kündigungsschutzklagen. Die Beklagte erklärte im Laufe des Verfahrens mit Schriftsatz vom 03. September 2015 (Bl. 145 d. ArbG-Akte), aus diesen Kündigungen keine Rechte mehr gegenüber dem Kläger herzuleiten, diese Kündigungen werden „zurückgenommen“. |
| 5 | Die Beklagte kündigte das Arbeitsverhältnis erneut mit Schreiben vom 11. Juni 2015 (Bl. 53 d. ArbG-Akte), dem Kläger zugegangen am 11. Juni 2015, außerordentlich und fristlos, hilfsweise ordentlich zum 31. Januar 2016. Gegen diese Kündigung richtet sich die vorliegend noch streitige Kündigungsschutzklage, die als Klageerweiterungsantrag am 24. Juni 2015 in das Verfahren eingeführt wurde. |
| 6 | Die Beklagte stützt die Kündigung auf den Verdacht wettbewerbswidriger Konkurrenztätigkeiten des Klägers für die Firma seiner Söhne sowie auf den Verdacht des Erschleichens von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen. Wegen dieses Verdachts wurde der Kläger mit Schreiben vom 08. Juni 2015 (Bl. 97-99 d. ArbG-Akte) angehört. Der Kläger beantwortete dieses Schreiben nicht. |
| 7 | Dem liegt folgender Sachverhalt zugrunde: |
| 8 | Die drei Söhne des Klägers gründeten eine Firma M. S. GmbH (nachfolgend: M. ), welche am 05. November 2013 in das Handelsregister eingetragen wurde und deren Geschäftsführer der Sohn des Klägers, Herr G. A., ist. Dieses Unternehmen wurde unter der Wohnanschrift des Klägers angemeldet, verlagerte seinen Geschäftsbetrieb jedoch bald an eine Betriebsstätte in N.. Gegenstand dieses Unternehmens ist der Stanzformenbau. Insbesondere im Bereich des Stanzformenbaus für den Akzidenzdruck (Wellpappe, Etiketten, Faltschachteln ua.) sind die Geschäftsbereiche identisch mit einem entsprechenden Teil des Geschäftsgegenstands der Beklagten. Auf die Internetauftritte beider Firmen (Bl. 188-194 d. LAG-Akte) wird Bezug genommen. |
| 9 | Die Firma M. schrieb an einen Kunden der Beklagten eine E-Mail, von der der Geschäftsführer der Beklagten am 29. Mai 2015 Kenntnis erhielt. Darin heißt es: |
| 10 | „hätten Sie interesse an Stanzformen, Bandstahlwerkzeuge, Ausbrechwerkzeugen, Rilma ect. wir sind in N. bei H., wir verkaufen unsere Produkte sehr kosten günstig bei gleich Qualität wie man eine Stafo so kennt, da wir unsere Werkzeuge in einem Familienunternehmen fertigen können wir einige kosten sparen und unsere Kunden da entgegenkommen, deswegen haben wir einige große vorteile gegenüber meine Konkurrenten. |
| 11 | Mein Vater M. A. montiert seit 38 Jahren, unglaublich was er alles so hinbekommt, ich selber der Sohn von 3 Brüder, G. A., 33 Jahre bin Feinwerkmeister HWK und weis was Sache ist um das zu beurteilen. |
| 12 | Also wenn Sie interesse haben würde ich Sie herzlich begrüßen, wenn Sie schon mit allem zufrieden sind, never change the running systeme! dann möchte ich nicht unverschämt sein und verbleibe. |
| 13 | Mit Freundlichen Grüßen G. A. |
| 14 | M. S. GmbH
K. 00 00000 N.“ |
| 15 | Der Kläger war schon im Jahr 2014 mehrfach als arbeitsunfähig krankgeschrieben. Seit 20 Januar 2015 ist der Kläger durchgehend arbeitsunfähig krankgeschrieben. Die Beklagte leistete in 2015 noch Entgeltfortzahlung vom 20. Januar 2015 bis 02. März 2015. Wegen der geleisteten Entgeltfortzahlung seit Februar 2014 und im Jahr 2015 wird auf die Aufstellung der Beklagten (Bl. 81 d. ArbG-Akte) verwiesen. Inzwischen ist der Kläger beim Krankengeldbezug ausgesteuert. |
| 16 | Der Kläger bestritt, in der Firma seiner Söhne gearbeitet zu haben. Er sei auch arbeitsunfähig krank gewesen. Er leide unter anderem an Hepatitis C und an Entzündungen innerer Organe. |
| 17 | Der Kläger beantragte: |
| 18 | 1. Es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis des Klägers durch ordentliche schriftliche Kündigung der Beklagten vom 28.01.2015, zugegangen am 29.01.2015, zum 31.08.2015 nicht endet. |
| 19 | 2. Es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis auch nicht durch andere Beendigungstatbestände endet, sondern zu unveränderten Bedingungen über den Beendigungszeitpunkt hinaus fortbesteht. |
| 20 | 3. Es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis des Klägers durch ordentliche schriftliche Kündigung der Beklagten vom 27.04.2015, zugegangen am 27.04.2015, zum 30.11.2015 nicht endet. |
| 21 | 4. Es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis der Parteien durch die außerordentliche Kündigung vom 11.06.2015, zugegangen am 12.06.2015, nicht endet. |
| 22 | 5. Es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis auch nicht durch die hilfsweise ordentliche Kündigung vom 11.06.2015, zugegangen am 12.06.2015, zum 31.01.2016 nicht endet, sondern zu unveränderten Bedingungen über den Beendigungszeitpunkt hinaus fortbesteht. |
| 23 | 6. Es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis auch nicht durch andere Beendigungstatbestände endet, sondern zu unveränderten Bedingungen über den Beendigungszeitpunkt hinaus fortbesteht. |
| 24 | Die Beklagte beantragte, |
| 25 | die Klage abzuweisen. |
| 26 | Widerklagend beantragte die Beklagte: |
| 27 | 1. Der Kläger/Widerbeklagte wird verurteilt, an die Beklagte/Widerklägerin weitere Euro 10.551,76 nebst Zinsen iHv. 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz hieraus seit Rechtshängigkeit zu bezahlen. |
| 28 | 2. Der Kläger/Widerbeklagte wird verurteilt, an die Beklagte/Widerklägerin Euro 8.124,61 nebst Zinsen iHv. fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz hieraus seit Rechtshängigkeit zu bezahlen. |
| 29 | 3. Der Kläger/Widerbeklagte wird verurteilt, |
| 30 | a) Auskunft darüber zu erteilen, welche Aufträge er für die Firma M. S. GmbH, I. K. 31, 00000 N. im Bereich Stanzformtechnik bearbeitet hat. |
| 31 | b) Die nach a) gegebene Auskunft dahingehend an Eides statt zu versichern, dass die Auskunft vollständig ist. |
| 32 | c) Der Beklagten/Widerklägerin den sich nach Auskunft und eidesstattlicher Versicherung noch zu berechnenden Schadenersatz zu zahlen. |
| 33 | Der Kläger beantragte, |
| 34 | die Widerklage abzuweisen. |
| 35 | Die Beklagte hielt die außerordentliche Kündigung für gerechtfertigt. |
| 36 | Sie behauptete, sie habe unmittelbar nach Kenntniserlangung von der Gründung der M. mit dem Kläger am 06. November 2013 ein Personalgespräch geführt, bei welchem dem Kläger eindringlich mitgeteilt wurde, dass er in diesem Betrieb nicht konkurrierend tätig sein dürfe. Dies sei dem Kläger im Übrigen - unstreitig - auch bereits mit Schreiben vom 29. Oktober 2013 (Bl. 161 d. ArbG-Akte) mitgeteilt worden. |
| 37 | Die Beklagte habe das Privatfahrzeug des Klägers am 19. Februar 2014 während der Arbeitsunfähigkeit des Klägers auf dem Firmengelände der M. gesehen. Sie habe daraufhin ein Detektivbüro beauftragt, welches erkundet habe, dass das Fahrzeug auch am 24. Februar und 27. Februar 2014 und vom 25. bis 27. Juni 2014 während einer Arbeitsunfähigkeit des Klägers und am 03. März und 13. März 2014 während eines Erholungsurlaubs des Klägers, zu dem der Kläger angegeben habe, in der Türkei zu sein, auf dem Gelände der M. gestanden habe. |
| 38 | Nach Kenntnisnahme der E-Mail der M. am 29. Mai 2015 habe sie erneut ein Detektivbüro eingeschaltet, welches am 02. Juni 2015 bei der Firma M. angerufen habe. Der Detektiv habe namens einer Firma a. GmbH eine Stanzform beim Sohn des Klägers T. A. bestellt, welche am 03. Juni 2015 durch einen vermeintlichen Fahrer der a. GmbH hätte abgeholt werden sollen. Eine anderer Detektiv habe sich am 03. Juni 2015 zur Firma M. begeben und sich als Fahrer der a. GmbH ausgegeben. Der Detektiv habe um 9:39 Uhr festgestellt, dass der Kläger sich am Montagetisch befunden habe und an zwei Stanzformen gearbeitet habe. Eine Stunde später sei der Kläger noch immer am Montagetisch tätig gewesen. Der Kläger habe den Detektiv sogar noch durch den Betrieb geführt, die Maschinen erklärt und mitgeteilt, dass es sich um einen Familienbetrieb handele. Nachdem einer der Söhne, der zwischenzeitlich die Computerzeichnung für die Stanzform angefertigt habe, aus dem Büro gekommen sei, habe sich der Kläger zur Fertigungsmaschine begeben und die Stanzform hergestellt. Dies habe bis ca. 12:20 Uhr gedauert. |
| 39 | Die Beklagte behauptete, bei den vom Kläger für die Firma M. erbrachten Tätigkeiten habe es sich um exakt dieselben Tätigkeiten gehandelt, die der Kläger auch bei der Beklagten zu verrichten gehabt hätte. Der Kläger hätte deshalb unerlaubt Wettbewerb betrieben. Außerdem stehe für die Beklagte aus diesem Verhalten fest, dass der Kläger seine Arbeitsunfähigkeit nur vorgetäuscht habe. |
| 40 | Die Beklagte vertrat die Auffassung, durch die festgestellten unerlaubten Wettbewerbshandlungen des Klägers seien auch die Beweiswerte aller Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen seit Februar 2014 erschüttert. Sie begehrte daher die Rückzahlung sämtlicher seit Februar 2014 erbrachten Entgeltfortzahlungsleistungen. |
| 41 | Sie meinte, der Kläger schulde im Rahmen des Schadenersatzes auch Ersatz der Detektivkosten für die Einsätze in 2014 und den Einsatz im Juni 2015. |
| 42 | Außerdem schulde ihr der Kläger wegen der wettbewerbswidrigen Handlungen Schadenersatz nach § 61 HGB, wofür ihr im Rahmen einer Stufenklage auf der ersten Stufe ein Auskunftsanspruch zustehe. |
| 43 | Das Arbeitsgericht hat die Kündigungsschutzklage des Klägers mit Teilurteil vom 22. Oktober 2015 abgewiesen. Unter der Annahme, der Kläger hätte bezogen auf die außerordentliche Kündigung vom 11. Juni 2015 nur einen allgemeinen Feststellungsantrag gestellt, führte es aus, dass der Kläger dennoch hinreichend zum Ausdruck gebracht habe, sich gegen diese Kündigung punktuell zur Wehr setzen zu wollen, weshalb die außerordentliche Kündigung nicht gemäß § 7 KSchG als wirksam gelte. Es lägen erdrückende Verdachtsmomente vor, dass der Kläger Arbeitsleitungen für die Firma M. erbracht habe, was sich aus dem Observationsbericht des Detektivs ergebe sowie aus der Werbemail der Firma M. und aus einem widersprüchlichen Verhalten des Klägers, der noch im Gütetermin am 02. Juli 2015 gelegentliche Hilfeleistungen für seine Söhne eingeräumt haben soll. Der Kläger habe die Beobachtungen des Detektivs auch nicht bestritten. Die Verdachtsanhörung sei ordnungsgemäß erfolgt. Die Interessenabwägung falle zu Lasten des Klägers aus. Das Arbeitsgericht gab der Widerklage teilweise statt. Es sprach der Beklagten den geltend gemachten Anspruch auf Rückzahlung der geleisteten Entgeltfortzahlung zu. Es führte aus, der Kläger sei dem Vortrag der Beklagten zur Vortäuschung einer Arbeitsunfähigkeit nicht substantiiert entgegengetreten. Durch die Beobachtungen des Detektivs sei der Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen erschüttert. Das Arbeitsgericht sprach der Beklagten Detektivkosten nur in Höhe von 746,55 Euro zu für die Beobachtungen im Juli 2015. Nur für diesen Auftrag habe es einen hinreichenden Tatverdacht gegeben, der einen Detektiveinsatz zu rechtfertigen geeignet gewesen sei. Die Detektivkosten für 2014 wurden abgewiesen. Wegen der angenommenen unerlaubten Wettbewerbstätigkeit wurde der Beklagten auf der ersten Stufe der Stufenklage der begehrte Auskunftsanspruch zugesprochen. |
| 44 | Dieses Teilurteil wurde dem Kläger am 12. November 2015 zugestellt. Hiergegen richtet sich die vorliegende Berufung des Klägers, die am 20. November 015 beim Landesarbeitsgericht einging und die innerhalb der bis 12. Februar 2016 verlängerten Berufungsbegründungsfrist am 12. Februar 2016 begründet wurde. |
| 45 | Der Kläger rügt die Verletzung materiellen Rechts und eine unzutreffende Tatsachenfeststellung. |
| 46 | Er verweist darauf, dass ein punktueller Kündigungsschutzantrag gestellt wurde, weshalb die Ausführungen des Arbeitsgerichts zu § 7 KSchG überflüssig seien. |
| 47 | Er beanstandet, dass das Arbeitsgericht sein Bestreiten einer Tätigkeit für die Firma M. und somit der Richtigkeit der behaupteten Beobachtungen des Detektivs nicht zur Kenntnis genommen habe. Jedenfalls habe die Beklagte ihre Erkenntnisse aus einer rechtwidrigen Überwachung erlangt und dürfe diese deshalb wegen Verstoß gegen § 32 BDSG nicht gegen ihn verwerten. |
| 48 | Er meint, die Kündigung sei auch unverhältnismäßig. In der Interessenabwägung sei insbesondere seine 37-jährige Betriebszugehörigkeit nicht hinreichend gewürdigt worden. Er habe sich auch nicht genesungswidrig verhalten oder den Heilungsverlauf verzögert. |
| 49 | Er vertritt die Auffassung, die Kündigung sei bereits wegen Nichteinhaltung der Zwei-Wochen-Frist des § 626 Abs. 2 BGB unwirksam. Die Beklagte habe schließlich schon seit 2014 einen Verdacht gegen den Kläger gehabt. |
| 50 | Er meint, der Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen sei nicht erschüttert. Insbesondere für die Zeiträume Februar 2014 bis März 2015 gebe es keinerlei Verdachtsmomente, dass der Kläger gearbeitet haben könnte. Vielmehr sei die Widerklage der Beklagten schon unschlüssig. Die Beklagte habe noch nicht einmal vorgetragen, an welchen Tagen innerhalb der jeweiligen Arbeitsunfähigkeitszeiträume der Kläger gearbeitet haben soll. |
| 51 | Wegen der Rechtswidrigkeit der Observation stehe der Beklagten auch kein Schadenersatz auf Erstattung von Detektivkosten zu. |
| 52 | Er trägt zum Auskunftsanspruch vor, er habe im Verfahren mehrfach und wiederholt mitgeteilt, keine Tätigkeiten für die Firma M. erbracht zu haben. Ein etwaiger Auskunftsanspruch sei hiermit erfüllt. Das Vorliegen weiterer Auskünfte sei somit auf eine unmögliche Leistung gerichtet, die er nicht schulde. |
| 53 | Der Kläger beantragt: |
| 54 | Das Teilurteil des Arbeitsgerichts Heilbronn, Az: 8 Ca 28/15, wird abgeändert. |
| 55 | a) Es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis der Parteien durch die außerordentliche Kündigung der Beklagten vom 11.06.2015, zugegangen am 12.06.2015, nicht endet. |
| 56 | b) Es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis auch nicht durch die hilfsweise ordentliche Kündigung vom 11.06.2015, zugegangen am 12.06.2015, nicht endet, sondern zu unveränderten Bedingungen über den Beendigungszeitpunkt hinaus fortbesteht. |
| 57 |
c) Es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis auch nicht durch andere Beendigungstatbestände endet, sondern zu unveränderten Bedingungen über den Beendigungszeitpunkt hinaus fortbesteht. |
| 58 | d) Die Widerklage der Beklagten/Berufungsbeklagten wird kostenpflichtig abgewiesen. |
| 59 | Die Beklagte beantragt, |
| 60 | die Berufung zurückzuweisen. |
| 61 | Die Beklagte verteidigt das arbeitsgerichtliche Urteil unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens. |
| 62 | Sie meint insbesondere, die Observation des Klägers sei nicht rechtswidrig gewesen. Vielmehr sei sie im Zusammenhang mit einem ordnungsgemäß erteilten und auch bezahlten Auftrag der Firma a. GmbH erfolgt. |
| 63 | Vor allem angesichts der Warnungen an den Kläger im Personalgespräch am 06. November 2013 und mit Schreiben vom 29.Oktober 2013 sei eine vorherige Abmahnung entbehrlich gewesen. Dem Kläger sei im Übrigen kein genesungswidriges Verhalten vorgeworfen worden, sondern nur eine Konkurrenztätigkeit während erschlichener Arbeitsunfähigkeit. |
| 64 | Die Frist des § 626 Abs. 2 BGB sei eingehalten, da Anlass der Kündigung die Beobachtung vom 03. Juni 2015 gewesen sei. |
| 65 |
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird gemäß § 64 Abs. 7 ArbGG iVm. § 313 Abs. 2 Satz 2 ZPO auf den Inhalt der zwischen den Parteien gewechselten Schrift-sätze nebst Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung verwiesen. Entscheidungsgründe |
| 66 |
Die statthafte, form- und fristgerecht eingelegte und auch im Übrigen zulässige Berufung ist weitgehend begründet. Lediglich soweit der Kläger mit der Berufung auch eine allgemeine Feststellungsklage weiterverfolgte, ist die Berufung unbegründet, weil diese allgemeine Feststellungsklage bereits unzulässig ist. A. |
| 67 | Die Klage ist mit Ausnahme des allgemeinen Feststellungsantrags (Berufungsantrag zu c) zulässig. |
| 68 | Die allgemeine Feststellungsklage ist unzulässig. |
| 69 |
Die Beklagte berühmt sich keinerlei weiterer Beendigungsakte mehr mit Ausnahme der streitgegenständlichen außerordentlichen Kündigung vom 11.Juni 2015. Insbesondere in Bezug auf die beiden ordentlichen Kündigungen vom 28. Januar 2015 und 27.April 2015 hat die Beklagte erklärt, dass sie hieraus keinerlei Rechtsfolgen mehr gegenüber dem Kläger ableiten wolle. Der Kläger hat deshalb vorsorglich auch die Klagerücknahme in Bezug auf die beiden ursprünglichen Klageanträge zu 1 und 3 erklärt. Dem Kläger fehlt es demnach an einem Rechtsschutzinteresse für diese allgemeine Feststellungsklage. B. |
| 70 |
Soweit die Klage zulässig ist, ist sie auch begründet. Die zur Berufung angefallenen Widerklageanträge sind nicht begründet. I. |
| 71 | Das Arbeitsverhältnis zwischen den Parteien wurde nicht durch die außerordentliche Kündigung der Beklagten vom 11. Juni 2015 aufgelöst. Die Kündigung ist nicht gemäß § 626 Abs. 1 BGB gerechtfertigt. |
| 72 | 1. Das Arbeitsgericht hat zu Recht festgestellt, dass die Kündigung nicht gemäß § 7 KSchG als wirksam gilt. |
| 73 | Hierfür bedurfte es aber keiner Auslegung der Klageanträge des Klägers. Der Kläger hat vielmehr ausweislich des Protokolls vom 22. Oktober 2015 unter anderem die Anträge aus dem Schriftsatz vom 22. Juni 2015 gestellt. In diesem Klageerweiterungsschriftsatz vom 22. Juni 2015 stellte der Kläger jedoch nicht nur einen allgemeinen Feststellungsantrag, sondern bezogen auf die Kündigung vom 11. Juni 2015 auch einen punktuellen Kündigungsschutzantrag (= Klageantrag zu 4). |
| 74 | 2. Gemäß § 626 Abs. 1 BGB kann ein Arbeitsverhältnis aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden, wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund derer dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. Dafür ist zunächst zu prüfen, ob der Sachverhalt ohne seine besonderen Umstände „an sich“, das heißt typischerweise als wichtiger Grund geeignet ist. Alsdann bedarf es der Prüfung, ob dem Kündigenden die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des Falls und unter Abwägung der Interessen beider Vertragsteile - jedenfalls bis zum Ablauf der Kündigungsfrist - zumutbar ist oder nicht. Ein wichtiger Grund im Sinne von § 626 Abs. 1 BGB ist also nur gegeben, wenn das Ergebnis dieser Gesamtwürdigung die Feststellung der Unzumutbarkeit einer Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers auch nur bis zum Ablauf der Kündigungsfrist ist (BAG 9. Juni 2011 - 2 AZR 381/10; BAG 10. Juni 2010 - 2 AZR 541/09). |
| 75 | Auch der Verdacht einer schwerwiegenden Pflichtverletzung kann einen wichtigen Grund im Sinne von § 626 Abs. 1 BGB bilden. Ein solcher Verdacht stellt gegenüber dem Vorwurf, der Arbeitnehmer habe die Tat begangen, einen eigenständigen Kündigungsgrund dar. Eine auf ihn gestützte Kündigung kann gerechtfertigt sein, wenn sich der Verdacht auf objektive Tatsachen gründet, die Verdachtsmomente geeignet sind, das für die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses erforderliche Vertrauen zu zerstören, und der Arbeitgeber alle zumutbaren Anstrengungen zur Aufklärung des Sachverhalts unternommen, insbesondere dem Arbeitnehmer Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben hat. Der Verdacht muss auf konkrete - vom Kündigenden darzulegende und ggf. zu beweisende - Tatsachen gestützt sein. Der Verdacht muss ferner dringend sein. Es muss eine große Wahrscheinlichkeit dafür bestehen, dass er in der Sache zutrifft. Die Umstände, die ihn begründen, dürfen nach allgemeiner Lebenserfahrung nicht ebenso gut durch ein Geschehen zu erklären sein, das eine außerordentliche Kündigung nicht zu rechtfertigen möchte. Bloße, auf mehr oder wenige haltbare Vermutungen gestützte Verdächtigungen reichen dementsprechend zur Rechtfertigung eines dringenden Tatverdachts nicht aus (BAG 20. Juni 2013 - 2 AZR 546/12). |
| 76 | 3. Ein Arbeitnehmer, der während des bestehenden Arbeitsverhältnisses Konkurrenztätigkeiten entfaltet, verstößt gegen seine Pflicht zur Rücksichtnahme auf die Interessen des Arbeitgebers aus § 241 Abs. 2 BGB. Es handelt sich in der Regel um eine erhebliche Pflichtverletzung. Sie ist „an sich“ geeignet, eine außerordentliche Kündigung zu rechtfertigen. Während des rechtlichen Bestehens eines Arbeitsverhältnisses ist einem Arbeitnehmer grundsätzlich jede Konkurrenztätigkeit zum Nachteil seines Arbeitgebers untersagt. Die für Handlungsgehilfen geltende Regelung des § 60 Abs. 1 HGB normiert einen allgemeinen Rechtsgedanken. Der Arbeitgeber soll vor Wettbewerbshandlungen seines Arbeitnehmers geschützt werden. Der Arbeitnehmer darf im Marktbereich seines Arbeitgebers Dienste und Leistungen nicht Dritten anbieten. Dem Arbeitgeber soll dieser Bereich uneingeschränkt und ohne die Gefahr einer nachteiligen Beeinflussung durch den Arbeitnehmer offenstehen. Dem Arbeitnehmer ist aufgrund des Wettbewerbsverbots nicht nur eine Konkurrenztätigkeit im eigenen Namen und Interesse untersagt. Ihm ist ebenso wenig gestattet, einen Wettbewerber des Arbeitgebers zu unterstützen (BAG 23. Oktober 2014 - 2 AZR 644/13). |
| 77 | 4. Ebenso kann es einen wichtigen Grund im Sinne von § 626 BGB zur fristlosen Kündigung darstellen, wenn der Arbeitnehmer unter Vorlage eines Attests der Arbeit fern bleibt und sich Entgeltfortzahlungen gewähren lässt, obwohl es sich in Wahrheit nur um eine vorgetäuschte Krankheit handelt. Der Arbeitnehmer begeht hierbei regelmäßig einen vollendeten Betrug. Denn durch Vorlage der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung hat er den Arbeitgeber unter Vortäuschung falscher Tatsachen dazu veranlasst, ihm unberechtigterweise Entgeltfortzahlung zu gewähren (BAG 26. August 1993 - 2 AZR 154/93). |
| 78 | 5. Es kann vorliegend aber kein dringender Verdacht einer unerlaubten Konkurrenztätigkeit oder eines Erschleichens von Entgeltfortzahlung festgestellt werden. Insbesondere den von der Beklagten behauptetermaßen über die Beobachtungen des Detektives gewonnenen Erkenntnissen darf nicht über eine Beweiserhebung nachgegangen werden. Die Beklagte hat die von ihr vorgetragenen Beweismittel gegen den Kläger nämlich rechtswidrig unter Verstoß gegen § 32 BDSG erlangt. Diese dürfen deshalb nicht verwertet werden. |
| 79 | a) Die Zivilprozessordnung kennt zwar für rechtswidrig erlangte Informationen und Beweismittel kein - ausdrückliches - prozessuales Verwendungs- bzw. Verwertungsverbot. Aus § 286 ZPO iVm. Art. 103 Abs. 1 GG folgt im Gegenteil die grundsätzliche Verpflichtung der Gerichte, den von den Parteien vorgetragenen Sachverhalt und die von ihnen angebotenen Beweise zu berücksichtigen. Dementsprechend bedarf es für die Annahme eines Beweisverwertungsverbots, das zugleich die Erhebung der angebotenen Beweise hindern soll, einer besonderen Legitimation in Gestalt einer gesetzlichen Grundlage. In gerichtlichen Verfahren tritt jedoch der Richter den Verfahrensbeteiligten in Ausübung staatlicher Hoheitsgewalt gegenüber. Er ist daher nach Art. 1 Abs. 3 GG bei der Urteilsfindung an die insoweit maßgeblichen Grundrechte gebunden und zu einer rechtsstaatlichen Verfahrensgestaltung verpflichtet. Dabei können sich auch aus materiellen Grundrechten wie Art. 2 Abs. 1 GG Anforderungen an das gerichtliche Verfahren ergeben, wenn es um die Offenbarung und Verwertung von persönlichen Daten geht, die grundrechtlich vor der Kenntnis durch Dritte geschützt sind. Das Gericht hat deshalb zu prüfen, ob die Verwertung von heimlich beschafften persönlichen Daten und Erkenntnissen, die sich aus diesen Daten ergeben, mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrechts des Betroffenen vereinbar ist. Dieses Recht gewährleistet nicht allein den Schutz der Privat- und Intimsphäre, sondern trägt in Gestalt des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung auch den informationellen Schutzinteressen des Einzelnen Rechnung. Es gewährleistet die aus dem Gedanken der Selbstbestimmung folgende Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst zu entscheiden, wann und innerhalb welcher Grenzen persönliche Lebenssachverhalte offenbart werden. Diesem Schutz dient auch Art. 8 Abs. 1 der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK). Die gesetzlichen Anforderungen an eine zulässige Datenverarbeitung im BDSG konkretisieren und aktualisieren den Schutz auf informationelle Selbstbestimmung und regeln, in welchem Umfang im Anwendungsbereich des Gesetzes Eingriffe in dieses zulässig sind. Dies stellt § 1 BDSG ausdrücklich klar. Liegt keine Einwilligung des Betroffenen vor, ist die Datenverarbeitung nach dem Gesamtkonzept des BDSG nur zulässig, wenn eine verfassungsgemäße Rechtsvorschrift diese erlaubt. Fehlt es an der danach erforderlichen Ermächtigungsgrundlage oder liegen deren Voraussetzungen nicht vor, ist die Erhebung, Verarbeitung und/oder Nutzung personenbezogener Daten verboten. Dieser das deutsche Datenschutzrecht prägende Grundsatz ist in § 4 Abs. 1 BDSG kodifiziert (BAG 20. Juni 2013 - 2 AZR 546/12; BAG 21. November 2013 - 2 AZR 797/11). |
| 80 | b) Die Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Datenerhebung und letztlich auch der prozessualen Verwertbarkeit hat demnach an § 32 BDSG zu erfolgen. Es ist zu prüfen, ob ein rechtswidriger Eingriff in das Persönlichkeitsrecht vorliegt. |
| 81 | Gem. der Bestimmung des § 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG dürfen personenbezogene Daten eines Beschäftigten für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn dies für die Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses oder nach dessen Begründung für seine Durchführung oder Beendigung erforderlich ist. Nach Abs. 1 Satz 2 der Regelung dürfen zur Aufdeckung von Straftaten personenbezogene Daten eines Beschäftigten nur dann erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn zu dokumentierende tatsächliche Anhaltspunkte den Verdacht begründen, dass der Betroffene im Beschäftigungsverhältnis eine Straftat begangen hat, die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung zur Aufdeckung erforderlich ist und das schutzwürdige Interesse des Beschäftigten am Ausschluss der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung nicht überwiegt, insbesondere Art und Ausmaß im Hinblick auf den Anlass nicht unverhältnismäßig sind (BAG 20. Juni 2013 - 2 AZR 546/12). |
| 82 | Nach § 3 Abs. 1 BDSG sind personenbezogene Daten Einzelangaben wie persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener). Erheben ist das Beschaffen von Daten über den Betroffenen, § 3 Abs. 3 BDSG (BAG 19. Februar 2015 - 8 AZR 1007/13). |
| 83 | c) Dies zugrundegelegt ist festzustellen, dass die Überwachung des Klägers durch einen Detektiv eine Datenerhebung im Sinne von § 32 Abs. 1 BDSG darstellte, zumal der Anwendungsbereich gem. § 32 Abs. 2 BDSG auch für nicht automatisierte Datenerhebungen eröffnet ist (BAG 19. Februar 2015 - 8 AZR 1007/13 -; BAG 20. Juni 2013 - 2 AZR 546/12). |
| 84 | d) Die Datenerhebung durch Detektivermittlungen war aber keine, die unter den Anwendungsbereich des § 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG fiel. |
| 85 | aa) Zwar können „zur Durchführung des Arbeitsverhältnisses“ Daten erhoben werden, die der Arbeitgeber zur Erfüllung seiner Pflichten aber auch zur Wahrnehmung seiner Rechte gegenüber dem Arbeitnehmer vernünftigerweise benötigt. Gestattet sind demnach auch Maßnahmen zur Kontrolle, ob der Arbeitnehmer den geschuldeten Pflichten nachkommt (Gola/Schomerus BDSG § 32 Rn. 16). Unter § 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG fallen aber nur solche Maßnahmen, die nicht auf die Entdeckung konkret Verdächtiger gerichtet sind. Soll einem konkreten Verdacht zielgerichtet nachgegangen werden, muss diese Maßnahme den Anforderungen des § 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG genügen (Gola/Schomerus BDSG 12. Aufl. § 32 Rn. 40, 41). |
| 86 | bb) Vorliegend ließe sich zwar argumentieren, die Beobachtungen durch den Detektiv hätten der Überprüfung der Einhaltung von Vertragspflichten gem. § 60 HGB gedient. Die Beobachtungen erfolgten jedoch gewollt und zielgerichtet nur gegen den Kläger wegen eines bereits bestehenden konkreten Verdachts. Die Maßnahme musste somit den Voraussetzungen des § 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG genügen. |
| 87 | e) Die Datenerhebung erfolgte aber auch nicht aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte, die den Verdacht einer im Beschäftigungsverhältnis begangenen Straftat begründen im Sinne von § 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG. |
| 88 | aa) Das Erschleichen von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ohne tatsächlich krank zu sein kann zwar eine Straftat sein. In Betracht kommt ein Straftatbestand des Betrugs gem. § 263 Abs. 1 BGB. Dies aber nur dann, wenn der Arbeitgeber aufgrund einer Täuschungshandlung eine Vermögensverfügung in Form von Entgeltfortzahlung getroffen hätte. Vorliegend war der Kläger aber bereits seit 20.01.2015 durchgehend als arbeitsunfähig krankgeschrieben. Der Entgeltfortzahlungszeitraum endete bereits am 02. März 2015. Im Juni 2015 bezog der Kläger schon lange Krankengeld. Ein Detektiveinsatz im Juni 2015 konnte somit nicht mehr auf einen Verdacht einer strafbaren Handlung gründen. |
| 89 | Denkbar wäre zwar, dass der Kläger im Juni 2015 durch Vortäuschen einer Arbeitsunfähigkeit einen strafbaren Betrug zu Lasten der Krankenkasse begangen haben könnte, indem diese zu einer Krankengeldzahlung veranlasst wurde. Jedoch würde es sich hierbei um keine Straftat „im Beschäftigungsverhältnis“ mehr handeln. |
| 90 | bb) Auch der Verdacht einer unerlaubten Konkurrenztätigkeit kann die Datenerhebung durch den Detektiveinsatz nicht rechtfertigen. Denn ein solches Handeln ist zwar grob vertragswidrig, aber jedenfalls im Regelfall, wenn nicht zugleich zB Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse verraten werden (§ 17 UWG), nicht strafbar. |
| 91 | Soweit das Bundesarbeitsgericht in seiner Entscheidung vom 28. Oktober 2010 (BAG 28. Oktober 2010 - 8 AZR 547/09) die Erstattungspflicht von Detektivkosten zur Aufdeckung von Konkurrenztätigkeit grundsätzlich bejaht hat ohne die Frage der Verwertbarkeit der so gewonnen Erkenntnis überhaupt zu problematisieren, so lag dies ersichtlich daran, dass der Fall einen Sachverhalt betraf, der vor Inkrafttreten des § 32 BDSG in der heutigen Fassung spielte. |
| 92 | cc) Die Beklagtenseite kann sich nicht darauf berufen, dass eine Beweiserhebung durch einen Detektiveinsatz auch in solchen Fällen möglich sein müsse, in denen zwar keine Strafbarkeit, wohl aber eine schwere Vertragspflichtverletzung vorliege. Diese Frage wurde von der Rechtsprechung zwar noch offen gelassen (BGH 26. September 2013 - VII ZR 227/12), ist jedoch angesichts des eindeutigen Wortlauts des § 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG zu verneinen (Wedde in Däubler/Klebe/Wedde/Weichert BDSG 4. Aufl. § 32 Rn. 125; Gola/Schomerus BDSG 12. Aufl. § 32 Rn. 41). Das mag für die Beklagte zwar unbefriedigend sein. Es ist jedoch ausschließlich dem Gesetzgeber vorbehalten, Gesetze zu ändern und korrigierend einzugreifen. |
| 93 | 6. Ein dringender Tatverdacht einer Vertragswidrigkeit ergibt sich auch nicht aus anderen Umständen außerhalb der Wahrnehmung des Detektivs. |
| 94 | a) Allein aus der Tatsache, dass das Fahrzeug des Klägers während der Arbeitsunfähigkeitszeiten gelegentlich auf dem Firmengelände der M. gesichtet wurde, lässt nicht mit einer großen Wahrscheinlichkeit auf Arbeitstätigkeiten oder ein Erschleichen der Arbeitsunfähigkeit rückschließen. Es handelt sich um das Familienfahrzeug, welches auch von anderen Familienmitgliedern gefahren wird. |
| 95 | b) Auch aus der der Beklagten am 29. Mai 2015 bekannt gewordenen E-Mail der M. kann nicht auf einen dringenden Tatverdacht geschlossen werden. |
| 96 |
In der E-Mail wurden zwar die Kenntnisse des Klägers gelobt, unter Hinweis, dass dieser seit 38 Jahren montiere und es unglaublich sei, was dieser so hinbekomme. Dass der Kläger für die M. tätig sei, wird jedoch nicht ausdrücklich beschrieben. Zwar spricht einige Wahrscheinlichkeit dafür, dass wenn die Firma M. auf diese Weise mit dem Kläger warb, sie damit zum Ausdruck bringen wollte, dass der Kläger auch für sie arbeite. Notwendig ist dieser Rückschluss aber nicht. Möglicherweise wollte Herr G. A. auch bloß die Bekanntheit des Klägers für Werbungszwecke ausnutzen und gegenüber dem Kunden zum Ausdruck bringen, aus welch „gutem Stall“ er und seine Brüder kommen. Die Beklagte hat zu Recht erkannt, dass ein konkreter dringender Verdacht erst bestehen kann, wenn der Kläger jedenfalls einer Arbeitsleistung für die Firma M. auch überführt werden kann. II. |
| 97 |
Kann aber ein konkreter dringender Tatverdacht mangels Verwertbarkeit der Erkenntnisse des Detektiveinsatzes nicht nachgewiesen werden, scheitert auch die hilfsweise ausgesprochen ordentliche Kündigung. Sie ist nicht sozial gerechtfertigt im Sinne von § 1 Abs. 2 KSchG. III. |
| 98 | Die Beklagte hat keinen Anspruch gegen den Kläger auf Rückzahlung geleisteter Entgeltfortzahlung für den Krankheitsfall aus § 812 Abs. 1 BGB. |
| 99 | 1. Die Beklagte müsste darlegen und beweisen, dass die von ihr erbrachten Leistungen ohne Rechtsgrund erfolgt sind. Dieser Nachweis ist ihr nicht gelungen. Ohne die Verwertbarkeit der durch den Detektiv gewonnenen Erkenntnisse ist schon der Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen nicht erschüttert. |
| 100 |
2. Aber selbst wenn man wegen einer erbrachten Arbeitsleistung am 03. Juni 2015 den Beweiswert der diesen Tag einschließenden Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für erschüttert halten wollte, könnte daraus nicht rückgeschlossen werden, dass der Kläger auch in den Krankheitszeiträumen zwischen Februar 2014 bis März 2015 nicht krank war, zumal eine Anwesenheit oder gar eine Arbeitsleistung des Klägers für die Fa. M. nicht beobachtet wurde. IV. |
| 101 | Der Beklagten steht auch keine Erstattung der Detektivkosten für den Einsatz im Monat Juni 2015 zu aus § 280 Abs. 1 BGB. |
| 102 | 1. Ein Arbeitnehmer hat wegen Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten dem Arbeitgeber die durch das Tätigwerden eines Detektivs entstandenen notwendigen Kosten zu ersetzen, wenn der Arbeitgeber aufgrund eines konkreten Tatverdachts gegen den Arbeitnehmer einem Detektiv die Überwachung eines Arbeitnehmers überträgt und der Arbeitnehmer einer vorsätzlichen Vertragsverletzung überführt wird (BAG 26. September 2013 - 8 AZR 1026/12; BAG 28. Oktober 2010 - 8 AZR 547/09). Zu ersetzen sind die Aufwendungen des Geschädigten nach § 249 BGB aber nur, soweit diese nach den Umständen des Falls als notwendig anzusehen sind (BAG 26. September 2013 - 8 AZR 1026/12). |
| 103 | 2. Vorliegend mag unterstellt werden, dass die Beklagte den Detektiv auf der Grundlage eines ausreichenden konkreten Tatverdachts beauftragt hat. Es fehlt schon an einer Überführung des Klägers wegen einer vorsätzlichen Vertragspflichtverletzung. Die Beklagte macht die Erkenntnisse des Detektivs schon selbst nicht für eine Tatkündigung, sondern nur für eine Verdachtskündigung geltend. |
| 104 |
3. Hinzu kommt, dass die Beklagte an der Verwertung der Erkenntnisse gehindert ist, siehe oben. Eine Beauftragung eines Detektivs für die Gewinnung von Erkenntnissen, die anschließend nicht verwertet werden dürfen, ist nicht notwendig. V. |
| 105 | Die Beklagte hat auch keinen Anspruch auf Auskunftserteilung über die Konkurrenztätigkeit des Klägers aus dem Arbeitsvertrag iVm. § 242 BGB. |
| 106 | 1. Kann der Arbeitgeber mit hoher Wahrscheinlichkeit dartun, dass sein Arbeitnehmer ihm während des bestehenden Arbeitsverhältnisses unerlaubte Konkurrenz gemacht hat, dann ist der Arbeitnehmer verpflichtet, über die von ihm getätigten Geschäfte Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen (BAG 21. Oktober 1970 - 3 AZR 479/69). |
| 107 | Vorliegend ist der Beklagten die Darlegung der hohen Wahrscheinlichkeit der Konkurrenztätigkeit mangels Verwertbarkeit der Erkenntnisse aus den Detektivermittlungen aber nicht gelungen. |
| 108 | 2. Die weiteren Stufen der Stufenklage waren nicht Gegenstand des Berufungsverfahrens. |
| 109 | Zwar kann das Berufungsgericht, das den Anspruch auf Auskunft verneint, gleichzeitig die weiteren Stufen durch einheitliches Endurteil abweisen, wenn diesen jegliche Grundlage entzogen wurde, denn das Beharren auf einer erstinstanzlichen Entscheidung über die weiteren Stufen wäre dann eine prozessunökonomische bloße Formelei (Zöller/Greger ZPO 31. Aufl. § 254 Rn. 14). So liegt der Fall aber vorliegend nicht. Zwar wurde der Auskunftsanspruch vorliegend verneint, aber nur mangels Beweisbarkeit. Dem Schadenersatzanspruch ist aber noch nicht endgültig jegliche Grundlage entzogen. |
| 110 | VI. Nebenentscheidungen |
| 111 | 1. Die Kostenentscheidung für die erste Instanz musste wegen des Grundsatzes der Einheitlichkeit der Kostenentscheidung dem Schlussurteil des Arbeitsgerichts vorbehalten bleiben, welches noch über die zweite und dritte Stufe der Stufenwiderklage entscheiden muss. |
| 112 | 2. Die Kostenentscheidung betreffend die Kosten der Berufung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO. Jede Partei hat die Kosten ihres Berufungsunterliegens zu tragen. |
| 113 | 3. Die Zulassung der Revision beruht auf § 72 Abs. 2 Nr. 1 ArbGG. Der Frage des Beweisverwertungsverbotes von Erkenntnissen aus gezielten Datenerhebungen über Nichtstraftatbestände wird grundsätzliche Bedeutung beigemessen. |
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gern:
 |
Dr. Martin Hensche Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hensche@hensche.de |
 |
Christoph Hildebrandt Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hildebrandt@hensche.de |
 |
Nina Wesemann Rechtsanwältin Fachanwältin für Arbeitsrecht Kontakt: 040 / 69 20 68 04 wesemann@hensche.de |