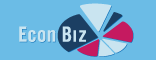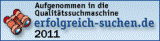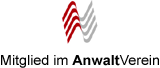- -> zur Mobil-Ansicht
- Arbeitsrecht aktuell
- Tipps und Tricks
- Handbuch Arbeitsrecht
- Gesetze zum Arbeitsrecht
- Urteile zum Arbeitsrecht
- Urteile 2023
- Urteile 2021
- Urteile 2020
- Urteile 2019
- Urteile 2018
- Urteile 2017
- Urteile 2016
- Urteile 2015
- Urteile 2014
- Urteile 2013
- Urteile 2012
- Urteile 2011
- Urteile 2010
- Urteile 2009
- Urteile 2008
- Urteile 2007
- Urteile 2006
- Urteile 2005
- Urteile 2004
- Urteile 2003
- Urteile 2002
- Urteile 2001
- Urteile 2000
- Urteile 1999
- Urteile 1998
- Urteile 1997
- Urteile 1996
- Urteile 1995
- Urteile 1994
- Urteile 1993
- Urteile 1992
- Urteile 1991
- Urteile bis 1990
- Arbeitsrecht Muster
- Videos
- Impressum-Generator
- Webinare zum Arbeitsrecht
-
Kanzlei Berlin
 030 - 26 39 62 0
030 - 26 39 62 0
 berlin@hensche.de
berlin@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Frankfurt
 069 - 71 03 30 04
069 - 71 03 30 04
 frankfurt@hensche.de
frankfurt@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hamburg
 040 - 69 20 68 04
040 - 69 20 68 04
 hamburg@hensche.de
hamburg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hannover
 0511 - 89 97 701
0511 - 89 97 701
 hannover@hensche.de
hannover@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Köln
 0221 - 70 90 718
0221 - 70 90 718
 koeln@hensche.de
koeln@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei München
 089 - 21 56 88 63
089 - 21 56 88 63
 muenchen@hensche.de
muenchen@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Nürnberg
 0911 - 95 33 207
0911 - 95 33 207
 nuernberg@hensche.de
nuernberg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Stuttgart
 0711 - 47 09 710
0711 - 47 09 710
 stuttgart@hensche.de
stuttgart@hensche.de
AnfahrtDetails
BAG, Urteil vom 21.11.2013, 2 AZR 797/11
| Schlagworte: | Verdachtskündigung, Kündigung: Personenbedingt, Kündigung: Verdachtskündigung | |
| Gericht: | Bundesarbeitsgericht | |
| Aktenzeichen: | 2 AZR 797/11 | |
| Typ: | Urteil | |
| Entscheidungsdatum: | 21.11.2013 | |
| Leitsätze: | Eine Verdachtskündigung ist auch als ordentliche Kündigung sozial nur gerechtfertigt, wenn Tatsachen vorliegen, die zugleich eine außerordentliche, fristlose Kündigung gerechtfertigt hätten. | |
| Vorinstanzen: | Landesarbeitsgericht Hamm, Urteil vom 15.07.2011 - 10 Sa 1781/10 Arbeitsgericht Bielefeld, Urteil vom 29.06.2010 - 1 Ca 2998/09 |
|
BUNDESARBEITSGERICHT
2 AZR 797/11
10 Sa 1781/10
Landesarbeitsgericht
Hamm
Im Namen des Volkes!
Verkündet am
21. November 2013
URTEIL
Schmidt, Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
In Sachen
Klägerin, Berufungsklägerin, Revisionsklägerin und Anschlussrevisionsbeklagte,
pp.
Beklagte, Berufungsbeklagte, Revisionsbeklagte und Anschlussrevisionsklägerin,
hat der Zweite Senat des Bundesarbeitsgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 21. Februar 2013 durch den Vorsitzenden Richter am Bundesarbeitsgericht Kreft, die Richterinnen am Bundesarbeitsgericht Berger und
- 2 -
Dr. Rinck sowie den ehrenamtlichen Richter Söller und die ehrenamtliche Richterin Schipp für Recht erkannt:
1. Die Anschlussrevision der Beklagten gegen das Urteil des Landesarbeitsgerichts Hamm vom 15. Juli 2011 - 10 Sa 1781/10 - wird zurückgewiesen.
2. Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Landesarbeitsgerichts im Kostenausspruch und insoweit aufgehoben, wie es die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Arbeitsgerichts Bielefeld vom 29. Juni 2010 - 1 Ca 2998/09 - zurückgewiesen hat.
3. Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten der Revisionsinstanz - an das Landesarbeitsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen!
Tatbestand
Die Parteien streiten über die Wirksamkeit einer außerordentlichen, hilfsweise ordentlichen Kündigung der Beklagten.
Die Beklagte ist ein Einzelhandelsunternehmen. Die 1967 geborene Klägerin war - unter Anrechnung von Vorbeschäftigungszeiten - seit 1991 bei ihr beschäftigt. Zuletzt war sie im Getränkemarkt des Einkaufsmarkts G tätig. Im Rahmen einer Teilzeitbeschäftigung erzielte sie einen monatlichen Bruttoverdienst iHv. 1.406,92 Euro. In dem Markt beschäftigt die Beklagte insgesamt weit mehr als zehn Arbeitnehmer, für die ein 7-köpfiger Betriebsrat errichtet ist.
In dem Getränkemarkt waren drei Kassen eingerichtet. Über eine Kasse erfolgte die Leergutannahme. Soweit sie nicht zu besetzen waren, wurde den Kassen der Geräteeinsatz mit dem Wechselgeld entnommen. Ursprünglich wurden die Einsätze im zentralen Kassenbüro des Einkaufsmarkts aufbewahrt.
- 3 -
Das brachte es mit sich, dass die Kassenmitarbeiter des Getränkemarkts den Einsatz bei Dienstantritt im Kassenbüro abholen und nach Dienstschluss dorthin zurückbringen mussten. Im Kassenbüro erhielten sie auch das Wechselgeld. Diese Gänge entfielen ab Mitte August 2009, nachdem die Beklagte im Getränkemarkt einen Tresor für die Aufbewahrung der Einsätze und des Wechselgelds hatte installieren lassen.
Der Umgang mit Geld war für alle Märkte in sog. Kassenanweisungen geregelt. Deren Erhalt hatte die Klägerin mit ihrer Unterschrift bestätigt. Nach den zuletzt gültigen Regelungen war es Kassenmitarbeitern untersagt, Bargeld in der Dienstkleidung oder im Schubfach des Kassentischs aufzubewahren, Geld aus der Kasse zu entnehmen oder es sich leihweise selbst oder anderen zur Verfügung zu stellen. Geld durfte weder zwischen den Kassenkräften untereinander gewechselt noch nach Geschäftsschluss in den Schubfächern der Kassen aufbewahrt werden. Die Herausgabe zusätzlichen Wechselgelds hatte durch die Marktleitung zu erfolgen. Geldwechselgeschäfte mit Kunden waren untersagt. Geld, das von Kunden liegengelassen wurde, war unmittelbar der Marktleitung auszuhändigen; anschließend sollte es im Büro/Tresor deponiert werden. Im August 2009 erließ die Beklagte zusätzlich eine „Ablaufbeschreibung Kassenbüro“. Danach sollten „Kassierdifferenzen“ täglich dem Geschäftsleiter gemeldet werden. „Fundgeld“ sollte einmal monatlich „in die 99-er Kasse eingezahlt“, „Klüngelgeld“ einmal pro Woche „auf WGR 700“ gebucht werden.
Im Getränkemarkt war seit jeher eine Videokamera installiert. Darüber waren die Mitarbeiter in Kenntnis gesetzt worden. Die Kamera ermöglichte die Überwachung des Kassenbereichs sowie der Ein- und Ausgänge. Die eigentlichen Kassiervorgänge wurden nicht erfasst.
Zur Mitte des Jahres 2009 stellte die Beklagte anlässlich einer Revision fest, dass in der ersten Jahreshälfte Leergutdifferenzen iHv. mehr als 7.000,00 Euro aufgetreten waren. Nachdem Kontrollen des Lagerbestands und des Warenausgangs keine Hinweise auf Unregelmäßigkeiten ergeben hatten, vermutete sie deren Ursache im Kassenbereich. Sie ging von der Möglichkeit aus, dass dort ohne Entgegennahme von Leergut „falsche“ Bons gedruckt und
- 4 -
entsprechende Gelder der Kasse entnommen würden. Am 7. Juli 2009 vereinbarte sie mit dem Vorsitzenden des Betriebsrats für die Dauer von vier Wochen die Durchführung einer verdeckten Videoüberwachung des Kassenbereichs. Sie beauftragte eine Fachfirma, die in der Zeit vom 13. Juli bis 3. August 2009 die Kassenvorgänge mittels Videokamera aufzeichnete. Die der Firma gleich-falls übertragene Auswertung der Aufzeichnungen einschließlich der Erstellung eines Zusammenschnitts und einer Dokumentation war am 3. September 2009 abgeschlossen. Aus den Aufzeichnungen ging hervor, dass sich unter der Leergutkasse des Getränkemarkts ein Plastikbehälter befand, in dem Geld aufbewahrt wurde. Außerdem war zu erkennen, dass die Klägerin am 16. Juli 2009 gegen 8:45 Uhr, am 22. Juli 2009 gegen 16:13 Uhr und am 23. Juli 2009 gegen 18:34 Uhr diesem Behältnis Geld entnahm und in ihre Hosentasche steckte. Die Vorgänge als solche sind unstreitig.
Am 14. August 2009 hatte die Beklagte der Klägerin wegen eines Verhaltens vom 11. Juli 2009 eine Abmahnung erteilt. An diesem Tag hatte die Klägerin nach Dienstschluss Wechselgeld iHv. 300,00 Euro mit nach Hause genommen, statt es weisungsgemäß im Kassenbüro abzugeben. Die Klägerin hatte sich in einem noch am selben Abend geführten Telefonat auf ein Versehen berufen und das Geld am 12. Juli 2009 bei der Beklagten abgeliefert.
Noch am 3. September 2009 führte die Beklagte im Getränkemarkt eine Kontrolle des Kassenbereichs durch; der dort vorgefundene Plastikbehälter enthielt Münzen im Wert von 12,35 Euro. Am 4. September 2009 hörte sie die Klägerin zur Existenz dieser sog. Klüngelgeld-Kasse an und konfrontierte sie mit dem Vorwurf, hieraus Geld für eigene Zwecke entnommen zu haben. Mit Schreiben vom 8. September 2009 bat sie den Betriebsrat um Stellungnahme zu einer beabsichtigten fristlosen, hilfsweise fristgemäßen Kündigung wegen des Verdachts der Untreue und Unterschlagung. Mit Schreiben vom 11. September 2009 kündigte die Beklagte das Arbeitsverhältnis der Parteien „fristlos, hilfsweise fristgerecht zum 31. März 2010“.
- 5 -
Die Klägerin hat mit ihrer fristgerecht erhobenen Klage geltend gemacht, ein wichtiger Grund für eine außerordentliche Kündigung iSd. § 626 BGB liege nicht vor. Eine ordentliche Kündigung sei sozial ungerechtfertigt. „Klüngelgeld-Kassen“ existierten in sämtlichen Bereichen des Einkaufsmarkts. Sie dienten dazu, Wechselgeld aufzubewahren, das Kunden partout nicht hätten mitnehmen wollen. Sie selbst habe Geld, das sie dieser Kasse entnommen habe, dafür verwendet - wie in vergleichbaren Fällen andere Kassenkräfte auch -, morgens einen Einkaufswagen auszulösen, um damit zugleich mehrere im Getränkemarkt benötigte Kasseneinsätze zu transportieren. Teilweise habe sie dafür zunächst ein eigenes Geldstück benutzt und dies später über die „Klüngelgeld-Kasse“ ausgeglichen. Teilweise sei Kleingeld aus dieser Kasse gegen Geld im Kasseneinsatz getauscht worden, um nicht noch kurz vor Kassenschluss eine neue Wechselgeldrolle öffnen zu müssen. Ihr Verhalten rechtfertige keine Kündigung. Die Zusammenschnitte der Videoaufnahmen, die ohnehin einem Beweisverwertungsverbot unterlägen, böten keinen tauglichen Beweis dafür, dass sie sich Geld aus der fraglichen Kasse rechtswidrig zugeeignet habe. Überdies sei die Betriebsratsanhörung fehlerhaft. Die Klägerin hat Lohnforderungen für die Zeit von September 2009 bis einschließlich Mai 2010 erhoben.
Sie hat - soweit noch von Interesse - beantragt
1. festzustellen, dass das Arbeitsverhältnis der Parteien durch die Kündigung vom 11. September 2009 nicht aufgelöst worden ist;
2. die Beklagte zu verurteilen, sie bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung über den Feststellungsantrag zu unveränderten Bedingungen weiter zu beschäftigen;
3. die Beklagte zu verurteilen, an sie 13.506,28 Euro brutto nebst Zinsen iHv. fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus diversen Teilbeträgen seit unterschiedlichen Zeitpunkten zu zahlen;
4. die Beklagte zu verurteilen, ihr einen Warengut-schein über 275,00 Euro auszustellen und auszuhändigen;
- 6 -
5. die Beklagte zu verurteilen, ihr ein qualifiziertes Zwischenzeugnis zu erteilen.
Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen. Sie hat vorgebracht, die Klägerin habe ihre Vertragspflichten schon durch das unerlaubte Führen einer „schwarzen Kasse“ erheblich verletzt. Darüber hinaus habe sie der fraglichen Kasse Geld in der offenkundigen Absicht entnommen, es für sich zu behalten. Zumindest sei sie einer solchen Tat dringend verdächtig. Die Klägerin habe sich - wie aus den Videoaufnahmen ersichtlich - vor jeder Geldentnahme vergewissert, dass ihr niemand zusehe. Dessen habe es bei redlichem Vorgehen nicht bedurft. Ihre Einlassung, sie habe Geldstücke für den Transport der Kasseneinsätze benötigt, stelle eine Schutzbehauptung dar. Für entsprechende Zwecke habe ein Einkaufswagen bereitgestanden, der nicht eigens habe ausgelöst werden müssen. Im Übrigen ergebe sich aus dem Videomaterial nicht, dass die Klägerin mitgeführte Geldstücke je in die „Klüngelgeld-Kasse“ zurückgelegt habe. Die Videoaufzeichnungen seien rechtlich verwertbar. Im Zeitpunkt der Beobachtung habe ein hinreichend eingegrenzter Verdacht dahingehend bestanden, dass Leergutdifferenzen durch Unregelmäßigkeiten im Kassenbereich des Getränkemarkts entstünden. Mildere Mittel zur Aufklärung des Verdachts hätten nicht zur Verfügung gestanden.
Das Arbeitsgericht hat die Videoaufzeichnungen zu Beweiszwecken in Augenschein genommen und die Klage - soweit noch von Interesse - in vollem Umfang abgewiesen. Das Landesarbeitsgericht hat nach erneuter Beweisaufnahme auf die Unwirksamkeit der fristlosen Kündigung erkannt. Zudem hat es die Beklagte zur Zahlung von Vergütung nebst Zinsen für die Zeit bis zum 31. März 2010 und zur Aushändigung eines Warengutscheins verurteilt. Die weitergehende Berufung der Klägerin hat es zurückgewiesen. Mit ihrer Revision verfolgt die Klägerin ihr Klagebegehren hinsichtlich der ordentlichen Kündigung und davon abhängiger Ansprüche weiter. Mit ihrer Anschlussrevision erstrebt die Beklagte die Wiederherstellung des erstinstanzlichen Urteils.
- 7 -
Entscheidungsgründe
Die Anschlussrevision der Beklagten ist unbegründet. Die außerordentliche Kündigung vom 11. September 2009 ist unwirksam. Die Revision der Klägerin ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils (§ 562 Abs. 1 ZPO) und zur Zurückverweisung der Sache an das Landesarbeitsgericht (§ 563 Abs. 1 Satz 1 ZPO), soweit dieses die Berufung der Klägerin zurückgewiesen hat.
I. Die Anschlussrevision der Beklagten, soweit sie sich gegen die Entscheidung über das Feststellungsbegehren der Klägerin richtet, hat keinen Er-folg. Das Arbeitsverhältnis der Parteien ist durch die außerordentliche Kündigung vom 11. September 2009 nicht aufgelöst worden.
1. Gemäß § 626 Abs. 1 BGB kann das Arbeitsverhältnis aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden, wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund derer dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses selbst bis zum Ablauf der Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. Dafür ist zunächst zu prüfen, ob der Sachverhalt ohne seine besonderen Umstände „an sich“, dh. typischerweise als wichtiger Grund geeignet ist. Alsdann bedarf es der weiteren Prüfung, ob dem Kündigenden die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des Falls und unter Abwägung der Interessen beider Vertragsteile - jedenfalls bis zum Ablauf der Kündigungsfrist - zumutbar ist oder nicht (BAG 19. April 2012 - 2 AZR 258/11 - Rn. 13; 9. Juni 2011 - 2 AZR 323/10 - Rn. 14; 10. Juni 2010 - 2 AZR 541/09 - Rn. 16, BAGE 134, 349).
2. Als wichtiger Grund „an sich“ geeignet sind nicht nur erhebliche Pflichtverletzungen im Sinne von nachgewiesenen Taten. Auch der dringende, auf objektive Tatsachen gestützte Verdacht einer schwerwiegenden Pflichtverletzung kann einen wichtigen Grund bilden. Ein solcher Verdacht stellt gegenüber dem Vorwurf, der Arbeitnehmer habe die Tat begangen, einen eigenständigen
- 8 -
Kündigungsgrund dar (zu den Voraussetzungen vgl. nur BAG 25. Oktober 2012 - 2 AZR 700/11 - Rn. 13 mwN).
3. Bei der Prüfung, ob dem Arbeitgeber eine Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers trotz Vorliegens einer erheblichen Pflichtverletzung oder eines dahingehenden dringenden Verdachts jedenfalls bis zum Ablauf der Kündigungsfrist zumutbar ist, ist in einer Gesamtwürdigung das Interesse des Arbeitgebers an der sofortigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses gegen das Interesse des Arbeitnehmers an dessen Fortbestand abzuwägen. Es hat eine Bewertung des Einzelfalls unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zu erfolgen (BAG 19. April 2012 - 2 AZR 258/11 - Rn. 14; 10. Juni 2010 - 2 AZR 541/09 - Rn. 34, BAGE 134, 349). Dabei lassen sich die Umstände, anhand derer zu beurteilen ist, ob dem Arbeitgeber die Weiterbeschäftigung zumutbar ist oder nicht, nicht abschließend festlegen. Zu berücksichtigen sind aber regelmäßig das Gewicht und die Auswirkungen der in Rede stehenden Pflichtverletzung, der Grad des Verschuldens des Arbeitnehmers, eine mögliche Wiederholungsgefahr sowie die Dauer des Arbeitsverhältnisses und dessen störungsfreier Verlauf (BAG 19. April 2012 - 2 AZR 258/11 - aaO; 10. Juni 2010 - 2 AZR 541/09 - Rn. 34, aaO). Eine außerordentliche Kündigung kommt nur in Betracht, wenn es keinen angemessenen Weg gibt, das Arbeitsverhältnis fortzusetzen, weil dem Arbeitgeber sämtliche milderen Reaktionsmöglichkeiten unzumutbar sind (BAG 9. Juni 2011 - 2 AZR 323/10 - Rn. 27; 16. Dezember 2010 - 2 AZR 485/08 - Rn. 24). Ein gegenüber der fristlosen Kündigung in diesem Sinne milderes Mittel ist ua. die ordentliche Kündigung (vgl. BAG 10. Juni 2010 - 2 AZR 541/09 - Rn. 35, aaO).
4. Danach ist die Würdigung des Landesarbeitsgerichts revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Dabei kann zugunsten der Beklagten unterstellt werden, dass gegen die Klägerin ein dringender Verdacht bestand, sich mehrfach Geldstücke aus der „Klüngelgeld-Kasse“ rechtswidrig zugeeignet zu haben, und deshalb „an sich“ ein wichtiger Grund iSd. § 626 Abs. 1 BGB vorlag. Im Rahmen seiner Beurteilung, selbst dann sei es der Beklagten bei Abwägung der Interessen beider Vertragsparteien nicht unzumutbar gewesen, die ordentliche
- 9 -
Kündigungsfrist einzuhalten, hat das Landesarbeitsgericht alle für und gegen dieses Ergebnis sprechenden Aspekte berücksichtigt und vertretbar gegeneinander abgewogen.
a) Das Landesarbeitsgericht hat der Klägerin zugutegehalten, dass sie durch eine beanstandungsfreie Tätigkeit über rund 18 Jahre hinweg als Verkäuferin und Kassiererin Loyalität zur Beklagten gezeigt habe. Dies hält sich - auch in Anbetracht der Abmahnung vom 14. August 2009 - im tatrichterlichen Beurteilungsspielraum. Die Beklagte ist der Behauptung der Klägerin, sie habe am 11. Juli 2009 die Ablieferung des Wechselgeldes aufgrund hohen Arbeitsanfalls schlicht vergessen, nicht entgegengetreten. Bei dem gerügten Verhalten handelt es sich mithin um einen - unbewussten - Ordnungsverstoß, der die Annahme, die Klägerin habe sich bis zu den umstrittenen Geldentnahmen aus der „Klüngelgeld-Kasse“ als vertrauenswürdig erwiesen, nicht, schon gar nicht zwingend infrage zu stellen vermochte.
b) Ohne Rechtsfehler hat das Landesarbeitsgericht zugunsten der Klägerin berücksichtigt, dass der Beklagten allenfalls ein geringfügiger Schaden entstanden sei. Hat der Arbeitnehmer die Integrität von Eigentum oder Vermögen seines Arbeitgebers vorsätzlich verletzt oder ist er einer solchen Tat dringend verdächtig, beeinträchtigt dies zwar die für die Durchführung der Vertragsbeziehung notwendige Vertrauensgrundlage grundsätzlich unabhängig vom Wert des betroffenen Gegenstands (BAG 10. Juni 2010 - 2 AZR 541/09 - Rn. 27, BAGE 134, 349). Das schließt es aber nicht aus, bei der Gewichtung des Kündigungssachverhalts auf die Höhe eines eingetretenen Schadens Bedacht zu nehmen (BAG 10. Juni 2010 - 2 AZR 541/09 - aaO; 12. August 1999 - 2 AZR 923/98 - zu II 2 b aa der Gründe, BAGE 92, 184). Die im Berufungsurteil getroffene Interessenabwägung ist - anders als die Beklagte meint - nicht deshalb zu beanstanden, weil sich in der fraglichen Kasse am 4. September 2009 Münzen im Wert von etwas mehr als zwölf Euro befanden. Unbeschadet der Frage, ob bei einem Vermögensnachteil in dieser Höhe eine „Geringfügigkeitsschwel-le“ überschritten wäre, ist nicht festgestellt, dass die Klägerin im Verdacht stand, sich Geld in diesem Umfang rechtswidrig zugeeignet oder hierzu doch
- 10 -
unmittelbar angesetzt zu haben. Im Übrigen handelte es sich bei dem Umgang mit „Klüngelgeld“ um einen Bereich am Rande der Kassentätigkeit, den die Beklagte ausweislich der im August 2009 erlassenen „Ablaufbeschreibung Kassenbüro“ offenbar selbst für nicht ausreichend geregelt hielt. Auch wenn dieser Gesichtspunkt nicht geeignet ist, das dem - unterstellten - Verdacht zugrunde-liegende Verhalten zu rechtfertigen, durfte das Landesarbeitsgericht ihn zugunsten der Klägerin in seine Gesamtbetrachtung einbeziehen.
c) Das Landesarbeitsgericht hat die Heimlichkeit des dem Verdacht zugrundeliegenden - unterstellten - Verhaltens nicht außer Acht gelassen, wie die Beklagte gemeint hat. Es hat in ihr lediglich keinen Umstand gesehen, der im vorliegenden Fall die Weiterbeschäftigung der Klägerin für die Dauer der Kündigungsfrist ausgeschlossen hätte. Das hält sich ebenso im tatrichterlichen Beurteilungsspielraum wie die Berücksichtigung der Unterhaltsverpflichtung der Klägerin gegenüber ihrem Kind.
II. Ob das Arbeitsverhältnis durch die ordentliche Kündigung vom 11. September 2009 aufgelöst worden ist, steht noch nicht fest. Zwar geht das Landesarbeitsgericht zutreffend von einer ordnungsgemäßen Anhörung des Betriebsrats aus (1.). Es durfte aber nicht annehmen, die ordentliche Kündigung sei auch materiell-rechtlich als Verdachtskündigung rechtswirksam, weil sie zwar nicht den Voraussetzungen von § 626 Abs. 1 BGB, wohl aber denen des § 1 Abs. 2 KSchG genüge. Ist der Arbeitnehmer eines Verhaltens verdächtig, das, wäre es erwiesen, nicht auch eine außerordentliche Kündigung nach § 626 Abs. 1 BGB, sondern lediglich eine ordentliche Kündigung nach § 1 Abs. 2 KSchG zu rechtfertigen vermöchte, ist dem Arbeitgeber die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses - trotz des Verdachts - nicht unzumutbar (2.). Da das Landesarbeitsgericht die ordentliche Kündigung bereits als Verdachtskündigung für wirksam gehalten hat, hat es nicht geprüft, ob eine ordentliche Kündigung wegen erwiesener Pflichtwidrigkeiten berechtigt wäre. Dies wird es nachzuholen haben. Dabei darf es den Inhalt der Videoaufzeichnungen nicht berücksichtigen. Deren Verwertung ist prozessual unzulässig (3.).
- 11 -
1. Die Rüge der Klägerin, das Landesarbeitsgericht habe § 102 Abs. 1 Satz 2 BetrVG fehlerhaft angewandt, ist unbegründet.
a) Für die Mitteilung der Kündigungsgründe iSd. § 102 Abs. 1 Satz 2 BetrVG gilt der Grundsatz der „subjektiven Determinierung“ (BAG 19. Juli 2012 - 2 AZR 352/11 - Rn. 41; 9. Juni 2011 - 2 AZR 323/10 - Rn. 45; jeweils mwN). Der Arbeitgeber muss dem Betriebsrat die Umstände mitteilen, die seinen Kündigungsentschluss tatsächlich bestimmt haben. Dem kommt er dann nicht nach, wenn er schon aus seiner eigenen Sicht dem Betriebsrat einen unrichtigen oder unvollständigen Sachverhalt darstellt (BAG 12. August 2010 - 2 AZR 945/08 - Rn. 18; 7. November 2002 - 2 AZR 599/01 - zu B I 1 a der Gründe mwN).
b) Danach ist die Anhörung inhaltlich ordnungsgemäß erfolgt.
aa) Die Beklagte hat den Betriebsrat am 8. September 2009 schriftlich von ihrer Absicht unterrichtet, das Arbeitsverhältnis der Parteien wegen des „Verdachts einer Untreue und Unterschlagung“ hilfsweise auch ordentlich zu kündigen. Sie hat ihm dabei die Sozialdaten der Klägerin und die Dauer der einzuhaltenden Kündigungsfrist mitgeteilt. Außerdem hat sie den Anlass, den Zeitraum und das Ergebnis der Videoüberwachung dargestellt. Selbst wenn sich einzelne Angaben als unzutreffend herausgestellt haben sollten - etwa weil die für den 24. Juli 2009 mitgeteilte Geldentnahme tatsächlich nicht die Klägerin, sondern eine Kollegin betrifft und weder die „Speisung“ der Kasse noch die Geldentnahme vom 22. Juli 2009 in Zusammenhang mit der Entgegennahme von Leergut gestanden haben mögen - genügt die Anhörung den gesetzlichen Anforderungen. Es liegen keine Anhaltspunkte für eine bewusst unrichtige oder irreführende Unterrichtung des Betriebsrats vor. Beruhen die falschen Angaben auf einer Verwechslung von Daten oder fehlerhaften Deutung von Äußerungen der Klägerin im Anhörungsgespräch vom 4. September 2009, ist dies im Rahmen von § 102 Abs. 1 BetrVG unschädlich. Entscheidend ist, dass dem Betriebsrat der Kern des Kündigungsvorwurfs zutreffend mitgeteilt wurde. Maßgebend für den Kündigungsentschluss der Beklagten war, dass die Klägerin entgegen eindeutigen Vorgaben Geld, das entweder ihr - der Beklagten - oder ihren Kunden
- 12 -
zustand, in einem Plastikbehälter neben der Kasse im Getränkemarkt aufbewahrte, und der damit in Zusammenhang stehende Verdacht, aus diesem Behälter gelegentlich Geld für eigene Zwecke entnommen zu haben. Darauf, ob die Klägerin dies zweimal oder dreimal tat, kam es der Beklagten nicht an. Gleiches gilt für die Frage, ob die Geldentnahme in einem engen zeitlichen Zusammenhang mit der Bedienung eines Kunden stand.
bb) Die Beklagte brauchte den Betriebsrat nicht darüber zu unterrichten, dass die Überwachung mittels Videokamera - wie die Klägerin gemeint hat - unrechtmäßig war. Davon ging sie subjektiv nicht aus. Soweit die Klägerin nähere Angaben zur Interessenabwägung vermisst, ist dies ohne rechtlichen Belang. Die Anhörung zu ihrer Absicht, das Arbeitsverhältnis der Parteien zu kündigen, impliziert die von der Beklagten zu ihren - der Klägerin - Lasten getroffene Abwägung. Eine nähere Begründung war vor dem Hintergrund des Grundsatzes der subjektiven Determinierung nicht erforderlich. Die Klägerin übersieht, dass die Mitteilungspflicht des Arbeitgebers im Rahmen von § 102 Abs. 1 Satz 2 BetrVG nicht so weit reicht wie seine Darlegungslast im Prozess (vgl. BAG 19. Juli 2012 - 2 AZR 352/11 - Rn. 45; 23. Oktober 2008 - 2 AZR 163/07 - Rn. 19 mwN).
cc) Den Feststellungen im Berufungsurteil zufolge hat der Betriebsrat am 10. September 2009 erklärt, er habe die Kündigungsabsicht zur Kenntnis genommen. Das Landesarbeitsgericht hat darin fehlerfrei eine abschließende Stellungnahme erblickt, die es der Beklagten betriebsverfassungsrechtlich ermöglichte, die ordentliche Kündigung am 11. September 2009 zu erklären.
2. Dagegen trägt die Begründung, mit der das Landesarbeitsgericht die ordentliche Kündigung vom 11. September 2009 auch materiell-rechtlich für wirksam angesehen hat, seine Würdigung nicht.
a) Das Landesarbeitsgericht hat angenommen, die Klägerin komme zwar nicht als Verursacherin der Leergutdifferenzen in Betracht. Sie stehe aber im dringenden Verdacht, sich fremdes Geld aus der „Klüngelgeld-Kasse“ rechtswidrig zugeeignet zu haben. Am 16. Juli und am 22. Juli 2009 habe sie einzelne
- 13 -
daraus entnommene Geldstücke in ihre Hosentasche gesteckt. Durch die in Augenschein genommenen Videosequenzen sei bewiesen, dass sie sich bei diesen Handlungen jeweils „versichernd“ in mehrere Richtungen umgesehen habe. Damit habe sie sicherstellen wollen, nicht beobachtet zu werden. Das heimliche Vorgehen spreche für eine Zueignungsabsicht. Zugleich widerlege es ihre Einlassung, die Geldstücke für das Auslösen eines Einkaufswagens benötigt zu haben. Erhärtet werde der Verdacht auf eine Zueignungsabsicht dadurch, dass die Klägerin am 23. Juli 2009 gegen 18:34 Uhr der fraglichen Kasse mehrere Geldstücke entnommen und gegen Geld aus der Scannerkasse „getauscht“ habe. Überdies sei die Höhe des am 3. September 2009 in dem fraglichen Behälter vorgefundenen Geldbetrags nicht mit dem nur gelegentlichen Auslösen eines Einkaufswagens zu erklären. Gestützt auf diese tatsächlichen Umstände ist das Landesarbeitsgericht zu der Auffassung gelangt, die Kündigung vom 11. September 2009 sei „durch Gründe, die im Verhalten der Klägerin liegen, bedingt“. Das Vertrauen der Beklagten in die Zuverlässigkeit der Klägerin sei „durch die erwiesenen Verdachtsmomente“ irreparabel erschüttert. Die ordentliche Kündigung sei deshalb als gegenüber der außerordentlichen Kündigung milderes Mittel sozial gerechtfertigt.
b) Diese Würdigung ist rechtsfehlerhaft. Das Landesarbeitsgericht hat die Wirksamkeit der ordentlichen Kündigung vom 11. September 2009 erkennbar als die einer Verdachtskündigung bejaht. Als solche genügt sie den gesetzlichen Wirksamkeitsvoraussetzungen nicht. Zwar kann eine Verdachtskündigung vom Arbeitgeber auch als ordentliche Kündigung unter Einhaltung der Kündigungsfrist erklärt werden und muss nicht notwendig eine außerordentliche Kündigung sein. Sie unterliegt in diesem Fall jedoch keinen geringeren materiell-rechtlichen Anforderungen.
aa) Eine Verdachtskündigung ist auch als ordentliche Kündigung sozial nur gerechtfertigt, wenn Tatsachen vorliegen, die zugleich eine außerordentliche, fristlose Kündigung gerechtfertigt hätten (vgl. BAG 27. November 2008 - 2 AZR 98/07 - Rn. 22; Krause in vHH/L 15. Aufl. § 1 Rn. 470; Löwisch in Löwisch/ Spinner/Wertheimer KSchG 10. Aufl. § 1 Rn. 276). Dies gilt zum einen für die
- 14 -
Anforderungen an die Dringlichkeit des Verdachts als solchen. In dieser Hinsicht bestehen keine Unterschiede zwischen außerordentlicher und ordentlicher Kündigung. Für beide Kündigungsarten muss der Verdacht gleichermaßen erdrückend sein (vorausgesetzt in BAG 29. November 2007 - 2 AZR 724/06 - Rn. 42; Bader/Bram-Bram KSchG § 1 Rn. 251). Dies gilt zum anderen für die inhaltliche Bewertung des fraglichen Verhaltens und die Interessenabwägung. Auch im Rahmen von § 1 Abs. 2 KSchG müssen sie zu dem Ergebnis führen, dass das Verhalten, dessen der Arbeitnehmer verdächtig ist, - wäre es erwiesen - sogar eine sofortige Beendigung des Arbeitsverhältnisses rechtfertigen würde. Nur unter dieser Voraussetzung ist die Kündigung schon durch den bloßen Verdacht pflichtwidrigen Verhaltens iSv. § 1 Abs. 2 KSchG „bedingt“.
bb) Angesichts der jeweils aus Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG folgenden, gegensätzlichen Grundrechtspositionen der Arbeitsvertragsparteien bedarf das Rechtsinstitut der Verdachtskündigung der besonderen verfassungsrechtlichen Legitimation. Sie beruht auf der Erwägung, dass dem Arbeitgeber von der Rechtsordnung die Fortsetzung eines Arbeitsverhältnisses unter dem dringenden Verdacht auf ein Verhalten des Arbeitnehmers, das ihn zur sofortigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses berechtigen würde, nicht zugemutet werden kann. Besteht dagegen der Verdacht auf das Vorliegen eines solchen Grundes nicht, weil selbst erwiesenes Fehlverhalten des Arbeitnehmers die sofortige Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht rechtfertigen könnte, überwiegt bei der Güterabwägung im Rahmen von Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG das Bestandsinteresse des Arbeitnehmers. In einem solchen Fall nimmt die Rechtsordnung das Risiko, einen „Unschuldigen“ zu treffen, nicht in Kauf.
cc) Ist der Arbeitnehmer eines Verhaltens verdächtig, dass selbst als erwiesenes nur eine ordentliche Kündigung zu stützen vermöchte, ist dem Arbeitgeber die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses deshalb trotz des entsprechenden Verdachts zuzumuten. Weder liegt ein Grund im Verhalten des Arbeitnehmers, noch liegt ein Grund in der Person des Arbeitnehmers vor, der die Kündigung „bedingen“ könnte. Ein pflichtwidriges Verhalten ist - wie stets bei der Verdachtskündigung - nicht erwiesen und der bloße Verdacht auf ein lediglich
- 15 -
die ordentliche Kündigung rechtfertigendes Verhalten führt nicht zu einem Eignungsmangel.
c) Das Landesarbeitsgericht hat im Rahmen der Interessenabwägung nach § 626 Abs. 1 BGB angenommen, dass das Verhalten, dessen die Klägerin verdächtig ist, eine außerordentliche Kündigung nicht zu stützen vermöchte. Diese Würdigung hält, wie dargelegt, der revisionsrechtlichen Überprüfung stand. Damit steht zugleich fest, dass eine Verdachtskündigung auch als ordentliche Kündigung nicht in Betracht kommt.
3. Der Rechtsfehler führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Landesarbeitsgericht. Dem Senat ist eine abschließende Entscheidung nicht möglich. Das angefochtene Urteil stellt sich nicht deshalb als im Ergebnis richtig dar, weil die ordentliche Kündigung vom 11. September 2009 zwar nicht als Verdachts-, aber doch als sog. Tatkündigung wirksam wäre. Als solche ist sie nicht schon auf der Grundlage des eigenen Vortrags der Klägerin sozial gerechtfertigt. Um dies auf der Grundlage des Vorbringens der Beklagten beurteilen zu können, fehlt es an Feststellungen und deren Würdigung durch das Landesarbeitsgericht. Diese sind nicht deshalb entbehrlich, weil sich die Beklagte auf eine erwiesene Pflichtverletzung als Kündigungsgrund prozessual nicht berufen hat und der Wirksamkeit der ordentlichen Kündigung unter diesem Aspekt überdies § 102 Abs. 1 BetrVG entgegenstünde.
a) Das Vorbringen der Klägerin selbst trägt die Kündigung nicht. Die Klägerin hat sich für die Existenz der „Klüngelgeld-Kasse“ auf eine in verschiedenen Abteilungen des Betriebs geübte Praxis und überdies darauf berufen, diese sei der Beklagten - zumindest rudimentär - bekannt gewesen. Trifft dies zu, liegt in dem Vorhalten der fraglichen Kasse für sich genommen kein Verhalten, das die Kündigung ohne vorausgehende Abmahnung rechtfertigen könnte. Dass die Klägerin, wie sie einräumt, dieser Kasse gelegentlich einzelne Geldstücke entnommen und außerdem darin enthaltene Münzen gegen im Kasseneinsatz befindliche Geldstücke gewechselt hat, führt zu keinem anderen Ergebnis. Dass
- 16 -
sie Geldstücke an sich genommen habe, um sich diese rechtswidrig zuzueignen, hat die Klägerin stets in Abrede gestellt.
b) Auf der Grundlage des Vorbringens der Beklagten ist die Sache nicht zur Endentscheidung reif. Auch wenn die Beklagte neben dem Führen der „Klüngelgeld-Kasse“ als solchem nur den Verdacht auf die rechtswidrige Zueignung von Geldstücken als Kündigungsgrund in den Prozess eingeführt hat, ist das Landesarbeitsgericht nicht gehindert, aufgrund der objektiven Verdachts-umstände ggf. zu der Überzeugung zu gelangen, der Verdacht habe sich in der Weise bestätigt, dass die fragliche Pflichtwidrigkeit nachgewiesen sei.
aa) Das Landesarbeitsgericht würde auf diese Weise nicht etwa Vortrag berücksichtigen, den die Beklagte nicht gehalten hätte. Der Verdacht eines pflichtwidrigen Verhaltens stellt zwar gegenüber dem Tatvorwurf einen eigenständigen Kündigungsgrund dar (st. Rspr., BAG 23. Juni 2009 - 2 AZR 474/07 - Rn. 55 mwN, BAGE 131, 155). Beide Gründe stehen jedoch nicht beziehungslos nebeneinander. Wird die Kündigung mit dem Verdacht pflichtwidrigen Verhaltens begründet, steht indessen zur Überzeugung des Gerichts die Pflichtwidrigkeit tatsächlich fest, lässt dies die materiell-rechtliche Wirksamkeit der Kündigung unberührt. Maßgebend ist allein der objektive Sachverhalt, wie er sich dem Gericht nach Parteivorbringen und ggf. Beweisaufnahme darstellt. Ergibt sich daraus nach tatrichterlicher Würdigung das Vorliegen einer Pflichtwidrigkeit, ist das Gericht nicht gehindert, dies seiner Entscheidung zugrunde zu legen. Es ist nicht erforderlich, dass der Arbeitgeber sich während des Prozesses darauf berufen hat, er stütze die Kündigung auch auf die erwiesene Tat (BAG 27. Januar 2011 - 2 AZR 825/09 - Rn. 26, BAGE 137, 54; 10. Juni 2010 - 2 AZR 541/09 - Rn. 23, BAGE 134, 349).
bb) Das Landesarbeitsgericht hat sich insoweit ersichtlich weder eine positive noch eine negative Überzeugung gebildet, weil es schon den Verdacht auf eine Zueignungsabsicht der Klägerin als Grund für die ordentliche Kündigung hat ausreichen lassen. Die Beklagte darf nach Aufhebung des für sie günstigen Berufungsurteils nicht um die prozessuale Chance gebracht werden, dass das Landesarbeitsgericht auf der Basis der Rechtsauffassung des Senats die mög-
- 17 -
liche Erwiesenheit einer Pflichtwidrigkeit der Klägerin geprüft und dabei eine für sie - die Beklagte - günstige Überzeugung gewonnen hätte.
c) Der Umstand, dass der Betriebsrat von der Beklagten nur zu einer beabsichtigten Verdachtskündigung gehört wurde, steht einer Wirksamkeit der Kündigung wegen eines nachgewiesenen Pflichtenverstoßes nicht notwendig entgegen. Die gerichtliche Berücksichtigung des fraglichen Geschehens als erwiesene Tat setzt allerdings voraus, dass dem Betriebsrat am 8. September 2009 sämtliche Umstände mitgeteilt worden sind, welche nicht nur den Tatverdacht, sondern zur - möglichen - Überzeugung des Landesarbeitsgerichts auch den Tatvorwurf begründen (vgl. BAG 10. Juni 2010 - 2 AZR 541/09 - Rn. 24, BAGE 134, 349; 23. Juni 2009 - 2 AZR 474/07 - Rn. 59 mwN, BAGE 131, 155). In diesem Fall wäre dem Normzweck des § 102 BetrVG auch durch eine Anhörung nur zur Verdachtskündigung genüge getan. Dem Betriebsrat würde dadurch nichts vorenthalten. Die Mitteilung des Arbeitgebers, einem Arbeitnehmer solle schon und allein wegen des Verdachts einer pflichtwidrigen Handlung gekündigt werden, gibt dem Betriebsrat sogar weit stärkeren Anlass für ein umfassendes Tätigwerden als eine Anhörung wegen einer als erwiesen behaupteten Tat (BAG 10. Juni 2010 - 2 AZR 541/09 - Rn. 24, aaO; 3. April 1986 - 2 AZR 324/85 - zu II 1 c cc der Gründe; KR/Fischermeier 10. Aufl. § 626 BGB Rn. 217).
d) Bei der Prüfung, ob die ordentliche Kündigung vom 11. September 2009 wegen erwiesener Pflichtwidrigkeiten der Klägerin sozial gerechtfertigt ist, darf das Landesarbeitsgericht seine Überzeugung nicht auf den Inhalt der in Augenschein genommenen Videoaufzeichnungen stützen. Deren Verwertung ist prozessual unzulässig. Ob dies unmittelbar aus § 6b BDSG oder doch § 32 BDSG folgt, kann im Ergebnis offen bleiben. Ein Verwertungsverbot ergibt sich in jedem Fall aus einer Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts der Klägerin aus Art. 2 Abs. 1 iVm. Art. 1 Abs. 1 GG, die nicht durch überwiegende Beweisinteressen der Beklagten gerechtfertigt ist.
aa) Allerdings kennt die Zivilprozessordnung selbst für rechtswidrig erlangte Informationen oder Beweismittel kein - ausdrückliches - prozessuales Verwen-
- 18 -
dungs- bzw. Beweisverwertungsverbot. Aus § 286 ZPO iVm. Art. 103 Abs. 1 GG folgt vielmehr die grundsätzliche Verpflichtung der Gerichte, den von den Parteien vorgetragenen Sachverhalt und die von ihnen angebotenen Beweise zu berücksichtigen (BVerfG 9. Oktober 2002 - 1 BvR 1611/96 ua. - Rn. 60, BVerfGE 106, 28; BAG 16. Dezember 2010 - 2 AZR 485/08 - Rn. 30 mwN). Dementsprechend bedarf es für die Annahme eines Beweisverwertungsverbots, das zugleich die Erhebung der angebotenen Beweise hindert, einer besonderen Legitimation und gesetzlichen Grundlage (vgl. BAG 13. Dezember 2007 - 2 AZR 537/06 - Rn. 37; Musielak/Foerste ZPO 10. Aufl. § 284 Rn. 23; MüKoZPO/Prütting 4. Aufl. § 284 Rn. 64).
bb) Im gerichtlichen Verfahren tritt der Richter den Verfahrensbeteiligten in Ausübung staatlicher Hoheitsgewalt gegenüber. Er ist daher nach Art. 1 Abs. 3 GG bei der Urteilsfindung an die insoweit maßgeblichen Grundrechte gebunden und zu einer rechtsstaatlichen Verfahrensgestaltung verpflichtet (BVerfG 13. Februar 2007 - 1 BvR 421/05 - Rn. 93 mwN, BVerfGE 117, 202). Dabei können sich auch aus materiellen Grundrechten wie Art. 2 Abs. 1 GG Anforderungen an das gerichtliche Verfahren ergeben, wenn es um die Offenbarung und Verwertung von persönlichen Daten geht, die grundrechtlich vor der Kenntnis durch Dritte geschützt sind. Das Gericht hat deshalb zu prüfen, ob die Verwertung von heimlich beschafften persönlichen Daten und Erkenntnissen, die sich aus diesen Daten ergeben, mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Betroffenen vereinbar ist (BVerfG 13. Februar 2007 - 1 BvR 421/05 - aaO; BGH 15. Mai 2013 - XII ZB 107/08 - Rn. 21). Dieses Recht schützt nicht allein die Privat- und Intimsphäre, sondern schützt in seiner speziellen Ausprägung als Recht am eigenen Bild auch die Befugnis eines Menschen, selbst darüber zu entscheiden, ob Filmaufnahmen von ihm gemacht und möglicherweise gegen ihn verwendet werden dürfen (BAG 26. August 2008 - 1 ABR 16/07 - Rn. 15, BAGE 127, 276). Auch wenn keine spezielle Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts betroffen ist, greift die Verwertung von personenbezogenen Daten in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung ein, das die Befugnis garantiert, selbst über die Preisgabe und Verwendung persönlicher Daten zu befinden (BVerfG 11. März 2008 - 1 BvR 2074/05
- 19 -
ua. - BVerfGE 120, 378). Der Achtung dieses Rechts dient zudem Art. 8 Abs. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) (BGH 15. Mai 2013 - XII ZB 107/08 - Rn. 14).
cc) Die Bestimmungen des BDSG über die Anforderungen an eine zulässige Datenverarbeitung konkretisieren und aktualisieren den Schutz des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und am eigenen Bild. Sie regeln, in welchem Umfang im Anwendungsbereich des Gesetzes Eingriffe in diese Rechtspositionen zulässig sind (für das DSG NRW vgl. BAG 15. November 2012 - 6 AZR 339/11 - Rn. 16). Dies stellt § 1 BDSG ausdrücklich klar. Liegt keine Einwilligung des Betroffenen vor, ist die Datenverarbeitung nach dem Gesamtkonzept des BDSG nur zulässig, wenn eine verfassungsgemäße Rechtsvorschrift sie erlaubt. Fehlt es an der erforderlichen Ermächtigungsgrundlage oder liegen deren Voraussetzungen nicht vor, ist die Erhebung, Verarbeitung und/oder Nutzung personenbezogener Daten verboten. Dieser Grundsatz des § 4 Abs. 1 BDSG prägt das deutsche Datenschutzrecht (Gola/Schomerus BDSG 11. Aufl. § 4 Rn. 3; ErfK/Franzen 13. Aufl. § 4 BDSG Rn. 1; Simitis/Sokol BDSG 7. Aufl. § 4 Rn. 1).
(1) In diesem Sinne regelt § 6b BDSG die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elektronischen Einrichtungen. Die Bestimmung gilt ua. für Videoaufzeichnungen in öffentlich zugänglichen Verkaufsräumen (BT-Drucks. 14/4329, S. 38). Unerheblich ist, ob das Ziel der Beobachtung die Allgemeinheit ist oder die dort beschäftigten Arbeitnehmer sind (vgl. BAG 21. Juni 2012 - 2 AZR 153/11 - Rn. 36). Nach § 6b Abs. 1 Nr. 3 BDSG ist die Überwachung nur zulässig, wenn und soweit sie zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte Zwecke erforderlich ist und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwiegen.
(2) Gemäß dem zum 1. September 2009 in Kraft getretenen § 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG dürfen personenbezogene Daten eines Beschäftigten für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn dies für die Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses oder nach dessen Begründung für seine Durchführung oder Beendi-
- 20 -
gung erforderlich ist. Nach Abs. 1 Satz 2 der Regelung dürfen zur Aufdeckung von Straftaten personenbezogene Daten eines Beschäftigten nur dann erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn zu dokumentierende tatsächliche Anhaltspunkte den Verdacht begründen, dass der Betroffene im Beschäftigungsverhältnis eine Straftat begangen hat, die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung zu deren Aufdeckung erforderlich ist und das schutzwürdige Interesse des Beschäftigten am Ausschluss der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung nicht überwiegt, insbesondere Art und Ausmaß im Hinblick auf den Anlass nicht unverhältnismäßig sind.
dd) Im Streitfall bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass die Kassen des Getränkemarkts vom übrigen Verkaufsraum abgegrenzt waren und die verdeckte Videoüberwachung deshalb keinen „öffentlichen Raum“ iSd. § 6b BDSG betraf (zur Problematik Simitis/Scholz BDSG 7. Aufl. § 6b Rn. 51; Bayreuther NZA 2005, 1038). Im Ergebnis kommt es darauf nicht an. Ebenso kann offen bleiben, ob § 32 BDSG auf Überwachungen Anwendung findet, die vor seinem Inkrafttreten bereits beendet waren, und wie der Anwendungsbereich dieser Vorschrift zu dem des § 6b BDSG abzugrenzen ist (dazu ErfK/Franzen 13. Aufl. § 6b BDSG Rn. 2; Simitis/Scholz aaO; Bayreuther DB 2012, 2222). Schließlich kann dahinstehen, ob Videoaufzeichnungen, die nicht von den Erlaubnistatbeständen des BDSG gedeckt sind, ohne Weiteres einem prozessualen Beweis-verwertungsverbot unterliegen oder ob es für ein solches Verbot einer weitergehenden Abwägung der betroffenen Grundrechte bedarf, in die freilich die im Bundesdatenschutzgesetz getroffene Interessenabwägung einzubeziehen wäre (dazu Bayreuther DB 2012, 2222, 2225; Grimm/Schiefer RdA 2009, 329, 349; Lunk NZA 2009, 457; Thüsing Anm. zu BAG 21. Juni 2012 - 2 AZR 153/11 - EzA BGB 2002 § 611 Persönlichkeitsrecht Nr. 13). Die Verwertung des verdeckt gewonnenen Videomaterials allein für den Beweis der Richtigkeit der Behauptung der Beklagten, die Klägerin habe sich bei der - als solcher unstreitigen - Entnahme von „Klüngelgeld“ „versichernd umgeschaut“, ist unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt zulässig.
- 21 -
(1) Greift die prozessuale Verwertung eines Beweismittels in das allgemeine Persönlichkeitsrecht einer Prozesspartei ein, überwiegt das Interesse an der Verwertung der Videoaufnahmen und der Funktionstüchtigkeit der Rechtspflege das Interesse am Schutz dieses Grundrechts nur dann, wenn weitere, über das schlichte Beweisinteresse hinausgehende Aspekte hinzutreten. Das Interesse, sich ein Beweismittel zu sichern, reicht für sich allein nicht aus (BVerfG 13. Februar 2007 - 1 BvR 421/05 - BVerfGE 117, 202). Vielmehr muss sich gerade diese Art der Informationsbeschaffung und Beweiserhebung als gerechtfertigt erweisen (BVerfG 9. Oktober 2002 - 1 BvR 1611/96, 1 BvR 805/98 - zu C II 4 a der Gründe, BVerfGE 106, 28; BAG 21. Juni 2012 - 2 AZR 153/11 - Rn. 29; 13. Dezember 2007 - 2 AZR 537/06 - Rn. 36 mwN).
(2) Dementsprechend sind Eingriffe in das Recht des Arbeitnehmers am eigenen Bild durch heimliche Videoüberwachung und die Verwertung entsprechender Aufzeichnungen dann zulässig, wenn der konkrete Verdacht einer strafbaren Handlung oder einer anderen schweren Verfehlung zu Lasten des Arbeitgebers besteht, weniger einschneidende Mittel zur Aufklärung des Verdachts ergebnislos ausgeschöpft sind, die verdeckte Videoüberwachung damit das praktisch einzig verbleibende Mittel darstellt und sie insgesamt nicht unverhältnismäßig ist (grundlegend BAG 27. März 2003 - 2 AZR 51/02 - zu B I 3 b cc der Gründe, BAGE 105, 356; 21. Juni 2012 - 2 AZR 153/11 - Rn. 30 - beide Male vor Inkrafttreten des § 32 BDSG). Der Verdacht muss sich in Bezug auf eine konkrete strafbare Handlung oder andere schwere Verfehlung zu Lasten des Arbeitgebers gegen einen zumindest räumlich und funktional abgrenzbaren Kreis von Arbeitnehmern richten. Er darf sich einerseits nicht auf die allgemeine Mutmaßung beschränken, es könnten Straftaten begangen werden. Er muss sich andererseits nicht notwendig nur gegen einen einzelnen, bestimmten Arbeitnehmer richten. Auch im Hinblick auf die Möglichkeit einer weiteren Einschränkung des Kreises der Verdächtigen müssen weniger einschneidende Mittel als eine verdeckte Videoüberwachung zuvor ausgeschöpft worden sein (BAG 21. Juni 2012 - 2 AZR 153/11 - aaO; 27. März 2003 - 2 AZR 51/02 - zu B I 3 b dd (1) der Gründe, aaO).
- 22 -
(3) Das in § 6b Abs. 2 BDSG normierte Kennzeichnungsgebot steht einer Verwertung von Daten, die aus einer verdeckten Videoüberwachung gewonnen wurden, nicht zwingend entgegen (BAG 21. Juni 2012 - 2 AZR 153/11 - Rn. 41; Bauer/Schansker NJW 2012, 3537; Thüsing Anm. zu BAG 21. Juni 2012 - 2 AZR 153/11 - EzA BGB 2002 § 611 Persönlichkeitsrecht Nr. 13; wohl auch Bayreuther DB 2012, 2222 ff.). Das gegenteilige Normverständnis, das zu einem absoluten, nur durch bereichsspezifische Spezialregelungen (etwa durch § 100c, § 100h StPO) eingeschränkten Verbot verdeckter Videoaufzeichnungen in öffentlich zugänglichen Räumen führte, begegnete mit Blick auf die durch Art. 12 Abs. 1, Art. 14 Abs. 1 GG geschützten Integritätsinteressen des Arbeitgebers verfassungsrechtlichen Bedenken.
(4) Die Regelung des § 32 BDSG baut auf den von der Rechtsprechung entwickelten allgemeinen Grundsätzen auf. Nach der Gesetzesbegründung sollte sie diese nicht ändern, sondern lediglich zusammenfassen (vgl. BT-Drucks. 16/13657, S. 21). Dementsprechend setzt § 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG voraus, dass die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten zur Aufdeckung einer Straftat erforderlich ist, und verlangt insoweit eine am Verhältnismäßigkeitsprinzip orientierte, die Interessen des Arbeitgebers und des Beschäftigten abwägende Einzelfallentscheidung. Diese muss zumindest den schon bisher geltenden Voraussetzungen für die Zulässigkeit einer heimlichen Videoüberwachung entsprechen (Thüsing Anm. zu BAG 21. Juni 2012 - 2 AZR 153/11 - EzA BGB 2002 § 611 Persönlichkeitsrecht Nr. 13; Wybitul BB 2010, 2235).
(5) Es kann dahinstehen, ob § 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG weitergehend verlangt, dass sich der Verdacht auf ein strafbares Verhalten richtet und deshalb auch der Verdacht auf schwere Pflichtverletzungen, ohne dass zugleich ihre Strafbarkeit feststünde, die Beobachtung nicht rechtfertigen könnte. Ebenso kann offenbleiben, ob die Regelung zusätzliche Anforderungen an die personelle Konkretisierung des Verdachts sowie dessen Dokumentation stellt (zweifelnd Bauer/Schansker NJW 2012, 3537, 3539; Thüsing Anm. zu BAG 21. Juni 2012 - 2 AZR 153/11 - EzA BGB 2002 § 611 Persönlichkeitsrecht Nr. 13). Hier
- 23 -
fehlt es schon an der Erfüllung der bisher geltenden Anforderungen an die Zulässigkeit einer verdeckten Videoüberwachung und der Verwertung des daraus gewonnenen Materials. Damit liegt auch ein gesetzlicher Erlaubnistatbestand nicht vor.
(a) Die im Berufungsurteil getroffenen Feststellungen rechtfertigen nicht die Annahme, für die verdeckte Beobachtung des Kassenbereichs habe ein hinreichender Anlass bestanden. Zwar ist - mangels zulässiger Verfahrensrügen der Revision - davon auszugehen, dass im ersten Halbjahr 2009 im Getränkemarkt Leergutdifferenzen iHv. insgesamt 7.081,63 Euro zu verzeichnen waren. Es ist weder dargetan noch festgestellt, durch welche konkreten Maßnahmen die Beklagte ausgeschlossen haben will, dass Leergut nicht etwa aus dem Lager entwendet worden ist. Ihr Vorbringen, sie habe „keine Fehlbestände an Leergut im Lager und im Kassenbereich festgestellt“ bleibt im Allgemeinen haften. Es lässt nicht erkennen, dass sie stichprobenartige Kontrollen ausreichend oft durchgeführt hätte. Überdies macht ihr Vortrag nicht deutlich, ob vergleichbare Fehlbestände schon früher aufgetreten, ob diese ggf. als „auflaufender Posten“ in die Berechnungen des Jahres 2009 eingeflossen sind und wie Fehlbuchungen als mögliche Ursache ausgeschlossen wurden. Selbst wenn die Beklagte die Ursache der Leergutdifferenzen berechtigterweise im Kassenbereich hätte vermuten dürfen, fehlt es an Vortrag und Feststellungen dazu, weshalb die Videoüberwachung das praktisch einzig verbliebene Mittel gewesen sein soll, die Unregelmäßigkeiten aufzuklären oder doch den Verdacht in personeller Hinsicht weiter einzugrenzen. So ist nicht erkennbar, weshalb nicht stichprobenartige Überprüfungen der Menge des an der - einzigen - Leergutkasse abgegebenen Pfandguts und der jeweiligen Kassenabschlüsse zusammen mit Kontrollen der Mitarbeiter beim Verlassen des Arbeitsplatzes geeignete Maßnahmen hätten sein können.
- 24 -
(b) Die Würdigung des Landesarbeitsgerichts berücksichtigt im Übrigen nicht ausreichend, dass der fragliche Kündigungssachverhalt der Beklagten nur „zufällig“ bekannt geworden ist. Auf seine Entdeckung war die heimliche Videoüberwachung nicht gerichtet.
(aa) Zwar mögen solche „Zufallsfunde“ - unbeschadet der Regelung in § 6b Abs. 3 BDSG - nicht in jedem Fall deshalb unverwertbar sein, weil sie außerhalb des Beobachtungszwecks liegen (vgl. Grimm/Schiefer RdA 2009, 329, 340; aA wohl Bergwitz NZA 2012, 353, 358). Auch bezogen auf „Zufallserkenntnisse“ muss aber das Beweisinteresse des Arbeitgebers höher zu gewichten sein als das Interesse des Arbeitnehmers an der Achtung seines allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Das ist nur anzunehmen, wenn das mittels Videodokumentation zu beweisende Verhalten eine wenn nicht strafbare, so doch schwerwiegende Pflichtverletzung zum Gegenstand hat und die verdeckte Videoüberwachung nicht selbst dann noch unverhältnismäßig ist. Erreicht das in Rede stehende Verhalten diesen Erheblichkeitsgrad nicht, muss die Verwertung des Videomaterials unterbleiben.
(bb) So liegt es hier. Zwischen den Parteien ist die Existenz der „Klüngelgeld-Kasse“ ebenso unstreitig wie der Umstand, dass die Klägerin daraus gelegentlich kleinere Geldstücke entnommen hat. Die Beweisaufnahme durch Au-genschein sollte allein dem Nachweis dienen, dass sich die Klägerin bei der Geldentnahme „versichernd umgesehen“ hat und deshalb vermutlich Zueignungsabsicht besaß. Das rechtfertigt keine Verwertung der heimlichen Videoaufzeichnungen. Zum einen hat die Beklagte nicht dargelegt, dass die Verwertung erforderlich war, um die Einlassung der Klägerin zum Fehlen ihrer Zueignungsabsicht zu widerlegen. Zum anderen ist die heimliche Videoüberwachung zum Nachweis der Absicht, sich einige Münzen im Wert von Centbeträgen zuzueignen, schlechthin unverhältnismäßig.
- 25 -
(cc) Es erscheint nicht von vorneherein ausgeschlossen, dass das Landesarbeitsgericht im Rahmen einer nochmaligen Beweiswürdigung auch ohne Berücksichtigung des Inhalts der Videoaufzeichnungen zu dem Ergebnis gelangt, die Klägerin habe das fragliche Geld aus der „Klüngelgeld-Kasse“ entnommen, um es für sich zu behalten. Die Beklagte hat in diesem Zusammenhang unter Antritt von Zeugenbeweis vorgetragen, für das Auslösen eines Einkaufswagens mit Hilfe von „Klüngelgeld“ habe keinerlei dienstliches Bedürfnis bestanden. Zum Zweck des Transports der Kasseneinsätze sei stets ein frei zugänglicher Wagen bereitgestellt worden.
III. Der Aufhebung und Zurückverweisung unterliegt die Entscheidung des Landesarbeitsgerichts auch hinsichtlich der Zahlungsansprüche, die von der Unwirksamkeit der ordentlichen Kündigung abhängen. Wegen der der Klägerin für die Zeit bis zum 31. März 2010 zugesprochenen Vergütungsansprüche hat die Entscheidung dagegen Bestand. Die gegen sie gerichtete Anschlussrevision der Beklagten bleibt auch insoweit ohne Erfolg.
1. Das Arbeitsverhältnis der Parteien hat zumindest bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist fortbestanden. Der für diese Zeit geltend gemachte Vergütungsanspruch folgt aus § 615 Satz 1 BGB, § 13 Abs. 1 Satz 5 KSchG iVm. § 11 Nr. 3 KSchG. Er ist der Höhe nach ebenso unstreitig wie die Verpflichtung der Beklagten zur Erteilung des begehrten Warengutscheins.
2. Der entsprechende Zinsanspruch folgt aus § 288 Abs. 1 BGB iVm. § 286 Abs. 2 Nr. 1, § 291 BGB. Sowohl der betreffende Antrag der Klägerin als auch der Tenor des Berufungsurteils sind dahin auszulegen, dass - im Hinblick auf den gesetzlichen Anspruchsübergang - Zinsen nur aus den jeweiligen Bruttobeträgen abzüglich des für den jeweiligen Monat in Anrechnung gebrachten Arbeitslosengelds verlangt bzw. geschuldet sind.
- 26 -
IV. Die Zurückverweisung erfasst ferner die Anträge auf vorläufige Weiterbeschäftigung und auf Erteilung eines Zwischenzeugnisses. Beide Anträge verfolgt die Klägerin nur für den Fall des Obsiegens mit ihrem Feststellungsbegehren.
Kreft
Rinck
Berger
B. Schipp
Söller
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gern:
 |
Dr. Martin Hensche Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hensche@hensche.de |
 |
Christoph Hildebrandt Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hildebrandt@hensche.de |
 |
Nina Wesemann Rechtsanwältin Fachanwältin für Arbeitsrecht Kontakt: 040 / 69 20 68 04 wesemann@hensche.de |