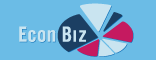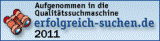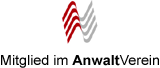- -> zur Mobil-Ansicht
- Arbeitsrecht aktuell
- Tipps und Tricks
- Handbuch Arbeitsrecht
- Gesetze zum Arbeitsrecht
- Urteile zum Arbeitsrecht
- Urteile 2023
- Urteile 2021
- Urteile 2020
- Urteile 2019
- Urteile 2018
- Urteile 2017
- Urteile 2016
- Urteile 2015
- Urteile 2014
- Urteile 2013
- Urteile 2012
- Urteile 2011
- Urteile 2010
- Urteile 2009
- Urteile 2008
- Urteile 2007
- Urteile 2006
- Urteile 2005
- Urteile 2004
- Urteile 2003
- Urteile 2002
- Urteile 2001
- Urteile 2000
- Urteile 1999
- Urteile 1998
- Urteile 1997
- Urteile 1996
- Urteile 1995
- Urteile 1994
- Urteile 1993
- Urteile 1992
- Urteile 1991
- Urteile bis 1990
- Arbeitsrecht Muster
- Videos
- Impressum-Generator
- Webinare zum Arbeitsrecht
-
Kanzlei Berlin
 030 - 26 39 62 0
030 - 26 39 62 0
 berlin@hensche.de
berlin@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Frankfurt
 069 - 71 03 30 04
069 - 71 03 30 04
 frankfurt@hensche.de
frankfurt@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hamburg
 040 - 69 20 68 04
040 - 69 20 68 04
 hamburg@hensche.de
hamburg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hannover
 0511 - 89 97 701
0511 - 89 97 701
 hannover@hensche.de
hannover@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Köln
 0221 - 70 90 718
0221 - 70 90 718
 koeln@hensche.de
koeln@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei München
 089 - 21 56 88 63
089 - 21 56 88 63
 muenchen@hensche.de
muenchen@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Nürnberg
 0911 - 95 33 207
0911 - 95 33 207
 nuernberg@hensche.de
nuernberg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Stuttgart
 0711 - 47 09 710
0711 - 47 09 710
 stuttgart@hensche.de
stuttgart@hensche.de
AnfahrtDetails
BAG, Urteil vom 25.10.2007, 8 AZR 593/06
| Schlagworte: | Mobbing | |
| Gericht: | Bundesarbeitsgericht | |
| Aktenzeichen: | 8 AZR 593/06 | |
| Typ: | Urteil | |
| Entscheidungsdatum: | 25.10.2007 | |
| Leitsätze: | Der Arbeitgeber haftet nach § 278 BGB für Schäden, die einer seiner Arbeitnehmer dadurch erleidet, dass ihn sein Vorgesetzter schuldhaft in seinen Rechten verletzt. | |
| Vorinstanzen: | Arbeitsgericht Dortmund, Urteil vom 22.12.2004, 8 (4) Ca 5534/04 Landesarbeitsgericht Hamm, Urteil vom 06.03.2006, 16 Sa 76/05 |
|
BUNDESARBEITSGERICHT
8 AZR 593/06
16 Sa 76/05
Landesarbeitsgericht Hamm
Im Namen des Volkes!
Verkündet am
25. Oktober 2007
URTEIL
Diederich, Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
Das Urteil des Senats wurde
durch Beschluss vom 23. Januar
2008 berichtigt.
Erfurt, 23. Januar 2008
Krebstekies, RAF
In Sachen
Kläger, Berufungskläger und Revisionskläger,
pp.
Beklagte, Berufungsbeklagte und Revisionsbeklagte,
hat der Achte Senat des Bundesarbeitsgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 25. Oktober 2007 durch den Vorsitzenden Richter am Bundesarbeitsgericht Hauck, die Richter am Bundesarbeitsgericht Böck und Breinlinger sowie die ehrenamtlichen Richter Bähringer und Henniger für Recht erkannt:
Auf die Revision des Klägers wird das Urteil des Landesarbeitsgerichts Hamm vom 6. März 2006 - 16 Sa 76/05 - aufgehoben.
- 2 -
Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten der Revision - an das Landesarbeitsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen!
Tatbestand
Der Kläger verlangt von der Beklagten die Beendigung des Arbeitsverhältnisses seines vorgesetzten Chefarztes und die Zahlung von Schmerzensgeld. Hilfsweise begehrt er das Angebot eines vergleichbaren Arbeitsplatzes, an dem er gegenüber seinem jetzigen Vorgesetzten nicht mehr weisungsgebunden ist.
Der Kläger ist seit dem 15. August 1987 in dem von der Beklagten betriebenen Krankenhaus als Arzt in der Neurochirurgischen Abteilung (jetzt: Neurochirurgische Klinik) beschäftigt. Diesem Arbeitsverhältnis liegt ein schriftlicher Dienstvertrag vom 28. Juli 1987 zugrunde. In § 2 dieses Vertrages heißt es - soweit hier von Interesse -:
„Für das Dienstverhältnis gelten die „Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrichtungen des Deutschen Caritasverbandes“ (AVR) in der jeweils geltenden Fassung.“
§ 23 der AVR lautet:
„1. Ansprüche aus dem Dienstverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit vom Mitarbeiter oder vom Dienstgeber schriftlich geltend gemacht werden, soweit die AVR nichts anderes bestimmen.
2. Für denselben Sachverhalt reicht die einmalige Geltendmachung des Anspruches aus, um die Ausschlussfrist auch für später fällig werdende Leistungen unwirksam zu machen.“
Ab 1. Dezember 1990 wurde der Kläger zum Oberarzt und ab dem 1. Juli 1992 zum Ersten Oberarzt der Neurochirurgischen Klinik ernannt. Nach dem Ausscheiden des Chefarztes Dr. T Anfang 2001 wurde ihm die kommissarische Leitung der Neurochirurgischen Klinik übertragen. Die Bewerbung des Klägers um die Chef-
- 3 -
arztstelle blieb erfolglos. Diese wurde ab dem 1. Oktober 2001 dem externen Bewerber Dr. H übertragen.
Der Kläger war seit 13. November 2003 wegen einer psychischen Erkrankung arbeitsunfähig. Er nahm, nachdem er noch Urlaub eingebracht hatte, am 19. Juli 2004 seine Arbeit wieder auf. Während seiner Arbeitsunfähigkeit hatte er sich bis 11. Februar 2004 in stationärer, danach in ambulanter Behandlung befunden. Vom 7. Mai bis 19. Mai 2004 hatte der Kläger einen Wiedereingliederungsversuch unternommen, der jedoch erfolglos abgebrochen wurde. Seit Oktober 2004 ist der Kläger fortlaufend arbeitsunfähig erkrankt.
Seit Mai 2002 fühlt sich der Kläger „gemobbt“. Nachdem er im März 2003 erste Vorwürfe gegen den Chefarzt Dr. H erhoben hatte, führte der Verwaltungsdirektor der Beklagten eine Reihe von Gesprächen mit den beiden betroffenen Ärzten sowie mit anderen Ärzten und Mitarbeitern der Neurochirurgischen Klinik. Im Sommer 2003 schaltete der Kläger einen Rechtsanwalt ein. Der Versuch, im Juni 2003 im Rahmen eines Konfliktlösungsverfahrens unter Leitung eines externen Vermittlers die Auseinandersetzung zu schlichten, schlug fehl, da Dr. H ein solches Verfahren nicht für zielführend hielt. Am 1. April und 23. April 2004 fanden so genannte Konfliktvermittlungskonferenzen unter Leitung des Vermittlers statt, an denen neben dem Kläger und Dr. H auch der ärztliche Direktor der Beklagten teilnahm. Die Beklagte hatte Dr. H angewiesen, an diesem Konfliktvermittlungsverfahren mitzuwirken. Auch dieses Verfahren wurde ergebnislos abgebrochen.
Der Kläger stützt seine Mobbingvorwürfe im Wesentlichen auf folgende, im Einzelnen streitige Vorfälle:
Er behauptet, er habe kurzfristig seinen für die Zeit vom 9. August bis 30. August 2002 angemeldeten Urlaub ändern und daher die gebuchte Pauschalreise umbuchen müssen, da Dr. H dies verlangt habe, weil er selbst bis zum 10. August 2002 in Urlaub sei. Das Gleiche sei in den Herbstferien geschehen, in denen er seinen im Einverständnis mit Dr. H angemeldeten Urlaub zum 18. Oktober 2002 habe abbrechen müssen, weil dieser dies mit der Erklärung verlangt habe, dass ihm als Chefarzt der Vorrang gebühre und er ab dem 19. Oktober 2002 in Urlaub sei. Dr. H habe sich dann allerdings seit dem 20. Oktober 2002 wieder im Dienst befunden.
Zum Jahreswechsel 2001/2002 habe es eine umfangreiche Diskussion über die Verwendung verschiedener Implantate bei Wirbelsäulenoperationen gegeben. Dabei sei sein gut vorbereiteter und sorgfältig dargelegter Vorschlag durch Dr. H in
- 4 -
Gegenwart Dritter ohne das geringste Interesse zur Kenntnis genommen und „abgebügelt“ worden.
Mit Schreiben vom 27. Februar 2003 habe ihm der Chefarzt eine inhaltlich unzutreffende Abmahnung erteilt. Richtig sei allerdings, dass er von der in Frage stehenden Patientin gesagt habe, diese sei „zu panne“.
Am 4. Juni 2003 sei er von Dr. H auf dem Flur vor den Aufzügen in Gegenwart von vier Kollegen herablassend und aggressiv darauf angesprochen worden, dass bei einer von ihm überwachten Hirntumoroperation vier Bohrlöcher anstelle von maximal zwei gesetzt worden seien. Dabei habe Dr. H geäußert, dass, falls der Kläger dies nicht könne, er es ihm demnächst bei einer Operation zeigen werde.
Am selben Tage sei, als der Chefarzt Dr. H nicht mehr anwesend gewesen sei, ein angekündigter Patient von der Oberärztin Dr. S auf ausdrückliche Anweisung des Dr. H empfangen worden. Hiervon sei er nicht unterrichtet worden, obwohl beim Mittagessen von diesem Vorgang die Rede gewesen sei.
Im Vieraugengespräch habe Dr. H wiederholt und ernsthaft ihm gegenüber den Vorwurf erhoben, dass er den vormaligen Chefarzt Dr. T hintergangen und dessen Rauswurf veranlasst habe.
Im Rahmen einer Diskussion um fachübergreifende Bereitschaftsdienste seien ihm vor versammelter Mannschaft von Dr. H unlautere Motive unterstellt worden. Dr. H habe geäußert, der Kläger, würde nur so argumentieren, „um seinen Arsch im Bett lassen zu können“, des Weiteren, „um seine Pfründe zu sichern“.
In einem Konfliktgespräch am 24. Juni 2003 habe Dr. H erklärt, er habe sich nach seiner Berufung zum Chefarzt bei den niedergelassenen Fachkollegen vorgestellt. Diese hätten sich negativ über den Kläger geäußert und seine ärztlichen Fähigkeiten in Zweifel gezogen.
Mit Schreiben vom 26. September 2003 habe Dr. H ihm zu Unrecht vorgeworfen, sich selbst Urlaub gewährt und hierdurch einen personellen Engpass verursacht zu haben.
Am 29. September 2003 habe Dr. H ihn beschuldigt, die Behandlung einer Patientin während seiner Urlaubsabwesenheit eigenmächtig und entgegen seinen Weisungen vorgenommen zu haben. Sein (sc. des Klägers) Verhalten sei eine Unverschämtheit. Tatsächlich habe die Rücksprache mit der Sekretärin jedoch ergeben,
- 5 -
dass die Patientenbehandlung in jeder Weise den abgesprochenen Therapiemaßnahmen entsprochen habe.
Im Oktober 2003 sei er sowie ein weiterer Oberarzt von Dr. H gefragt worden, ob sie bereit seien, in einem Zimmer zusammenzuarbeiten. Im Hinblick auf die Notwendigkeit, ambulante Patienten in ihren Zimmern zu untersuchen, hätten sie beide jedoch erklärt, dass dies nicht möglich sei. Trotzdem sei einige Tage später ein Schreibtisch für den anderen Oberarzt in sein Zimmer gestellt worden.
Am 4./5. November 2003 habe er eine von einem Assistenzarzt durchgeführte Operation fortführen müssen. Entgegen der bisher praktizierten sitzenden Lagerung sei in Bauchlagerung operiert worden. Als er, der Kläger, in der Frühbesprechung am Folgetag auf die medizinisch-rechtliche Problematik einer Operation in einer Lagerung, über die zuvor nicht aufgeklärt worden sei, hingewiesen habe, sei er von Dr. H mit den Worten: „Ich bin hier Operateur und Sie sind mein Handlanger. Sie haben zu tun, was ich Ihnen sage!“ angeschrien worden.
Während seiner Arbeitsunfähigkeit bis zum 6. Mai 2004 sei das Schreiben eines Rechtsanwalts eingegangen, der nach dem Tod eines durch ihn, den Kläger, operierten Patienten Schadensersatzansprüche geltend gemacht habe. Hierüber sei er, weder durch das Krankenhaus noch durch Herrn Dr. H informiert worden. Dieser habe vielmehr dem Rechtsanwalt schriftlich mitgeteilt, dass die angeforderten Operationsberichte nicht existierten und „der Oberarzt Dr. B“ diese Berichte nicht umgehend nach dem Eingriff, wie meistens üblich, verfasst habe, sondern diese wohl zu einem späteren Termin habe abfassen wollen, dann jedoch seit dem 7. November 2003 arbeitsunfähig erkrankt sei. Er selbst, der Kläger, habe erst am 27. April 2004 durch ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft erfahren, dass der Patient verstorben sei und ihm die Schuld angelastet werde.
Während des Wiedereingliederungsversuchs habe er am 7. Mai 2004 angefragt, ob sein Dienst vom 20. Mai 2004 auf einen anderen Termin verlegt werden könne, da er an diesem Tag an einer geplanten Familienfeier teilnehmen wolle. Obwohl er den Tausch für zwei andere Dienste angeboten habe, habe Herr Dr. H geäußert, dass das nicht gehe, da es ein Feiertag sei.
Am Vormittag des 10. Mai 2004 habe die Sekretärin des Chefarztes versucht, ihn in dessen Auftrag aus seinem Arbeitszimmer zu verweisen, da eine Teilzeitkraft für drei Stunden ein Arbeitszimmer mit eigenem Computer brauche, um ihre Arbeit zu erledigen.
- 6 -
Als er am selben Tage zwei Kollegen auf einer Visite habe begleiten wollen, sei er auf der Station von Dr. H angefahren worden, was er auf der Visite zu tun habe, er habe klare Anweisungen gegeben, dass OP-Berichte zu diktieren seien.
An diesem Tage habe dann um 15.00 Uhr eine Dienstbesprechung stattgefunden, die ursprünglich für 15.45 Uhr angesetzt gewesen sei. Wohl auf Weisung des Chefarztes sei er, der Kläger, zuvor von der Terminsänderung nicht informiert worden.
Nachdem er am 19. Juli 2004 im Anschluss an seine Arbeitsunfähigkeit und seinen Urlaub den Dienst aufgenommen habe und ihm der Dienstplan ausgehändigt worden sei, habe er Dr. H gefragt, ob er am Folgetag zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr einen seit längerem geplanten privaten Termin wahrnehmen könne. Eine Assistenzärztin sei bereit gewesen, seinen Dienst bis 19.00 Uhr zu übernehmen. Dr. H habe dies jedoch abgelehnt.
In einem Gespräch am 6. August 2004 habe ihn Dr. H unter vier Augen aufgefordert darzulegen, wie er sich die weitere Zukunft in der Abteilung vorstelle, da er nicht mehr das Vertrauen der übrigen Kolleginnen und Kollegen besitze. Dr. H habe erklärt, er würde seiner Fürsorgepflicht nachkommen und ihm jederzeit behilflich sein, einen anderen adäquaten Arbeitsplatz zu finden.
Bei einer Operation am 9. September 2004, bei der er zusammen mit einem Kollegen nach einem bei einer Operation im Schädel verbliebenen Glassplitter gesucht habe, habe er versehentlich mit dem Mikrosauger diesen Glassplitter abgesaugt. Dr. H, der nach Auffinden des Glassplitters hinzugerufen worden sei, habe ihn vor versammelter Mannschaft angefahren, weshalb er den Splitter nicht entsprechend einer zuvor erteilten Anweisung belassen habe.
Am 20. September 2004 habe ihn Dr. H angewiesen, einer Kollegin bei einer Operation zu assistieren und dabei gesagt: „Sie wissen ja schon, gerader Hautschnitt, Bohrloch über der Koronarnaht“.
Am 22. September 2004 habe Dr. H in Widerspruch zu einer zuvor getroffenen Vereinbarung über die Behandlung von Privatpatienten ihm mitgeteilt, dass er nur auf persönliche, direkte Anweisung des Dr. H etwas an Privatpatienten zu tun habe.
Bei einem Eingriff an einer Patientin am 27. September 2004 sei ihm von dem Anästhesisten mitgeteilt worden, dass die Anzahl der Thrombozyten so niedrig sei,
- 7 -
dass bei Fortsetzung des Eingriffs die Gefahr einer schwerwiegenden Gerinnungsstörung bestünde. Er habe dies Dr. H telefonisch mitgeteilt. Dieser habe ohne weitere Erklärung mit dem Anästhesisten gesprochen und sich von diesem den Wert bestätigen lassen. Sodann habe Dr. H über den Anästhesisten empfehlen lassen, die Operation abzubrechen.
Der Kläger führt seine Erkrankung ab November 2003 und seine erneute Erkrankung ab Oktober 2004 auf das „Mobbing-Verhalten“ des Dr. H zurück. Dieser weigere sich insbesondere, an einer Lösung der bestehenden Konflikte mitzuwirken. Die Beklagte sei nicht bereit, geeignete Maßnahmen gegen den Chefarzt zu ergreifen.
Der Kläger hat zuletzt folgende Sachanträge gestellt:
1. Die Beklagte wird verurteilt, das Anstellungsverhältnis mit dem Chefarzt der Neurochirurgischen Klinik Herrn Dr. med. Rainer H zu beenden.
Hilfsweise:
Die Beklagte wird verurteilt, dem Kläger einen seiner Leistungsfähigkeit und Stellung entsprechenden Arbeitsplatz, der im Hinblick auf Tätigkeit und Vergütung mit seinem innegehaltenen Arbeitsplatz vergleichbar ist, anzubieten, an dem eine berufliche Weisungsgebundenheit gegenüber Herrn Dr. med. Rainer H nicht besteht.
2. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger ein Schmerzensgeld, dessen Höhe in das Ermessen des Gerichts gestellt wird, nebst Zinsen in Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank seit Klagezustellung zu zahlen.
Die Beklagte hat Klageabweisung beantragt.
Sie bestreitet, dass der Kläger von dem Chefarzt der Neurochirurgischen Klinik Dr. H gemobbt worden sei. Auch habe sie alles ihr Mögliche unternommen, um das Verhältnis zwischen dem Kläger und Dr. H zu entspannen.
Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung des Klägers hat das Landesarbeitsgericht zurückgewiesen und die Revision zugelassen. Mit dieser verfolgt der Kläger sein Klageziel weiter, während die Beklagte die Zurückweisung der Revision beantragt.
- 8 -
Entscheidungsgründe
Die Revision des Klägers ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des an¬gefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Landesarbeitsgericht zur neuen Verhandlung und Entscheidung.
A. Das Landesarbeitsgericht hat die Klage im Wesentlichen aus folgenden Gründen abgewiesen.
I. Eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit dem Chefarzt Dr. H durch die Beklagte könne der Kläger unabhängig davon, ob dieser ihn „gemobbt“ habe, allein deshalb nicht verlangen, weil es Sache der Beklagten als Arbeitgeberin sei, zu entscheiden, mit welchen geeigneten Maßnahmen sie auf die betriebliche Konfliktlage reagiere. Sie könne nicht dazu verpflichtet werden, eine Kündigung auszusprechen, deren Rechtswirksamkeit wegen des Fehlens einer vorherigen Abmahnung zweifelhaft sei.
II. Ein Angebot zur Weiterbeschäftigung auf einem seiner bisherigen Tätigkeit gleichwertigen Arbeitsplatz könne der Kläger deshalb nicht fordern, weil dieses der Beklagten nicht möglich sei. Die fachliche Qualifikation des Klägers stehe einem Einsatz als Erster Oberarzt in einer anderen Abteilung des von der Beklagten betriebenen Krankenhauses entgegen. Die Beklagte sei auch nicht verpflichtet, eine für den Kläger geeignete Stelle zu schaffen.
III. Ein Schmerzensgeldanspruch stehe dem Kläger nicht zu, obwohl er schlüssig die Voraussetzungen für einen solchen Schadensersatzanspruch vorgetragen und bewiesen habe. Er habe für die Zeit ab dem 1. August 2002 bis zu seiner erneuten Erkrankung seit Oktober 2004 eine Vielzahl von Fällen vorgetragen, bei denen durch den Chefarzt Dr. H die Persönlichkeit des Klägers missachtet worden sei. So zeuge die im Zusammenhang mit dem vom Kläger verlangten Abbruch seines Herbsturlaubes 2002 gemachte Äußerung des Chefarztes Dr. H „er sei der Chef und könne seinen Urlaub nicht nach seinen Ärzten richten“ und dessen Weigerung, die Gründe für den dann letztlich nicht angetretenen eigenen Urlaub zu erläutern, von mangelnder Rücksichtnahme des Chefarztes auf die Gefühle des ihm unterstellten Klägers.
- 9 -
Auch die am 4. Mai 2003 erfolgte Beleidigung des Klägers im Zusammenhang mit der Diskussion über die Bereitschaftsdienste zeige erhebliche Mängel im zwischenmenschlichen Umgang des Dr. H mit dem Kläger.
Mangelnder Respekt vor der Person des Klägers und die Missachtung seiner Position als Erster Oberarzt seien auch bei der Auseinandersetzung um die Anzahl der Bohrlöcher bei einer unter der Leitung des Klägers durchgeführten Operation zum Ausdruck gekommen.
Nicht verständlich sei weiter, aus welchem Grund Dr. H gerade vom Kläger, als Erstem Oberarzt, verlangt habe, sein Zimmer mit einem anderen Oberarzt zu teilen.
Bei den Auseinandersetzungen über die Anzahl der Bohrlöcher und der Lagerung des Patienten bei bestimmten Operationen habe Dr. H den nötigen Respekt gegenüber dem Kläger in fachlicher Hinsicht vermissen lassen.
Zwar neige auch der Kläger dazu, sich im Tonfall und in der Wortwahl zu vergreifen, jedoch sei von den anwesenden Ärzten das Verhalten des Klägers bei den fraglichen Auseinandersetzungen nicht als unangemessen empfunden worden.
Ein etwaiger Schadensersatzanspruch des Klägers sei nicht nach § 23 AVR verfallen. Der Kläger habe durch die am 24. Oktober 2004 (richtig wohl: 13. Oktober 2004) der Beklagten zugestellten Klage seinen Schmerzensgeldanspruch fristgerecht innerhalb der sechsmonatigen Ausschlussfrist geltend gemacht, da sich „geeignete Vorgänge zur Begründung seines Mobbingvorwurfs“ in der Zeitspanne von sechs Monaten vor der Klagezustellung zugetragen hätten.
Die durch Dr. H begangenen Persönlichkeitsverletzungen seien auch für die Depressionen des Klägers ursächlich gewesen, deretwegen er ab dem 13. November 2003 arbeitsunfähig geworden sei. Eine Haftung des Chefarztes und damit der Beklagten, die sich seiner als Erfüllungsgehilfe bedient habe, scheitere allerdings daran, dass den Chefarzt kein Verschulden an der Gesundheitsschädigung des Klägers treffe. Für ihn sei nicht erkennbar gewesen, dass durch sein vertragswidriges Verhalten die Krankheit des Klägers ausgelöst werde. Er habe nicht damit rechnen müssen, dass der Kläger auf Grund der Auseinandersetzung, die dieser seinerseits ebenfalls nicht gescheut habe, „in die Kniee gehen werde“. Ab dem Zeitpunkt, ab dem Dr. H von der psychischen Erkrankung des Klägers auf Grund der beruflichen Situation Kenntnis gehabt habe und ab dem deshalb eine besondere Rücksichtsnahme gegenüber dem
- 10 -
Kläger geboten gewesen wäre, seien Handlungen des Chefarztes Dr. H, die den Rechtskreis des Klägers verletzt hätten, nicht mehr festzustellen.
Ein Anspruch des Klägers auf Schmerzensgeld wegen Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts scheitere daran, dass es an der für einen Anspruch erforderlichen Schwere des Eingriffes oder der Schuld des Chefarztes fehle.
B. Die Entscheidung des Landesarbeitsgerichts hält einer revisionsrechtlichen Überprüfung nicht stand.
Die zulässige Revision ist begründet.
I. Das Landesarbeitsgericht hat lediglich geprüft, ob der Kläger gegen die Beklagte Ansprüche hat, die sich daraus ergeben, dass sie sich das Verhalten des Chefarztes Dr. H, dessen sie sich als Erfüllungsgehilfen bedient, § 278 BGB, zurechnen lassen muss. Es fehlen Ausführungen dazu, ob dem Kläger die geltend gemachten Ansprüche gegen die Beklagte unmittelbar wegen von dieser selbst begangener Vertragsverletzungen oder unerlaubter Handlungen zustehen.
Allein dieser Rechtsfehler führt schon zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Landesarbeitsgericht nach § 563 Abs. 1 Satz 1 ZPO.
II. Zutreffend nimmt das Landesarbeitsgericht an, dass das Verhalten des Chefarztes Dr. H keinen Anspruch des Klägers gegen die Beklagte begründet, das Arbeitsverhältnis mit dem Chefarzt zu „beenden“.
Das Landesarbeitsgericht hat das Klagebegehren ohne Rechtsfehler dahingehend ausgelegt, dass der Kläger von der Beklagten die Kündigung des Arbeitsverhältnisses mit dem Chefarzt verlangt.
1. Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, der Kläger habe schlüssig vorgetragen, dass sein Vorgesetzter Dr. H Handlungen begangen habe, durch die in einer Gesamtschau Verletzungen von Rechtsgütern des Klägers kausal verursacht worden seien.
a) Zutreffend geht das Landesarbeitsgericht davon aus, dass „Mobbing“ kein Rechtsbegriff und damit auch keine Anspruchsgrundlage für Ansprüche des Arbeitnehmers gegen den Arbeitgeber oder gegen Vorgesetzte bzw. einen oder mehrere Arbeitskollegen ist (Senat 16. Mai 2007 - 8 AZR 709/06 - NZA 2007, 1154). Da
- 11 -
„Mobbing“ somit als eigenständige Anspruchsgrundlage, vergleichbar mit einer Rechtsnorm, ausscheidet, erübrigt sich im Ergebnis eine allgemeingültige Definition des Begriffes „Mobbing“, wenn der Arbeitnehmer konkrete Ansprüche geltend macht. Dann muss nämlich jeweils geprüft werden, ob der in Anspruch Genommene in den vom Kläger genannten Einzelfällen arbeitsrechtliche Pflichten, ein absolutes Recht des Arbeitnehmers iSd. § 823 Abs. 1 BGB, ein Schutzgesetz iSd. § 823 Abs. 2 BGB verletzt oder eine sittenwidrige vorsätzliche Schädigung iSd. § 826 BGB begangen hat. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass es Fälle gibt, in denen die einzelnen, vom Arbeitnehmer dargelegten Handlungen oder Verhaltensweisen seiner Arbeitskollegen oder seiner Vorgesetzten bzw. seines Arbeitgebers für sich allein betrachtet noch keine Rechtsverletzungen darstellen, die Gesamtschau der einzelnen Handlungen oder Verhaltensweisen jedoch zu einer Vertrags- oder Rechtsgutverletzung führt, weil deren Zusammenfassung auf Grund der ihnen zugrunde liegenden Systematik und Zielrichtung zu einer Beeinträchtigung eines geschützten Rechts des Arbeitnehmers führt (vgl. Senat 16. Mai 2007 - 8 AZR 709/06 - aaO mwN).
Dies entspricht auch weitgehend der seit Inkrafttreten des AGG vom 14. August 2006 (in Kraft seit 18. August 2006) bestehenden Rechtslage. § 3 Abs. 3 AGG definiert den Begriff der „Belästigung“, welche eine verbotene Benachteiligung iSd. §§ 1, 2 AGG darstellt. Danach ist eine Belästigung eine Benachteiligung, wenn unerwünschte Verhaltensweisen, die mit einem in § 1 AGG genannten Grund in Zusammenhang stehen, bezwecken oder bewirken, dass die Würde der betreffenden Person verletzt und ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird.
Mit dieser Definition des Begriffes „Belästigung“ hat der Gesetzgeber letztlich auch den Begriff des „Mobbing“ umschrieben, soweit dieses seine Ursachen in der Rasse, der ethnischen Herkunft, dem Geschlecht, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, im Alter oder der sexuellen Identität (§ 1 AGG) des Belästigten hat (so auch: Bauer/Göpfert/Krieger AGG § 3 Rn. 46; ErfK/Preis 7. Aufl. § 611 BGB Rn. 768a sowie Wolmerath Mobbing 3. Aufl. Rn. 33 und Biester online jurisPR-ArbR 35/2006 Anm. 6, die allerdings annehmen, dass „Mobbing“ deutlich über den Begriff der Belästigung des § 3 Abs. 3 AGG hinausgeht).
Dieser in § 3 Abs. 3 AGG umschriebene Begriff des „Mobbing“, der sich lediglich auf Benachteiligungen aus einem der in § 1 AGG genannten Gründe bezieht, kann auf die Fälle der Benachteiligung eines Arbeitnehmers - gleich aus welchen Gründen -
- 12 -
übertragen werden. Diese Norm zeigt vor allem, dass es grundsätzlich auf die Zusammenschau der einzelnen „unerwünschten“ Verhaltensweisen ankommt, um zu beurteilen, ob „Mobbing“ vorliegt. § 3 Abs. 3 AGG stellt nämlich darauf ab, ob ein durch „Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld“ geschaffen wird. Ein Umfeld wird aber grundsätzlich nicht durch ein einmaliges, sondern durch ein fortdauerndes Verhalten geschaffen. Damit sind alle Handlungen bzw. Verhaltensweisen, die dem systematischen Prozess der Schaffung eines bestimmten Umfeldes zuzuordnen sind, in die Betrachtung mit einzubeziehen. Deshalb dürfen einzelne zurückliegende Handlungen/Verhaltensweisen nicht bei der Beurteilung unberücksichtigt gelassen werden (vgl. Rieble/Klumpp ZIP 2002, 369). Wesensmerkmal der als „Mobbing“ bezeichneten Form der Rechtsverletzung des Arbeitnehmers ist damit die systematische, sich aus vielen einzelnen Handlungen/Verhaltensweisen zusammensetzende Verletzung, wobei den einzelnen Handlungen oder Verhaltensweisen für sich allein betrachtet oft keine rechtliche Bedeutung zukommt (vgl. Senat 16. Mai 2007 - 8 AZR 709/06 - NZA 2007, 1154).
Die gesetzliche Regelung des § 3 Abs. 3 AGG entspricht auch inhaltlich im Wesentlichen dem vom Bundesarbeitsgericht verwendeten „Mobbing“-Begriff. So hat der Siebte Senat bereits in seinem Beschluss vom 15. Januar 1997 (- 7 ABR 14/96 - BAGE 85, 56 = AP BetrVG 1972 § 37 Nr. 118 = EzA BetrVG 1972 § 37 Nr. 133) „Mobbing“ als „systematisches Anfeinden, Schikanieren oder Diskriminieren von Arbeitnehmern untereinander oder durch Vorgesetzte“ bezeichnet.
b) Die Frage, ob ein Gesamtverhalten als eine einheitliche Verletzung von Rechten des Arbeitnehmers zu qualifizieren ist und ob einzelne Handlungen oder Verhaltensweisen für sich genommen oder in der Gesamtschau einen rechtsverletzenden Charakter haben, unterliegt der revisionsrechtlich nur eingeschränkt überprüfbaren tatrichterlichen Würdigung. Ob Rechte des Arbeitnehmers verletzt worden sind, muss von den Tatsachengerichten auf Grund einer Güter- und Interessenabwägung unter sorgsamer Würdigung aller Umstände des Einzelfalles beurteilt werden. Diese Würdigung darf dem Berufungsgericht nicht entzogen werden (Senat 16. Mai 2007 - 8 AZR 709/06 - NZA 2007, 1154). Daher kann das Revisionsgericht nur überprüfen, ob das Landesarbeitsgericht Denkgesetze oder allgemeine Erfahrungssätze verletzt, alle wesentlichen Umstände des Einzelfalles beachtet und hinreichend gewürdigt hat und ob es in die vorzunehmende Güter- und Interessenabwägung die
- 13 -
wesentlichen Umstände des Einzelfalles in nachvollziehbarer Weise mit einbezogen hat sowie ob das Urteil in sich widerspruchsfrei ist.
c) Das Landesarbeitsgericht ist nach umfangreicher Beweisaufnahme zu dem Ergebnis gelangt, dass sich vor der ersten Erkrankung des Klägers ab 13. November 2003 mehrere Vorfälle ereignet haben, die geeignet waren, die Person des Klägers und seine fachliche Qualifikation herabzuwürdigen. So habe der Chefarzt Dr. H in den vom Landesarbeitsgericht im Einzelnen dargelegten Fällen der herausragenden Stellung des Klägers als Erster Oberarzt der Neurochirurgischen Klinik nicht den notwendigen Respekt entgegengebracht und auch im Übrigen erhebliche Mängel im zwischenmenschlichen Umgang mit dem Kläger erkennen lassen. Weiter hat es angenommen, dass es nach der ersten Erkrankung des Klägers zu solchen Vorfällen nicht mehr gekommen ist.
Es ist nicht ersichtlich, dass das Landesarbeitsgericht bei dieser Würdigung wesentliche Umstände des Einzelfalles nicht berücksichtigt hat oder bei der vorgenommenen Interessenabwägung bestimmten Gesichtspunkten keine oder eine unzutreffende Bedeutung beigemessen hat. Gegen die Feststellungen und Würdigungen des Landesarbeitsgerichts wendet sich auch weder der Kläger in seiner Revisionsbegründung noch erhebt die Beklagte in ihrer Revisionserwiderung durchgreifende Gegenrügen. Der Kläger meint lediglich, noch weitere Vorfälle hätten sich als „Mobbing“ dargestellt.
2. Dieses Verhalten des Chefarztes, welchem der Kläger ausgesetzt war, begründet keinen Anspruch des Klägers gegen die Beklagte, das Arbeitsverhältnis mit dem Chefarzt zu kündigen.
a) Nach bisher in ständiger Rechtsprechung vertretener Auffassung hat der Arbeitgeber im Rahmen seiner Fürsorgepflicht auf das Wohl und die berechtigten Interessen des Arbeitnehmers Rücksicht zu nehmen. Die Fürsorgepflicht ist Ausfluss des in § 242 BGB niedergelegten Gedankens von Treu und Glauben, der auch den Inhalt des Arbeitsverhältnisses bestimmt. Bei der Frage, was Treu und Glauben und die Fürsorgepflicht im Einzelfall gebieten, ist insbesondere auf die in den Grundrechten zum Ausdruck gekommenen Wertentscheidungen des Grundgesetzes Bedacht zu nehmen. Dies hat zur Folge, dass der Arbeitgeber das Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers nicht verletzen darf und dass der Arbeitnehmer im Falle einer Verletzung Anspruch auf Beseitigung der fortwährenden Beeinträchtigung und auf das
- 14 -
Unterlassen weiterer Verletzungshandlungen hat (BAG 12. September 2006 - 9 AZR 271/06 - AP BGB § 611 Personalakte Nr. 1 = EzA BGB 2002 § 611 Persönlichkeitsrecht Nr. 4). Daraus folgt, dass der Arbeitgeber die Pflicht hat, seine Arbeitnehmer vor Belästigungen durch Vorgesetzte, Mitarbeiter oder Dritte, auf die er Einfluss hat, zu schützen und ihnen einen menschengerechten Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen (HWK/Thüsing 2. Aufl. § 611 BGB Rn. 256).
Diese allgemeine, letztlich aus § 242 BGB hergeleitete Verpflichtung hatte der Gesetzgeber für den Fall der sexuellen Belästigung eines Beschäftigten in § 3 Abs. 2 Beschäftigtenschutzgesetz (gültig bis 17. August 2006) ausdrücklich klargestellt. Danach war der Arbeitgeber verpflichtet, geeignete Maßnahmen zu treffen, um die Fortsetzung einer festgestellten Belästigung zu unterbinden. Gleichzeitig konkretisierte § 4 Abs. 1 Nr. 1 Beschäftigtenschutzgesetz diese Verpflichtung des Arbeitgebers dahingehend, dass er im Einzelfall angemessene arbeitsrechtliche Maßnahmen wie Abmahnung, Umsetzung, Versetzung oder Kündigung zu ergreifen hat.
Im ab 18. August 2006 in Kraft getretenen AGG hat der Gesetzgeber für den Fall der Benachteiligung eines Arbeitnehmers aus den in § 1 AGG genannten Gründen die diesbezüglichen Pflichten des Arbeitgebers weiter konkretisiert. § 12 Abs. 3 AGG verlangt, dass dann, wenn Beschäftigte gegen das Benachteiligungsverbot verstoßen, der Arbeitgeber die im Einzelfall geeigneten, erforderlichen und angemessenen Maßnahmen zur Unterbindung der Benachteiligung wie Abmahnung, Umsetzung, Versetzung oder Kündigung ergreift.
Zwar hat in diesen gesetzlich normierten Fällen der betroffene Arbeitnehmer gegen den Arbeitgeber Anspruch darauf, dass dieser die zur Beseitigung der Störung erforderlichen Maßnahmen ergreift, einen Anspruch auf eine bestimmte Maßnahme eröffnen die gesetzlichen Vorschriften jedoch nicht. Vielmehr verbleibt dem Arbeitgeber ein Ermessensspielraum, durch welche Maßnahmen er die aufgetretenen Belästigungen des Arbeitnehmers beseitigen will. § 4 Beschäftigtenschutzgesetz stellte eine Kodifizierung des arbeitsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes dar (BAG 25. März 2004 - 2 AZR 341/03 - AP BGB § 626 Nr. 189 = EzA BGB 2002 § 626 Nr. 6). Auch § 12 AGG lässt dem Arbeitgeber einen Ermessensspielraum, mit welchen Maßnahmen er auf Belästigungen eines Arbeitnehmers durch Vorgesetzte oder Mitarbeiter reagiert. Der Arbeitnehmer hat allerdings Anspruch auf die Ausübung rechtsfehlerfreien Ermessens durch den Arbeitgeber (Schleusener/Suckow/Voigt AGG § 12 Rn. 46). Der Arbeitgeber muss nur solche Maßnahmen ergreifen, die er nach den
- 15 -
Umständen des Einzelfalles als verhältnismäßig ansehen darf (Bauer/Göpfert/Krieger § 12 Rn. 32) und die ihm zumutbar sind. Wenn allerdings nach objektiver Betrachtungsweise eine rechtsfehlerfreie Ermessensentscheidung des Arbeitgebers nur das Ergebnis haben kann, eine bestimmte Maßnahme zu ergreifen, hat der Arbeitnehmer Anspruch auf deren Durchführung.
Diese für die Fälle der sexuellen Belästigung und der Benachteiligung wegen der in § 1 AGG genannten Gründe gesetzlich geregelten Verpflichtungen des Arbeitgebers können auch auf Fälle des sog. „Mobbings“ übertragen werden. Dies gilt insbesondere deshalb, weil sich § 4 Beschäftigtenschutzgesetz und § 12 AGG lediglich als die Konkretisierung der dem Arbeitgeber gegenüber seinem Arbeitnehmer obliegenden Fürsorgepflicht darstellen. Für „Mobbing“-Fälle nach Inkrafttreten des AGG (ab 18. August 2006) kommt eine analoge Anwendung in Frage, für frühere Fälle kann die allgemeine Fürsorgepflicht des Arbeitgebers entsprechend den in den gesetzlichen Regelungen zum Ausdruck kommenden Grundsätzen konkretisiert werden.
b) Danach hat der Kläger auf Grund des Verhaltens des ihm vorgesetzten Chefarztes keinen Anspruch gegen die Beklagte, das Arbeitsverhältnis mit diesem zu kündigen.
Eine solche Kündigung entspräche nicht dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und wäre der Beklagten nicht zumutbar. In Frage käme nur eine verhaltensbedingte Kündigung. Nach allgemeiner Meinung stellt die Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines unter § 1 KSchG fallenden Arbeitnehmers immer die sog. ultima ratio dar, dh. vor Ausspruch der Kündigung muss der Arbeitgeber versuchen, ob er diese nicht mit milderen Mitteln vermeiden kann. Eine Kündigung ist nach § 1 Abs. 1 und 2 KSchG sozial nicht gerechtfertigt, wenn es andere geeignete mildere Mittel gibt, um die Vertragsstörung künftig zu beseitigen (st. Rspr., vgl. BAG 7. Dezember 2006 - 2 AZR 182/06 - AP KSchG 1969 § 1 Verhaltensbedingte Kündigung Nr. 56 = EzA SGB IX § 84 Nr. 1).
Die Beklagte wäre wie bei jeder verhaltensbedingten Kündigung regelmäßig verpflichtet, ihrem Chefarzt vor Ausspruch der Kündigung eine Abmahnung auszusprechen (BAG 12. Januar 2006 - 2 AZR 179/05 - AP KSchG 1969 § 1 Verhaltensbedingte Kündigung Nr. 54 = EzA KSchG § 1 Verhaltensbedingte Kündigung Nr. 68). Da eine solche bislang unstreitig nicht erfolgt ist, wäre der Ausspruch einer verhaltensbedingten Kündigung der Beklagten unzumutbar. Dafür, dass die Kündigung des Chefarztes ausnahmsweise ohne vorherige Abmahnung die einzige, dem Verhältnis-
- 16 -
mäßigkeitsgrundsatz entsprechende Maßnahme darstellt, welche die Beklagte bei pflichtgemäßer Ermessensausübung hätte treffen müssen, sind weder objektive Anhaltspunkte erkennbar noch vom Kläger vorgetragen.
3. Der Kläger hat keinen Anspruch darauf, dass ihm die Beklagte einen seiner Leistungsfähigkeit und Stellung entsprechenden Arbeitsplatz anbietet, der im Hinblick auf Tätigkeit und Vergütung mit seinem innegehaltenen Arbeitsplatz vergleichbar ist und an dem eine berufliche Weisungsgebundenheit gegenüber dem Chefarzt Dr. H nicht besteht.
a) Insbesondere findet dieses Begehren keine Anspruchsgrundlage in der Fürsorgepflicht der Beklagten. Durch diese wird die Beklagte verpflichtet, den Kläger
vor Belästigungen durch seinen Vorgesetzten zu schützen. Diese Verpflichtung findet ihre Grenzen jedoch darin, dass der Arbeitgeber keine Maßnahmen ergreifen muss, die ihm unmöglich oder unzumutbar sind.
b) Zutreffend geht das Landesarbeitsgericht davon aus, dass der Kläger als Facharzt für Neurochirurgie bezüglich seines Einsatzes grundsätzlich auf dieses Fachgebiet beschränkt ist. Das vom Kläger geforderte Angebot eines „seiner ... Stellung entsprechenden Arbeitsplatzes, der im Hinblick auf Tätigkeit und Vergütung mit seinem innegehaltenen Arbeitsplatz vergleichbar ist“, verlangt, dass die Beklagte dem Kläger die Stelle eines Ersten Oberarztes anbietet. Nur eine solche entspräche von der Stellung her dem jetzigen Arbeitsplatz des Klägers. Dass der Kläger Kenntnisse und Fähigkeiten in anderen medizinischen Fachgebieten besitzt, begründet zwar möglicherweise einen Anspruch auf eine Beschäftigung in einer „Nicht-Neurochirurgischen“ Abteilung, nicht jedoch auf eine Tätigkeit als Erster Oberarzt in einer solchen, die mit der Weisungsbefugnis gegenüber den dort tätigen „nicht-neurochirurgischen“ Fachärzten verbunden wäre. Dafür bedarf es eines Arztes mit der einschlägigen Facharztausbildung.
Wie das Landesarbeitsgericht festgestellt hat, ist ein anderer Arbeitsplatz für einen Ersten Oberarzt mit neurochirurgischer Fachausbildung im Klinikum der Beklagten nicht vorhanden. Eine solche herausgehobene Stelle zu schaffen, ist der Beklagten nicht zuzumuten. Dies würde die Einrichtung einer eigenen Abteilung verlangen, in welcher der Kläger die Funktion eines Ersten Oberarztes einnehmen könnte und in der er als Facharzt für Neurochirurgie fach- und sachgerecht eingesetzt
- 17 -
werden könnte. Ein solches Verlangen des Klägers darf die Beklagte auf Grund des arbeitsvertraglichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes ablehnen.
4. Der Kläger hat gegen die Beklagte Anspruch auf eine billige Entschädigung in Geld (Schmerzensgeld). Dieser Anspruch ist wegen Verletzung der arbeitsvertraglichen Pflichten durch den Chefarzt als Erfüllungsgehilfen der Beklagten gegenüber dem Kläger begründet, § 241 Abs. 2, § 253 Abs. 2, § 278, § 280 Abs. 1 BGB.
a) Die Beklagte hat als Arbeitgeberin gegenüber dem Kläger als Arbeitnehmer bestimmte Fürsorge- und Schutzpflichten wahrzunehmen. Jeder Vertragspartei erwachsen aus einem Schuldverhältnis nicht nur Leistungs-, sondern auch Verhaltenspflichten zur Rücksichtnahme und zum Schutz der Rechte, Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils, § 241 Abs. 2 BGB in der ab 1. Januar 2002 geltenden Fassung. Dies verbietet auch die Herabwürdigung und Missachtung eines Arbeitnehmers. Dieser hat daher Anspruch darauf, dass auf sein Wohl und seine berechtigten Interessen Rücksicht genommen wird, dass er vor Gesundheitsgefahren, auch psychischer Art, geschützt wird, und dass er keinem Verhalten ausgesetzt wird, das bezweckt oder bewirkt, dass seine Würde verletzt und ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird. Der Arbeitgeber ist in diesem Zusammenhang insbesondere auch zum Schutz der Gesundheit und der Persönlichkeitsrechte des Arbeitnehmers verpflichtet (Senat 16. Mai 2007 - 8 AZR 709/06 - NZA 2007, 1154 mwN).
b) Einem solchen, als „Mobbing“ bezeichneten Verhalten war der Kläger - wie das Landesarbeitsgericht in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise festgestellt hat - durch den Chefarzt Dr. H seit dem Jahre 2002 ausgesetzt. Dieser war Vorgesetzter des Klägers, so dass die Beklagte dessen Verschulden nach § 278 BGB wie eigenes Verschulden zu vertreten hat. Der Arbeitgeber haftet dem betroffenen Arbeitnehmer gegenüber gemäß § 278 BGB für schuldhaft begangene Rechtsverletzungen, die von ihm als Erfüllungsgehilfen eingesetzte Mitarbeiter oder Vorgesetzte begehen (allgemeine Meinung; vgl. Senat 16. Mai 2007 - 8 AZR 709/06 - NZA 2007, 1154 mwN). Dabei ist es jedoch erforderlich, dass die schuldhafte Handlung des als Erfüllungsgehilfe des Arbeitgebers handelnden Mitarbeiters in einem inneren sachlichen Zusammenhang mit den Aufgaben steht, die der Arbeitgeber ihm als Erfüllungsgehilfen zugewiesen hat. Dies ist regelmäßig dann der Fall, wenn der Erfüllungsgehilfe gegenüber dem betroffenen Arbeitnehmer die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers
- 18 -
konkretisiert bzw. wenn er ihm gegenüber Weisungsbefugnis hat (Senat 16. Mai 2007 - 8 AZR 709/06 - aaO). Dass der Chefarzt Dr. H gegenüber dem Kläger weisungsbefugt war, ist unstreitig. Die rechtsverletzenden Handlungen und Verhaltensweisen des Dr. H fanden auch im Zusammenhang mit der Erfüllung der arbeitsvertraglich geschuldeten Dienstleistungen statt.
c) Entgegen der Ansicht des Landesarbeitsgerichts hat der Chefarzt die Gesundheitsschädigung des Klägers schuldhaft verursacht.
Das Landesarbeitsgericht ist auf Grund der durchgeführten Beweisaufnahme nach § 286 ZPO zu der Überzeugung gelangt, dass „die den Rechtskreis des Klägers verletzenden Handlungen des Dr. H“ die Erkrankung des Klägers ab dem 13. November 2003 ausgelöst haben. Gegen diese Feststellungen des Landesarbeitsgerichts hat die Beklagte keine durchgreifenden Verfahrensrügen erhoben.
Die Annahme des Landesarbeitsgerichts, das Verschulden des Chefarztes beziehe sich nicht auf die Erkrankung des Klägers, hält einer revisionsrechtlichen Überprüfung nicht stand.
aa) Nach allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätzen muss sich das Verschulden des Schädigers nur auf die Pflicht-, Rechtsgut- oder Schutzgesetzverletzung, nicht jedoch auf den eingetretenen Schaden beziehen. Dies gilt allerdings nur dann, wenn der Schaden adäquat kausal herbeigeführt worden ist (Senat 18. April 2002 - 8 AZR 348/01 - BAGE 101, 107 = AP BGB § 611 Haftung des Arbeitnehmers Nr. 122 = EzA BGB § 611 Arbeitnehmerhaftung Nr. 70). Von diesem Grundsatz macht die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts jedoch dann eine Ausnahme, wenn ein Fall der privilegierten Haftung, insbesondere in den Fällen der betrieblich veranlassten Arbeitnehmerhaftung, vorliegt. Dann muss sich das Verschulden des Arbeitnehmers auch auf den konkreten Schadenseintritt beziehen. Ansonsten würde die Zuweisung des uneingeschränkten Haftungsrisikos für alle Schäden, die auf Grund der Verletzungshandlung des Schädigers entstanden sind, zu einem unbilligen Ergebnis führen. Der Schuldner, der schuldhaft seine Verpflichtung verletzt, hätte für jeden adäquat verursachten Schaden einzustehen, selbst wenn dieser für ihn nicht erkennbar war. Dies widerspräche dem Ziel der Haftungsprivilegierung (vgl. Senat 18. April 2002 - 8 AZR 348/01 - aaO mit eingehender Begründung).
bb) Eine Haftungsprivilegierung zugunsten des Chefarztes Dr. H greift vorliegend nicht ein.
- 19 -
(1) Die Haftungsbeschränkung nach § 105 Abs. 1 SGB VII ist nicht einschlägig. Nach dieser Vorschrift sind Personen, die durch eine betriebliche Tätigkeit einen Versicherungsfall von Versicherten desselben Betriebes verursachen, diesen sowie deren Angehörigen und Hinterbliebenen nach anderen gesetzlichen Vorschriften zum Ersatz des Personenschadens nur verpflichtet, wenn sie den Versicherungsfall vorsätz¬lich oder auf einem nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 SGB VII versicherten Weg herbeigeführt haben. Nach § 7 Abs. 1 SGB VII sind Versicherungsfälle iSd. Gesetzes Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten. Im Streitfalle liegt jedoch weder ein Arbeitsunfall noch eine Berufskrankheit vor.
(2) Vorliegend greifen auch nicht die Grundsätze der Einschränkung der Arbeitnehmerhaftung infolge betrieblicher Veranlassung der schädigenden Handlung ein.
Ein Vorgesetzter, der im Rahmen der ihm vom Arbeitgeber übertragenen Weisungsbefugnis seine ihm als Erfüllungsgehilfen des Arbeitgebers mit übertragenen arbeitsvertraglichen Schutzpflichten (vgl. Senat 16. Mai 2007 - 8 AZR 709/06 - NZA 2007, 1154) gegenüber einem ihm unterstellten Arbeitnehmer verletzt, kann sich nicht auf eine Haftungsprivilegierung berufen. Die Haftungsbeschränkung des Arbeitnehmers bei betrieblich veranlassten Tätigkeiten findet ihre dogmatische Begründung darin, dass auf Seiten des Arbeitgebers dessen Betriebsrisiko zu berücksichtigen ist. Dabei wird dieser Begriff in diesem Zusammenhang verwendet, um ein Abwägungsmerkmal bei der Verteilung des Haftungsrisikos zu kennzeichnen, nicht aber in der ihm sonst zukommenden Bedeutung als Lohnzahlungsrisiko des Arbeitgebers bei zufälliger Unmöglichkeit der Dienstleistung. In diesem Sinne ist im Rahmen des § 254 BGB bei allen betrieblich veranlassten Tätigkeiten dem Arbeitgeber seine Verantwortung für die Organisation seines Betriebes und die Gestaltung der Arbeitsbedingungen in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht zuzurechnen (vgl. BAG 27. September 1994 - GS 1/89 (A) - BAGE 78, 56 = AP BGB § 611 Haftung des Arbeitnehmers Nr. 103 = EzA BGB § 611 Arbeitnehmerhaftung Nr. 59).
Wollte man im vorliegenden Falle dem schädigenden Vorgesetzten Dr. H eine Haftungsprivilegierung einräumen, würde dies zu einem widersinnigen Ergebnis führen. Der Kläger würde dann nämlich wegen des vom Arbeitgeber zu tragenden Betriebsrisikos für Schäden, die er bei der Verrichtung betrieblicher Tätigkeiten verschuldet, nur in beschränktem Umfange haften. Da die Beklagte als Arbeitgeberin aber nach § 278 BGB das Verschulden des Klägers in gleichem Umfange wie ihr eigenes
- 20 -
Verschulden zu vertreten hätte, käme ihr letztlich die im Interesse des Arbeitnehmers geltende Haftungsprivilegierung selbst zugute.
cc) Der Chefarzt Dr. H hat schuldhaft gegen seine ihm von der Beklagten übertragenen arbeitsvertraglichen Verpflichtungen verstoßen, Verhaltensweisen zu unterlassen, die es bezwecken oder bewirken, dass die Würde des Klägers verletzt wird und ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird. Durch dieses vom Landesarbeitsgericht festgestellte Verhalten des Chefarztes ist die psychische Erkrankung des Klägers verursacht worden. Dies hat das Landesarbeitsgericht auf Grund der durchgeführten Beweisaufnahme ebenfalls festgestellt. Dieser Schaden ist durch das Verhalten des Chefarztes auch adäquat kausal verursacht worden. Wie das Landesarbeitsgericht zutreffend ausführt, kann die adäquat kausale Schadensverursachung nicht daran scheitern, dass bereits die erfolglose Bewerbung des Klägers um die letztlich Dr. H übertragene Chefarztstelle beim Kläger möglicherweise eine psychische Vorschädigung ausgelöst hat. Der Schädiger kann sich nicht darauf berufen, ein psychischer Gesundheitsschaden sei nur deshalb eingetreten, weil der Verletzte infolge von körperlichen Anomalien oder Dispositionen zur Krankheit besonders anfällig gewesen sei. Wer einen gesundheitlich schon geschwächten Menschen verletzt, kann nicht verlangen, so gestellt zu werden, als wenn der Betroffene gesund gewesen wäre (st. Rspr. vgl. BGH 30. April 1996 - VI ZR 55/95 - BGHZ 132, 341 = NJW 1996, 2425 mwN; 11. November 1997 - VI ZR 376/96 - BGHZ 137, 142 = NJW 1998, 810).
Deshalb führt, wenn - wie im Streitfalle - keine Haftungsprivilegierung zugunsten des Arbeitnehmers eingreift nach allgemeinen zivilrechtlichen Haftungsregeln der schuldhafte Verstoß des Chefarztes gegen seine arbeitsvertraglichen Verpflichtungen zu seiner vollen Haftung für alle dadurch verursachten Schäden.
dd) Der Kläger kann wegen der vom Chefarzt Dr. H schuldhaft verursachten Gesundheitsschädigung, als welche sich seine psychische Erkrankung darstellt, gemäß § 253 Abs. 2 BGB eine billige Entschädigung in Geld von der Beklagten verlangen, die nach § 278 BGB für das Verschulden ihres als Erfüllungsgehilfen tätig gewordenen Chefarztes einzustehen hat.
d) Dieser Schadensersatzanspruch ist nicht auf Grund der Ausschlussfrist des § 23 Abs. 1 AVR verfallen.
- 21 -
Nach dieser verfallen Ansprüche aus dem Dienstverhältnis, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit vom Mitarbeiter schriftlich geltend gemacht werden, soweit die AVR nichts anderes bestimmen.
Es bedarf vorliegend keiner Entscheidung, inwieweit diese einzelvertraglich vereinbarte Ausschlussfrist auch Ansprüche der streitgegenständlichen Art erfasst. Auch wenn die Klausel wirksam ist und den geltend gemachten Schmerzensgeldanspruch erfasst, führt sie nicht zum Verfall des Anspruches. Der Kläger hat seinen Schmerzensgeldanspruch innerhalb der Ausschlussfrist geltend gemacht.
Die Fälligkeit eines Schadensersatzanspruches und damit der Beginn des Laufes der Ausschlussfrist setzt voraus, dass ein Schaden überhaupt entstanden ist, da begrifflich erst mit der Entstehung eines Schadens ein Schadensersatzanspruch entstehen kann. In der Regel wird der Schadensersatzanspruch auch mit seiner Entstehung fällig. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts setzt die Fälligkeit eines Schadensersatzanspruches jedoch darüber hinaus voraus, dass der Schaden für den Gläubiger feststellbar ist und geltend gemacht werden kann (Senat 16. Mai 2007 - 8 AZR 709/06 - NZA 2007, 1154 mwN).
Wie das Landesarbeitsgericht festgestellt hat, beruht die ab dem 13. November 2003 eingetretene krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit des Klägers auf den als „Mobbing“ gewerteten Arbeitsvertragsverletzungen des Chefarztes Dr. H. Diese Krankheit dauerte zumindest bis zum 6. Mai 2004, da der Kläger ab dem 7. Mai 2004 bis zum 19. Mai 2004 einen erfolglosen Wiedereingliederungsversuch unternommen hat. Der Kläger war erst ab Beendigung seiner Erkrankung in der Lage, seinen ihm durch diese entstandenen Schaden festzustellen. Das gilt insbesondere für den geltend gemachten Schmerzensgeldanspruch, weil dieser in seiner Höhe ganz wesentlich von der Dauer der Krankheit abhängt. Den frühestens mit Ablauf des 6. Mai 2004 fällig gewordenen Schmerzensgeldanspruch hat der Kläger mit seiner am 13. Oktober 2004 der Beklagten zugestellten Klageschrift und somit innerhalb der sechsmonatigen Ausschlussfrist des § 23 AVR schriftlich geltend gemacht.
e) Eine Sachentscheidung nach § 563 Abs. 3 ZPO über die Höhe des dem Kläger zustehenden Schmerzensgeldanspruches ist dem Senat verwehrt, weil die Höhe der dem Kläger zustehenden Geldentschädigung nach der Billigkeit festzusetzen ist, § 253 Abs. 2 BGB und die Bemessung von Schmerzensgeldansprüchen grundsätzlich Aufgabe des Tatrichters ist (BGH 12. Mai 1998 - VI ZR 182/97 - BGHZ 138, 388 = NJW 1998, 2741).
- 22 -
Daher hat sich das Landesarbeitsgericht mit allen für die Bemessung des Schmerzensgeldes maßgebenden Umständen auseinanderzusetzen. Dabei wird es auch zu berücksichtigen haben, ob und inwieweit den Kläger auf Grund seines eigenen Verhaltens ein Mitverschulden an dem eingetretenen Schaden trifft, § 254 BGB.
5. Weiter hat das Landesarbeitsgericht zu prüfen, ob dem Kläger die geltend gemachten Ansprüche deshalb unmittelbar gegen die Beklagte zustehen, weil diese selbst die ihr als Arbeitgeberin obliegenden Schutzpflichten gegenüber dem Kläger verletzt hat.
III. Da dem Kläger gegen die Beklagte gemäß § 241 Abs. 2, § 253 Abs. 2, § 278, § 280 Abs. 1 BGB ein Anspruch auf eine angemessene Entschädigung in Geld wegen der durch den Chefarzt Dr. H schuldhaft verursachten psychischen Erkrankung zusteht, braucht der Senat nicht zu prüfen, ob der Kläger unmittelbar gegen die Beklagte einen Anspruch auf Schadensersatz hat. Einen solchen hat das Landesarbeitsgericht nicht geprüft. Er könnte sich dann ergeben, wenn die Beklagte die ihr als Arbeitgeberin obliegende arbeitsvertragliche Verpflichtung verletzt hätte, den Kläger vor Rechtsverletzungen durch seinen Vorgesetzten, den Chefarzt Dr. H, zu schützen (vgl. Senat 16. Mai 2007 - 8 AZR 709/06 - NZA 2007, 1154).
Hauck
Böck
Breinlinger
Andreas Henniger
zugleich für den wegen Ablauf seiner Amtszeit an der Unterschrift verhinderten ehrenamtlichen Richter Bähringer
Hauck
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gern:
 |
Dr. Martin Hensche Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hensche@hensche.de |
 |
Christoph Hildebrandt Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hildebrandt@hensche.de |
 |
Nina Wesemann Rechtsanwältin Fachanwältin für Arbeitsrecht Kontakt: 040 / 69 20 68 04 wesemann@hensche.de |