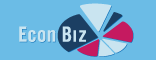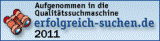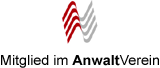- -> zur Mobil-Ansicht
- Arbeitsrecht aktuell
- Tipps und Tricks
- Handbuch Arbeitsrecht
- Gesetze zum Arbeitsrecht
- Urteile zum Arbeitsrecht
- Urteile 2023
- Urteile 2021
- Urteile 2020
- Urteile 2019
- Urteile 2018
- Urteile 2017
- Urteile 2016
- Urteile 2015
- Urteile 2014
- Urteile 2013
- Urteile 2012
- Urteile 2011
- Urteile 2010
- Urteile 2009
- Urteile 2008
- Urteile 2007
- Urteile 2006
- Urteile 2005
- Urteile 2004
- Urteile 2003
- Urteile 2002
- Urteile 2001
- Urteile 2000
- Urteile 1999
- Urteile 1998
- Urteile 1997
- Urteile 1996
- Urteile 1995
- Urteile 1994
- Urteile 1993
- Urteile 1992
- Urteile 1991
- Urteile bis 1990
- Arbeitsrecht Muster
- Videos
- Impressum-Generator
- Webinare zum Arbeitsrecht
-
Kanzlei Berlin
 030 - 26 39 62 0
030 - 26 39 62 0
 berlin@hensche.de
berlin@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Frankfurt
 069 - 71 03 30 04
069 - 71 03 30 04
 frankfurt@hensche.de
frankfurt@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hamburg
 040 - 69 20 68 04
040 - 69 20 68 04
 hamburg@hensche.de
hamburg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hannover
 0511 - 89 97 701
0511 - 89 97 701
 hannover@hensche.de
hannover@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Köln
 0221 - 70 90 718
0221 - 70 90 718
 koeln@hensche.de
koeln@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei München
 089 - 21 56 88 63
089 - 21 56 88 63
 muenchen@hensche.de
muenchen@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Nürnberg
 0911 - 95 33 207
0911 - 95 33 207
 nuernberg@hensche.de
nuernberg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Stuttgart
 0711 - 47 09 710
0711 - 47 09 710
 stuttgart@hensche.de
stuttgart@hensche.de
AnfahrtDetails
OVG für das Land Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 07.03.2012, 3d A 317/11.O
| Schlagworte: | Streik: Lehrer, Streik: Beamte, Beamter: Streikrecht | |
| Gericht: | Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen | |
| Aktenzeichen: | 3d A 317/11.O | |
| Typ: | Urteil | |
| Entscheidungsdatum: | 07.03.2012 | |
| Leitsätze: | ||
| Vorinstanzen: | Verwaltungsgericht Düsseldorf, Urteil vom 15.12.2010, 31 K 3904/10.O | |
OBERVERWALTUNGSGERICHT
FÜR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
Verkündet am: 7. März 2012 Bilen
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
3d A 317/11.O
31 K 3904/10.O Düsseldorf
In dem Disziplinarverfahren
&
wegen einer Disziplinarverfügung (Geldbuße wegen Teilnahme an einem Warnstreik)
hat der Disziplinarsenat
auf die mündliche Verhandlung
vom 7. März 2012
- 2 -
durch
den Vorsitzenden Richter am Oberverwaltungsgericht Dr. S c h a c h e l,
den Richter am Oberverwaltungsgericht H o f f m a n n ,
die Richterin am Oberverwaltungsgericht F l o c k e n h a u s ,
die Beamtenbeisitzerin S a r i g e l i n o g l u, Konrektorin,
den Beamtenbeisitzer K a u f m a n n, Lehrer,
auf die Berufung des beklagten Landes gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf vom 15. Dezember 2010
für Recht erkannt:
Das angefochtene Urteil wird geändert. Die Klage wird abgewiesen.
Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens bei-der Instanzen.
Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des beizutreibenden Betrages abwenden, wenn nicht das beklagte Land vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
Die Revision wird nicht zugelassen.
Tatbestand:
Die am 7. Juni 19 in C. geborene Klägerin steht als Lehrerin (Besoldungsgruppe A 12) im Dienst des beklagten Landes und wendet sich mit der vorliegenden Klage gegen eine Disziplinarverfügung ihres Dienstherrn, mit der ihr wegen der Teilnahme an drei Streiks eine Geldbuße i.H.v. 1.500,00 Euro auferlegt wurde.
- 3 -
Die Klägerin besuchte ab dem Jahr 1975 das F. -N. -B. -Gymnasium in C. und erwarb am 8. Juni 1984 die allgemeine Hochschulreife. Nach dem Abitur studierte sie von 1984 bis 1986 zunächst an der Universität C. Theologie, Latein und Pädagogik, danach von 1986 bis 1990 Sozialpädagogik an der Fachhochschule L. und schloss dieses Studium am 29. März 1990 als Diplom-Sozialpädagogin ab. In der Folgezeit leistete sie ein Anerkennungsjahr beim Jugendamt der Stadt U. ab. Nach einem weiteren Studium an den Universitäten L. und C. sowie an der Sporthochschule L. von 1991 bis 1996 bestand sie am 18. November 1996 die Erste Staatsprüfung für die Lehrämter für die Sekundarstufen I und II mit den Prüfungsfächern Erziehungswissenschaft, Deutsch und Sport. Ab dem 1. Februar 1997 hat sie den Vorbereitungsdienst mit Schwerpunkt im Gymnasium abgeleistet und bestand am 13. Januar 1999 die Zweite Staatsprüfung für die Lehrämter für die Sekundarstufen I und II.
In der Folgezeit ist die Klägerin mehrfach befristet als Lehrerin im Angestelltenverhältnis eingestellt worden und unterrichtete an der Gesamtschule C. – C1. H. . Mit Wirkung vom 20. August 2001 wurde die Klägerin auf eigenen Antrag unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Probe zur Lehrerin zur Anstellung ernannt. Am 10. Oktober 2002 wurde sie unter Verleihung der Eigenschaft einer Beamtin auf Lebenszeit zur Lehrerin ernannt. Vom 20. August 2001 bis zum 31. Juli 2005 wurde sie an der Realschule O. in T. B1. , vom 1. August 2005 bis zum 31. Juli 2006 an der P. -M. -Realschule in L. -Q. und seit dem 1. August 2006 an der Realschule Menden in T. - B1. eingesetzt.
Die Klägerin ist seit dem 7. Juni 1996 verheiratet. Sie ist Mutter von zwei Töchtern (O1. W. , geb. am 12. März 1994, und B. E. , geb. am 21. September 1998).
Sie ist - mit Ausnahme der hier in Rede stehenden Vorwürfe - weder straf- noch disziplinarrechtlich vorbelastet. Ihre dienstliche Beurteilung vom 24. Mai 2002 schloss sie mit dem Gesamturteil „Frau E1. hat sich in der Probezeit bewährt“ ab. Anlässlich ihrer Bewerbung für den Auslandschuldienst wurde sie am 13. Februar 2003 beurteilt. Ihre Leistungen wurden wie folgt bewertet: „Frau E2.
- 4 -
Leistungen entsprechen den Anforderungen in besonderem Maße“. Aus Anlass ihrer Bewerbung um die Stelle einer Konrektorin wurde sie am 13. Juni 2008 beurteilt. Das Gesamturteil lautete: „Die Leistungen übertreffen die Anforderungen“.
Die Klägerin ist Mitglied in der Partei Die Linke und hat bei der letzten Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen für diese im Wahlkreis S. -T. -L. I (Listenplatz 17) kandidiert. In den nordrhein-westfälischen Landtag ist die Klägerin nicht gewählt worden. Ferner ist sie Mitglied in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und darüber hinaus stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft S. -T. -L. sowie Mitglied der Landestarifkommission der GEW.
Am 28. Januar 2009, 5. Februar 2009 und 10. Februar 2009 fanden in Nordrhein-Westfalen auf entsprechenden Aufruf der GEW Warnstreiks und Kundgebungen angestellter Lehrkräfte an öffentlichen Schulen statt. Damit sollte der Forderung nach einer Tariferhöhung um acht Prozent Nachdruck verliehen werden. Die Gewerkschaft strebte außerdem eine anschließende Übernahme des Tarifabschlusses für die Beamten im Schuldienst des Landes Nordrhein-Westfalen an. Die Streikmaßnahmen waren auch Gegenstand der Berichterstattung in den Medien.
Die Klägerin nahm ohne Genehmigung ihres Dienstherrn an diesen Warnstreiks teil. Dieser Teilnahme an den Warnstreiks ging jeweils ein Gespräch der Klägerin mit der Konrektorin am 23. Januar 2009 sowie mit der Schulleiterin am 26. Januar 2009 voraus, in denen sie darauf hingewiesen wurde, dass ihr als Beamtin ein Streikrecht nicht zustehe. Mit Schreiben vom 9. Februar 2009 wies die Schulleiterin die Klägerin nochmals darauf hin, dass sie nach dem Beamtenrecht kein Recht auf Streikteilnahme habe. Ihr Fernbleiben vom Unterricht am 28. Januar 2009 und 5. Februar 2009 müsse als pflichtwidriges Verhalten der vorgesetzten Dienstbehörde - der Bezirksregierung L. - gemeldet werden. Aus diesen Gründen könne auch der Bitte um eine Unterrichtsfreistellung für den 10. Februar 2009 nicht nachgekommen werden, da es sich erneut um die Teilnahme an einer Streikaktion handele.
- 5 -
Durch die Streikteilnahme der Klägerin waren an den drei Tagen insgesamt 12 Unterrichtsstunden betroffen, von denen acht Stunden ersatzlos ausfielen. Am 28. Januar 2009 fielen die erste und zweite Unterrichtsstunde (Sport in der Klasse 7c) sowie die fünfte und sechste Unterrichtsstunde (Sport in der Klasse 5d) ersatzlos aus. In der dritten Schulstunde nahmen die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8c statt am Deutschunterricht bei der Klägerin am Unterricht anderer Lerngruppen teil. In der vierten Stunde erhielt diese Klasse Vertretungsunterricht durch eine Fachlehrkraft für Deutsch. Am 5. Februar 2009 wurde die Klägerin im Deutschunterricht der Klasse 10c in der dritten Stunde durch eine Fachlehrkraft für Deutsch vertreten. In der vierten Stunde nahmen die Schülerinnen und Schüler dieser Klasse am Unterricht anderer Lerngruppen teil. Der Deutschunterricht in der fünften Schulstunde in der Klasse 7c entfiel ersatzlos. Am 10. Februar 2009 fiel aufgrund der Streikteilnahme der Klägerin der Deutschunterricht in der Klasse 10c in der fünften und sechsten Schulstunde ersatzlos aus, das gleiche galt für den Förderunterricht in Deutsch für den Jahrgang 5 in der siebten Schulstunde.
Im Anschluss an die jeweilige Streikteilnahme übernahm die Klägerin Vertretungsunterricht, der nicht über Mehrarbeit abgegolten wurde. Insgesamt handelte es sich dabei um 17 Schulstunden, und zwar um zwei Unterrichtsstunden am 2. Februar 2009 sowie je eine Stunde am 9., 18. und 25. Februar 2009, 4., 5., 9., 11., 23. und 25. März 2009, 24. April 2009, 6., 8., 15., 18. und 25. Mai 2009. Der Vertretungsunterricht fand nicht in den Klassen statt, in denen der Unterricht infolge der Streikteilnahme der Klägerin ausgefallen war.
Die Bezirksregierung L. leitete wegen der Streikteilnahme der Klägerin am 10. August 2009 ein Disziplinarverfahren gegen sie ein. Mit Schreiben vom gleichen Tag wurde die Klägerin hierüber unterrichtet. Zugleich wurde ihr die Möglichkeit eingeräumt, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Mit anwaltlichem Schreiben vom 28. September 2009 führte die Klägerin aus, dass sie mit der Teilnahme an den Veranstaltungen vom 28. Januar 2009, 5. Februar 2009 sowie 10. Februar 2009 keineswegs die Nichterfüllung dienstlicher Pflichten oder die Herbeiführung einer Beeinträchtigung des Schulablaufs beabsichtigt habe. Es sei ihr allein darum gegangen, ihre Meinung zu wesentlichen bildungspolitischen Fragen zu äußern und
- 6 -
auf nach ihrer Auffassung dringend verbesserungsbedürftige schulische Um-stände aufmerksam zu machen. Dass es dabei zu Unterrichtsausfall gekommen sei, bedauere sie sehr. Dies sei jedoch - auch nicht mittelbar - ihre Zielsetzung gewesen. Sie habe sich daher seinerzeit umgehend bei der Schulleitung darum bemüht, den Unterrichtsausfall nachzuholen. Für die betroffenen Klassen sei es daher nicht zu Nachteilen gekommen. Sie bedauere die Geschehnisse sehr, erkenne die ihr obliegenden Pflichten uneingeschränkt an und schließe eine Wiederholung aus.
Zu dem unter dem 27. Januar 2010 verfassten Ergebnis der disziplinarischen Ermittlungen erhielt die Klägerin Gelegenheit zu einer abschließenden Äußerung, von der sie keinen Gebrauch machte. Hinsichtlich der Einzelheiten des Ermittlungsergebnisses - das sich auf die Teilnahme an den Streiks am 28. Januar 2009, 5. Februar 2009 und 10. Februar 2009 bezieht - wird auf den Ermittlungsbericht vom gleichen Tag (Beiakte Heft 1, Bl. 40 bis Bl. 45) Bezug genommen.
Nach Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten erließ die Bezirksregierung L. unter dem 10. Mai 2010 - dem Prozessbevollmächtigten der Klägerin am 17. Mai 2010 zugestellt - eine Disziplinarverfügung, mit der sie der Klägerin wegen der vorbezeichneten Vorfälle eine Geldbuße i.H.v. 1.500,00 Euro auferlegte. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus: Das festgestellte Verhalten der Klägerin am 28. Januar 2009, 5. Februar 2009 und 10. Februar 2009 stelle ein Dienstvergehen dar. Insbesondere sei es entgegen der Einlassung der Klägerin hierdurch durchaus zu gewissen Nachteilen der betroffenen Klassen gekommen, da die ausgefallenen Unterrichtsstunden dort nicht nachgeholt worden seien. Die Klägerin habe vorsätzlich gegen die ihr obliegende Pflicht verstoßen, sich mit voller Hingabe ihrem Beruf zu widmen (§ 57 Satz 1 LBG NRW a.F.), mit ihrem Verhalten innerhalb und außerhalb des Dienstes der Achtung und dem Vertrauen gerecht zu werden, das ihr Beruf erfordere (§ 57 Satz 3 LBG NRW a.F.), die von ihrem Vorgesetzten erlassenen Anordnungen auszuführen (§ 58 Satz 2 LBG NRW a.F.), und habe entgegen dem Verbot gehandelt, dem Dienst ohne Genehmigung fernzubleiben (§ 79 Abs. 1 Satz 1 LBG NRW a.F.). Die Klägerin habe vorsätzlich gehandelt. Dass sie entsprechend ihrer Einlassung auf nach ihrer Auffassung dringend verbesserungsbedürftige schulische Umstände habe auf-
- 7 -
merksam machen und damit womöglich auch öffentliche Interessen habe verfolgen wollen, mache ihr Verhalten nicht rechtmäßig und beseitige ihren Vorsatz nicht. Unerheblich sei insoweit, ob die Störung des Schulbetriebs gerade ihr Ziel oder nur unvermeidbare Nebenfolge ihres Verhaltens gewesen sei. Auch die Bereitschaft der Klägerin, die versäumte Unterrichtsleistung nachzuholen, ändere am Vorliegen eines Dienstvergehens nichts. Eine Lehrkraft habe den nach dem Stundenplan vorgesehenen Unterricht zu erteilen; dies schließe eigenmächtige Veränderungen der Dienstzeiten aus. Auf einen unvermeidbaren und daher schuldausschließenden Verbotsirrtum könne sich die Klägerin nicht berufen, weil sie von der Schulleitung im Vorhinein auf die Unzulässigkeit ihres geplanten Verhaltens ausdrücklich hingewiesen worden sei. Mit Blick auf die Schwere des Dienstvergehens spreche einiges dafür, gegen die Klägerin eine Disziplinarmaßnahme mit längerfristiger Wirkung, also eine Kürzung der Dienstbezüge zu verhängen. Dass hiervon abgesehen werde, habe seinen Grund allein darin, dass die Klägerin nach den Pflichtverletzungen immerhin 17 Vertretungsstunden geleistet und dabei auf Mehrarbeitsvergütung verzichtet habe, um die ausgefallenen Unterrichtsstunden zumindest finanziell auszugleichen. Dementsprechend sei auch ein Besoldungsrückforderung nach § 9 BBesG unterblieben. Gleichwohl sei angesichts der Schwere des Dienstvergehens zumindest eine Geldbuße im mittleren Bereich angebracht, um der Klägerin deutlich zu machen, dass ein unerlaubtes Fernbleiben vom Dienst auch dann ein schwerwiegendes Dienstvergehen darstelle, wenn die versäumte Arbeitszeit später nachgeholt werde. Die monatlichen Bruttobezüge betragen bei der Klägerin deutlich mehr als 3.000,00 Euro. Im Rahmen der abschließenden Anhörung habe die Klägerin keine Angaben über ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse gemacht, so dass davon auszugehen sei, dass insoweit keine Besonderheiten vorliegen. Daher erscheine eine Geldbuße in der hier ausgesprochenen Höhe angemessen.
Gegen diese Disziplinarverfügung hat die Klägerin am 17. Juni 2010 Klage erhoben. Zur Begründung hat sie im Wesentlichen ausgeführt: Die Disziplinarmaßnahme sei rechtswidrig, weil ein Dienstvergehen nicht nachgewiesen sei. Insbesondere stelle die Teilnahme an den Warnstreiks am 28. Januar 2009, 5. Februar 2009 und 10. Februar 2009 keinen Verstoß gegen beamtenrechtliche Pflichten
- 8 -
dar. Die Teilnahme sei durch die Ausübung des Grundrechts auf gewerkschaftliche Betätigung in Form der Teilnahme an einem gewerkschaftlichen Streik gemäß Art. 9 Abs. 3 GG gerechtfertigt. Die hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums (Art. 33 Abs. 5 GG) stünden einem Streikrecht der Beamten nicht entgegen, da das Beamtenrecht gemäß dem Verfassungsauftrag fortzuentwickeln sei. Beinhalte der Begriff „volle Hingabe“ eine gewisse unkritische Unterwürfigkeit, schließe der „volle persönliche Einsatz“ dagegen auch ein Engagement des Beamten ein, sich um konkrete Arbeitsbedingungen zu kümmern und gegebenenfalls sich für deren Verbesserung aktiv einzusetzen. Im Übrigen stelle Art. 33 Abs. 5 GG keine Rezeption vorkonstitutionellen Rechts dar, sondern schreibe lediglich die Beachtung traditioneller Rechte und Pflichten vor. Das Streikrecht ergebe sich insbesondere aus Art. 11 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) und aus mehreren Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR). In der Entscheidung vom 12. November 2008 habe der EGMR klargestellt, dass „Mitglieder der Staatsverwaltung“ nicht vom Anwendungsbereich des Art. 11 EMRK ausgeschlossen werden dürfen. In einer Entscheidung vom 21. April 2009 sei die 3. Sektion des EGMR sogar noch weiter gegangen und habe festgestellt, dass auch das Streikrecht durch Art. 11 EMRK geschützt werde und das generelle Streikverbot für Beamte hierzu im Widerspruch stehe. Der EGMR knüpfe nicht an die in der Bundesrepublik Deutschland herrschende Statustheorie an, sondern stelle auf die jeweilige Funktion des Beamten ab. Maßgeblich sei danach, ob der jeweilige Beamte hoheitliche Befugnisse im Sinne des Art. 33 Abs. 4 GG ausübe. In einem solchen Fall könnten Eingriffe in das Streikrecht rechtmäßig sein. Einigkeit bestehe darin, dass die Anwendung von Eingriffsbefugnissen gegenüber dem Bürger hoheitsrechtlicher Natur sei. Entsprechende Aufgaben seien indes bei Lehrern nicht ersichtlich. Das Bundesverfassungsgericht habe jedenfalls entschieden, dass die Tätigkeit als Lehrkraft an einer öffentlichen Schule nicht als Wahrnehmung hoheitsrechtlicher Befugnisse im Sinne des Art. 33 Abs. 4 GG einzustufen sei. Unter Berücksichtigung dieser Erwägungen könne einem aus Art. 33 Abs. 5 GG abgeleiteten Streikverbot für Beamte jedenfalls kein höheres Gewicht zukommen als dem sich aus Art. 9 Abs. 3 GG ergebenden Streikrecht, wenn von der Streikmaßnahme ausschließlich Beamtinnen und Beamte betroffen seien, die - wie hier die
- 9 -
Klägerin als Lehrerin - keine Tätigkeiten hoheitsrechtlicher Natur ausüben. Bei einem auf höhere Besoldung gerichteten Streik handele es sich auch nicht um einen unzulässigen „politischen Streik“.
Die Klägerin hat beantragt,
die Disziplinarverfügung des Beklagten vom 10. Mai 2010 aufzuheben.
Das beklagte Land hat beantragt,
die Klage abzuweisen.
Zur Begründung seines Antrags hat es geltend gemacht: Die von der Klägerin vertretene Rechtsaufassung widerspreche der ständigen Rechtsprechung aller mit dieser Frage befassten deutschen Gerichte.
Das Verwaltungsgericht hat mit dem angefochtenen Urteil die Disziplinarverfügung vom 10. Mai 2010 aufgehoben und zur Begründung ausgeführt, dass diese rechtswidrig sei und die Klägerin in ihren Rechten verletze. Zwar habe die Klägerin ein einheitliches Dienstvergehen dadurch begangen, dass sie an drei Tagen während der Dienstzeit vorsätzlich an Warnstreiks teilgenommen und den Dienst versäumt habe. Die Koalitionsfreiheit der Beamten bilde weder einen Rechtfertigungs- noch einen Entschuldigungsgrund für das Verhalten der Klägerin. Die Klägerin habe auch schuldhaft gehandelt. Der Beklagte habe aber auf das Dienstvergehen der Klägerin nicht mit dem Erlass einer Disziplinarverfügung reagieren dürfen. Er sei durch die EMRK und die zu ihr ergangene Rechtsprechung des EGMR gehindert gewesen. Im Einzelnen hat das Verwaltungsgericht hierzu ausgeführt:
„a) Der EGMR hat in jüngerer Zeit mehrfach ausgesprochen, dass Vertragsstaaten konventionswidrig handeln, wenn sie an die Teilnahme eines Beamten an einem Streik eine Sanktion knüpfen. Denn nicht nur das abstrakte - in Deutschland nach dem oben Ausgeführten weiterhin gültige und zu beachtende - Streikverbot greift in das Menschenrecht des Beamten aus Art. 11 EMRK ein, sondern auch die Sanktionierung der Streikteilnahme im Einzelfall. Für diesen Eingriff fehlte es in den vom EGMR entschiedenen Fällen an einer Rechtfertigung, da er nicht - wie es Art. 11 Abs. 2 EMRK fordert - „in einer demokratischen Gesellschaft notwendig“ (nécessaire dans une société democratique) war.
So die Entscheidungen des EGMR vom 27. März 2007 - Nr. 6615/03 -, Karacay; 15. September 2009 - Nr. 30946/04 -, L1. und T1. ; 13. Juli 2010 - Nr. 33322/07 -, D. , jeweils in französischer Sprache auf der Homepage des EGMR veröffentlicht.
- 10 -
Eine unter dem Blickwinkel des Art. 11 Abs. 2 EMRK ausreichende Rechtfertigung der Disziplinierung streikender Lehrer ist auch im geltenden Recht der Bundesrepublik Deutschland nicht gegeben. Denn nicht anders als das abstrakt-generelle Streikverbot (vgl. oben 2a) ist auch die konkret-individuelle Disziplinarmaßnahme im Einzelfall „in einer demokratischen Gesellschaft notwendig“ nur dann, wenn sie sich auf gesetzliche Einschränkungen des Streikrechts stützen kann, die so klar und eng wie möglich die Kategorien der betroffenen Beamten festlegen. Das ist im deutschen Recht nicht der Fall. Der Gesetzgeber hat es auch nach den Entscheidungen des EGMR bei dem allgemeinen verfassungsrechtlichen Verbot des Beamtenstreiks bewenden lassen, ohne nach den Funktionen der Beamten zu differenzieren, insbesondere eine Begrenzung auf die Ausübung hoheitlicher Befugnisse im engeren Sinne vorzunehmen.
In diesem Zusammenhang kann offen bleiben, ob eine ausreichende Einschränkung bereits in der Zugehörigkeit des Beamten zu einer der in Art. 11 Abs. 2 Satz 2 EMRK genannten Gruppen von Staatsbediensteten (Streitkräfte, Polizei, Staatsverwaltung) liegen kann, ohne dass es einer ausdrücklichen Regelung im nationalen Recht bedürfte. Denn Lehrer gehören nicht zu diesen Gruppen, insbesondere nicht zur „Staatsverwaltung“ im Verständnis der EMRK.
Vgl. EGMR, Entscheidung vom 8. Dezember 1999 - Nr. 28541/95 -, Pellegrin, NVwZ 2000, 661, 663, mit Hinweis auf eine Mitteilung der Europäischen Kommission vom 18. März 1988; dazu mit Blick auf Lehrer: Lörcher, AuR 2009, 229, 241.
Danach verstieß die hier angefochtene Disziplinarverfügung gegen die EMRK. Denn die Warnstreiks, an denen die Klägerin teilnahm, sind von dem durch den EGMR anerkannten Streikrecht erfasst. Den Entscheidungen des EGMR lassen sich keine Einschränkungen in dieser Hinsicht entnehmen. Es hat daher bei dem allgemeinen, seit langem durch das Bundesarbeitsgericht anerkannten Grundsatz zu verbleiben, dass zu den zulässigen Streiks auch Warnstreiks gehören.
Vgl. BAG, Urteil vom 17. Dezember 1976 - 1 AZR 605/75 -, BAGE 28, 295 = AP Nr. 51 zu Art. 9 GG Arbeitskampf; Urteil vom 21. Juni 1988 - 1 AZR 651/86 -, BAGE 58, 364 = AP Nr. 108 zu Art. 9 GG Arbeitskampf.
Auch für eine sonstige Unzulässigkeit der Streiks ist unter dem Blickwinkel der EMRK nichts ersichtlich. Sie waren insbesondere nicht unverhältnismäßig.
Vgl. zum Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Arbeitskampfrecht grundlegend: BAG (GS), Beschluss vom 21. April 1971 - GS 1/68 -, BAGE 23, 292 = AP Nr. 43 zu Art. 9 GG Arbeitskampf.
b) Die Entscheidungen des EGMR sind zwar nicht unmittelbar verbindlich, zumal sie nicht gegen die Bundesrepublik Deutschland ergangen sind. Es entspricht aber der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes, dass die Gerichte im Rahmen ihrer Bindung an Gesetz und Recht auch die Gewährleistungen der EMRK und die Entscheidungen des EGMR zu berücksichtigen haben. Dies hat in methodisch vertretbarer Gesetzesauslegung zu geschehen. Liegt der Konventionsverstoß in dem Erlass eines bestimmten Verwaltungsakts, so hat die zuständige Behörde die Möglichkeit, diesen schon nicht zu erlassen oder - falls dies bereits geschehen ist - wieder aufzuheben. Eine konventionswidrige Verwaltungspraxis kann geändert wer-den; die Pflicht dazu können Gerichte feststellen.
Vgl. BVerfG, Beschluss vom 14. Oktober 2004 - 2 BvR 1481/04 -, BVerfGE 111, 307, 323ff. - Görgülü.
Der Auffassung des EGMR, dass eine disziplinare Reaktion auf einen Beamtenstreik die EMRK verletzt, hätte der Beklagte Rechnung tragen können und müssen. Zwar war er nach § 17 Abs. 1 LDG NRW gehalten, ein Disziplinarverfahren einzuleiten; denn die Klägerin hatte ein Dienstvergehen begangen. Einer Disziplinarmaßnahme standen auch die §§ 14 und 15 LDG NRW nicht entgegen (§ 17 Abs. 2 LDG NRW). Das Disziplinarverfahren hätte aber nicht zum Erlass der Disziplinarverfügung führen dürfen, sondern nach § 33 Abs. 1 Nr. 4 LDG NRW ein-gestellt werden müssen. Über diese Vorschrift hätte nach ihrem Wortlaut der Auffassung des
- 11 -
EGMR zwanglos Rechnung getragen werden können: Eine Disziplinarmaßnahme war „aus sonstigen Gründen“, nämlich wegen Verstoßes gegen die EMRK, unzulässig.
4. Die Disziplinarkammer teilt nicht die in der mündlichen Verhandlung geäußerte Befürchtung des Beklagten, die Unzulässigkeit der disziplinarischen Ahndung von Verstößen gegen das Streikverbot werde dazu führen, dass Beamte, insbesondere Lehrer, künftig in erheblichem Umfang an Streikmaßnahmen teilnehmen und dadurch die Funktionsfähigkeit des öffentlichen Dienstes gefährden. Zum einen bedeutet die Verpflichtung zur Berücksichtigung der Rechtsprechung des EGMR im Rahmen des § 33 Abs. 1 Nr. 4 LDG NRW nicht, dass eine Streikteilnahme folgenlos bleibt. Denn abgesehen von der möglichen beamtenrechtlichen Rechtsfolge des Verlustes von Dienstbezügen (vgl. § 62 Abs. 2 LBG NRW, § 9 BBesG), über die in diesem Verfahren nicht zu befinden war, muss ein Disziplinarverfahren eingeleitet werden, das - etwa bei Unverhältnismäßigkeit des Streiks - nicht zwangsläufig mit der Einstellung endet. Zum an-deren sind Beamte in besonderer Weise verpflichtet, Verfassung und Gesetze zu befolgen (vgl. § 46 Abs. 1 LBG NRW), unabhängig davon, ob die Nichtbefolgung sanktionsbewehrt ist. Daher muss davon ausgegangen werden, dass sie das verfassungsrechtliche Streikverbot auch dann beachten, wenn ein Verstoß keine Disziplinarmaßnahme nach sich zieht. Welche rechtlichen Konsequenzen sich ergäben, wenn diese Annahme durch die künftige Entwicklung widerlegt werden sollte, bedarf hier keiner Entscheidung. Offen bleiben konnte auch, wie zu entscheiden gewesen wäre, wenn die Klägerin nicht Lehrerin, sondern Angehörige einer der in Art. 11 Abs. 2 Satz 2 EMRK genannten Gruppen von Beamten gewesen wäre (vgl. oben 3a).“
Das beklagte Land hat gegen dieses Urteil, das am 5. Januar 2011 dort zugestellt wurde, am 2. Februar 2011 die vom Verwaltungsgericht zugelassene Berufung eingelegt und trägt zur Begründung vor: Das angefochtene Urteil sei unrichtig. Es verkenne die einfachgesetzliche Rechtslage, kollidiere mit dem Verfassungsrecht des Bundes und sei in seiner völkerrechtlichen Bewertung fehlerhaft. Zutreffend gehe die Kammer zunächst davon aus, dass die Klägerin durch die Teilnahme an den Streiks ein einheitliches Dienstvergehen begangen habe. Rechtsfehlerhaft sei allerdings die Schlussfolgerung, auf dieses Dienstvergehen habe der Dienstherr nicht mit einer Disziplinarverfügung reagieren dürfen, weil eine völkerrechtsfreundliche Auslegung es gebiete, das Disziplinarverfahren einzustellen. Unstreitig habe die Klägerin durch ihr Fernbleiben an den drei Tagen gegen ihre Dienstleistungspflicht verstoßen. Das Recht der Klägerin, ihre Meinung kundzutun, entbinde sie nicht von der Pflicht als Beamtin, während der Dienstzeit ihre dienstlichen Obliegenheiten zu erfüllen. Sie sei nicht befugt gewesen, durch die Teilnahme an Warnstreiks ihre Dienstleistungspflicht zu verletzen. Streik sei ein funktionstypisches Mittel des Arbeitskampfes, das auf den Abschluss von Tarifverträgen gerichtet sei. Die Arbeitsbedingungen der Beamten würden aber nicht durch Tarifvertrag, sondern durch Gesetz geregelt. Die Unzulässigkeit einer Disziplinarmaßnahme trotz vollendeter Dienstpflichtverletzung nach § 33 Abs. 1 Nr. 4 LDG NRW betreffe ausschließlich Fälle fehlerhafter Einleitung oder Durchfüh-
- 12 -
rung des Disziplinarverfahrens, etwa bei Handeln der unzuständigen Behörde, beim Unterlassen erforderlicher Beteiligungen oder Anhörungen oder wenn ein Beamter nicht dem sachlichen Geltungsbereich der Norm unterfalle. Ein solcher Fall liege hier nicht vor. Ein Dienstvergehen, das von vornherein und typischer-weise nicht durch eine Disziplinarmaßnahme geahndet werden dürfe, sei freilich nicht denkbar. Das Verwaltungsgericht verkenne die rechtlichen Konsequenzen der Verfassungslage. Das Streikverbot für Beamte gelte selbst als hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums. Das Beamtenrecht sei von Verfassungs wegen statusbezogen. Eine Differenzierung nach der Art des übertragenen Amtes sehe die Verfassung nicht vor. Die Rechtsansicht des Verwaltungsgerichts mit Blick auf (seine Interpretation des) Art. 11 Abs. 2 EMRK, wonach die Einschränkung des Streikrechts nur bestimmte Beamtenkategorien erfassen dürfe, nicht aber Beamte im Allgemeinen, stehe im Widerspruch zum Verfassungsrecht der Bundesrepublik Deutschland. Die Einfügung des Fortentwicklungsauftrags in Art. 33 Abs. 5 GG durch die Grundgesetznovelle vom 28. August 2006 habe an den geltenden Grundsätzen des Berufsbeamtentums nichts geändert, sondern sie zum Maßstab der Fortentwicklung des öffentlichen Dienstrechts gemacht. Die Zweifel der Kammer, ob das deutsche Beamtenrecht gemessen an den Entscheidungen des EGMR europakonform sei, seien unbegründet. Die zitierten Entscheidungen hätten nicht die Bundesrepublik Deutschland, sondern die Türkei betroffen. Auch seien die Entscheidungen des EMRK nicht auf Deutschland übertragbar. Erstens handele es sich bei den türkischen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes nicht um Personen, deren rechtlicher Status dem des deutschen Beamten entspricht. Zweitens stehe in Deutschland nicht in Zweifel, dass sich neben Arbeitnehmern auch Beamte zu Koalitionen zusammenschließen können. Drittens seien im öffentlichen Dienst der Bundesrepublik Deutschland zwei Arten von Beschäftigten zu unterscheiden. Zum einen die Arbeitnehmer, deren Arbeitsbedingungen der Regelungsbefugnis der Tarifparteien unterliegen, und zum anderen die Beamten, die der Regelungsgewalt des Gesetzgebers unterliegen. Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst würden damit ungeachtet der Frage, ob sie hoheitliche Befugnisse wahrnehmen oder nicht, rein statusbedingte Besonderheiten aufweisen. Dass im Bereich des Schulwesens sowohl Ange-stellte als auch Beamte als Lehrer eingesetzt werden, ändere nichts daran, dass
- 13 -
der Staat selbst das öffentliche Schulwesen gewährleiste. Es sei eine legitime Entscheidung des Landes Lehrer mit ihrem Einverständnis zu verbeamten und dadurch die Berechtigung hoheitlichen Handelns mit dem Status des Lebenszeitbeamten zu verbinden. Die vom Verwaltungsgericht geforderte Klarheit und Bestimmtheit der Abgrenzbarkeit des in Art. 11 Abs. 2 EMRK bezeichneten Personenkreises ergebe sich aus dem Beamtenstatus. Ein darüber hinausgehendes Erfordernis, den Personenkreis so eng wie möglich zu halten, sei Art. 11 EMRK nicht zu entnehmen. Der Vertragsstaat selbst habe hier eine Entscheidungsprärogative. Zu bedenken sei, dass Lehrerinnen und Lehrer nicht verpflichtet seien, sich verbeamten zu lassen. Der Erwerb des Beamtenstatus erfolge auf eigenen Antrag, ihm gehe stets eine individuelle Entscheidung des Beschäftigten voraus. Die vom Verwaltungsgericht geprüfte Frage, ob die der Klägerin vorgeworfene Teilnahme an Warnstreiks verhältnismäßig war, sei für das Verfahren ohne Belang. Insbesondere sei unerheblich, ob nach der Rechtsprechung des BAG Arbeitnehmern Warnstreiks erlaubt sind. Entscheidend sei, dass der Klägerin als Beamtin die Teilnahme an jeglichem Streik untersagt gewesen sei. Dies allein berechtige zur disziplinarischen Ahndung. Die Einschätzung des Verwaltungsgerichts, die Unzulässigkeit einer disziplinarischen Ahndung von Verstößen gegen das Streikverbot werde nicht dazu führen, dass Beamte (Lehrer) künftig in erheblichem Umfang an Streikmaßnahmen teilnehmen, sei zum einen nicht entscheidungserheblich, zum anderen in der Sache aber auch unzutreffend. Das Gegenteil ergäbe sich insbesondere aus Äußerungen einer Vertreterin der GEW in der Rheinischen Post vom 15. Dezember 2010. Die vom Verwaltungsgericht verfügte Sanktionslosigkeit der Rechtsverletzung werde mithin bereits gezielt in die gewerkschaftliche Arbeitskampfstrategie einbezogen.
Das beklagte Land beantragt,
das angefochtene Urteil zu ändern und die Klage abzuweisen.
Die Klägerin beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
- 14 -
Sie verteidigt das angefochtene Urteil und führt im Wesentlichen aus: Wenn man unterstelle, die vom beklagten Land verhängte Disziplinarmaßnahme würde gerichtlich bestätigt, hätte dies zur Folge, dass der EGMR später feststellen würde, dass die Bundesrepublik Deutschland gegen die EMRK verstoßen hätte und ihr - der Klägerin - evtl. wie im Fall D. . /. Türkei (Urteil v. 13. Juli 2010 – 33322/07) eine Entschädigung für den entstandenen immateriellen Schaden - wie
im Fall D1. i.H.v. 1.800 Euro - zugesprochen werde. Hinzuweisen sei in diesem Zusammenhang noch auf Art. 6 Abs. 2 des Vertrages über die Europäische Union vom 13. Dezember 2007, in dem bestimmt sei, dass die Union der EMRK beitrete. Wenn dieser Beitritt vollzogen ist, werde zu berücksichtigen sein, dass Unionsrecht grundsätzlich Vorrang vor nationalem Recht habe und ein aus dem Grundgesetz abzuleitendes Streikverbot nur ins Feld geführt werden könnte, wenn der unantastbare Kerngehalt der Verfassungsidentität in Frage gestellt wäre. Auch wenn die EMRK zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf der Ebene einfachen Gesetzesrechts (allerdings erheblich aufgewertet durch das Gebot völkerrechtsfreundlicher Auslegung) angesiedelt sei, wäre es bedenklich, wenn die Rechtsprechung sich jetzt in eine Position begäbe, die sich nach Übernahme der EMRK als Unionsrecht als nur schwer korrigierbarer Irrweg darstellen würde. Der EGMR habe in seiner Entscheidung vom 12. November 2008 – 34503/97 – ausdrücklich zwischen Beamten („civil servants“) und Arbeitnehmern („contractual employeers“) unterschieden. Während die türkische Regierung - wie im vorliegenden Fall das beklagte Land - auf den Status der Beschäftigten abgestellt habe, habe der EGMR auf die wahrgenommene Funktion abgestellt. Auch dann wenn nicht hoheitlich tätige Beschäftigte formal denselben Status haben wie Polizisten oder besondere Personen der Staatsverwaltung, könne ihnen das Streikrecht nicht vorenthalten werden. Die Entscheidung des EGMR in dem Verfahren L1. und T1. . /. Türkei betreffe beamtete Lehrkräfte, deren Teilnahme an einem nationalen Aktionstag mit einer disziplinarischen Verwarnung belegt worden sei. Ein signifikanter Unterschied zur vorliegend zu beurteilenden Teilnahme an Warnstreiks sei nicht erkennbar. Der EGMR stelle entscheidend auf die Funktion des Beamten und nicht auf dessen Status ab. Beamtete Lehrkräfte würden in Nordrhein-Westfalen kaum hoheitliche Tätigkeiten ausüben. Die Zeugnisse würden nicht durch die Lehrer, sondern durch den Schulleiter unterschrieben. Zu-
- 15 -
ständig für Versetzungsentscheidungen sei die Klassen- und Jahrgangsstufenkonferenz. Einzelbewertungen, wie Klassenarbeiten und Vorzensuren, seien lediglich unselbständige Verfahrenshandlungen, die die eigentliche Entscheidung nur vorbereiten. Auch die Entscheidung über die Schulaufnahme liege nicht in den Händen der Lehrkräfte, sondern bei der Schulleitung. Die EMRK sei als Auslegungshilfe für die Bestimmungen des Grundgesetzes heranzuziehen. Die Besonderheit liege darin, dass die EMRK interpretativ auf die Grundrechte einwirke, mithin die Änderung bisheriger Auslegungen einzelner Artikel bewirken könne. Die Grenze einer völkerrechtsfreundlichen Auslegung sei sehr weit gezogen. Ein Streikverbot sei für Beamte einfachgesetzlich nicht geregelt. Verfassungsrechtlich sei das Streikverbot kein hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums. Es handele sich hierbei allein um ein Produkt der Exekutive, über das der Reichstag nie abgestimmt habe. Im Übrigen sei es nicht zwingend, dass die Voraussetzungen für einen rechtmäßigen Streik, die jahrzehntelang durch Richterrecht entwickelt und fortentwickelt worden seien, im Verhältnis „eins zu eins“ auf den Beamtenbereich übertragen werden. Vielmehr bedürfe es auch in diesem Fall einer Entwicklung in Literatur und Rechtsprechung, die möglicherweise zu eigenen Regeln für den Beamtenstreik führen oder zumindest Abweichungen und Besonderheiten, die dem Status der Beamten und seinen gesetzlichen und rechtlichen Gegebenheiten Rechnung tragen, zulassen. Durch den Einfluss europäischen Unionsrechts sei das Beamtenrecht bereits erheblich transformiert worden. So werde bei Arbeitnehmerschutzrechten nicht mehr zwischen „normalen“ Arbeitnehmern und Beamten differenziert. Spätestens seit der Entscheidung des EuGH vom 2. Oktober 1997 - Rs C-1/95 - sei klargestellt, dass Beamte Arbeitnehmer im Sinne des EU-Rechts seien. Die daraus resultierenden vielfältigen Neuerungen, gegen die sich Teile der Verwaltungsgerichtsbarkeit lange Zeit erheblich gesträubt hätten, seien in das Beamtenrecht integriert worden, ohne dieses grundsätzlich in Frage zu stellen. Entsprechendes dürfte für die hier zur Entscheidung stehende Frage gelten.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts im Übrigen wird auf den Inhalt der Gerichtsakte sowie die in dem Sitzungsprotokoll im einzelnen bezeichneten Beiakten, wie sie dem Senat vorgelegen haben, Bezug genommen.
- 16 -
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :
Die zulässige Berufung des beklagten Landes ist begründet.
Die Disziplinarkammer hat zu Unrecht die Disziplinarverfügung der Bezirksregierung L. vom 10. Mai 2010 aufgehoben. Die angefochtene Disziplinarverfügung ist rechtmäßig und verletzt die Klägerin nicht in ihren Rechten (§ 3 Abs. 1 LDG NRW i.V.m. § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO).
A. Der erkennende Senat trifft hinsichtlich der im Berufungsverfahren erforderlichen Tatsachenfeststellungen die gleichen Feststellungen wie bereits die Disziplinarkammer und verweist insoweit zunächst auf die auf S. 2 bis 3 des Urteilsabdrucks dargestellten und im Wesentlichen auch oben im Tatbestand wiedergegebenen Entscheidungsgründe des angefochtenen Urteils.
Dieser Sachverhalt ist auch zwischen den Beteiligten unstreitig. Danach hat die Klägerin am 28. Januar, 5. und 10. Februar 2009 ohne Genehmigung ihres Dienstherrn während ihrer Unterrichts- und Dienstzeit an von der GEW organisierten Warnstreiks teilgenommen. Der Teilnahme an diesen Warnstreiks ging jeweils ein Gespräch der Klägerin mit der Konrektorin der Schule am 23. Januar 2009 sowie mit der Schulleiterin am 26. Januar 2009 voraus. Mit Schreiben vom 9. Februar 2009 teilte die Schulleiterin der Klägerin mit, dass ihr als Beamtin kein Streikrecht zustehe und aus diesen Gründen auch der Bitte um eine Unterrichtsfreistellung für den 10. Februar 2009 nicht nachgekommen werden könne.
B. Die Klägerin hat durch die ungenehmigte Teilnahme an den Warnstreiks während ihrer Dienstzeit ein einheitliches innerdienstliches Dienstvergehen begangen i.S.d. §§ 83 Abs. 1 Satz 1 u. 2 i.V.m. §§ 57 Satz 1 u. 3, 58 Satz 2, 79 Abs. 1 Satz 1 LBG NRW in der bis zum 31. März 2009 geltenden Fassung (LBG NRW a.F.). Dieses Dienstvergehen der Klägerin ist von der Bezirksregierung L. zu Recht mit der hier streitgegenständlichen Disziplinarverfügung vom 10. Mai 2010 mit einer Geldbuße in Höhe von 1.500,00 Euro geahndet worden.
- 17 -
I. Maßgeblich ist im vorliegenden Fall die Rechtslage zum Tatzeitpunkt, weil sich aus dem Inkrafttreten des Beamtenstatusgesetzes vom 17. Juni 2009 - BeamtStG - (BGBl. S. 1010) am 1. April 2009 kein materiellrechtlich günstigeres Recht ergibt.
Vgl. BVerwG, Urteile vom 19. August 2010 - 2 C 5.10 -, NVwZ 2011, 303, vom 25. März 2010 - 2 C 83.08 -, BVerwGE 136, 173, und vom 25. Au¬gust 2009 - 1 D 1.08 -, Buchholz 232.0 § 77 BBG 2009 Nr. 1; OVG NRW, Urteile vom 7. September 2011 - 3d A 1489/09.O - und vom 16. Februar 2011 - 3d A 331/10.O -.
Nach § 83 Abs. 1 Satz 1 LBG NRW a.F. (jetzt § 47 BeamtStG) begeht ein Beamter ein Dienstvergehen, wenn er schuldhaft seine Pflichten verletzt.
II. Die Klägerin hat durch ihre ungenehmigte Teilnahme an den Streiks gleich in vierfacher Hinsicht gegen die ihr obliegenden Dienstpflichten verstoßen. Welche Pflichten der Beamte zu beachten hat, ergibt sich aus dem konkreten Pflichtentatbestand, der in den Beamtengesetzen, einer allgemeinen Verwaltungsregelung oder in einer Einzelanweisung enthalten sein kann.
1. Durch die ungenehmigte Teilnahme an den Streiks hat die Klägerin gegen die ihr obliegende Dienstpflicht verstoßen, sich mit voller Hingabe ihrem Beruf zu widmen (§ 57 Satz 1 LBG NRW a.F., jetzt § 34 Satz 1 BeamtStG). Der Beamte hat dem Dienstherrn seine volle Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen. Dabei hat der Beamte seine körperliche und geistige Leistungsfähigkeit voll einzubringen und die Dienstaufgaben engagiert zu erfüllen.
Vgl. Nds. OVG, Urteile vom 7. Dezember 2010 – 20 LD 3/09 -, DÖV 2011, 243, und vom 18. Mai 2010 - 20 LD 13/08 -, DVBl. 2010, 927.
Dieser Pflicht ist die Klägerin nicht nachgekommen, indem sie an drei Tagen ohne Genehmigung dem Dienst ferngeblieben ist und gegenüber den ihr anvertrauten Schülern keinen Schulunterricht erteilt hat.
2. Zugleich hat die Klägerin durch die ungenehmigte Streikteilnahme ihre Pflicht zu achtungs- und vertrauenswürdigen Verhalten (§ 57 Satz 3 LBG NRW a.F.,
- 18 -
jetzt § 34 Satz 3 BeamtStG) verletzt. Zu den Dienstpflichten eines Lehrers - der wie hier nicht durch seinen Dienstherrn von seiner Unterrichtsverpflichtung befreit ist - gehören angesichts des umfassenden Bildungsauftrags der Schule (§ 2 SchulG NRW) der Unterricht, die Erziehung und Betreuung der ihm anvertrauten Schüler unter Beachtung der Elternrechte. Der Lehrer trägt die unmittelbare pädagogische Verantwortung für den Unterricht und die Erziehung der Schüler (§ 57 Abs. 1 SchulG NRW). Der Lehrer soll die Schüler mit dem geltenden Wertesystem und den Moralvorstellungen der Gesellschaft bekannt machen und sie zu deren Einhaltung anhalten. Damit der Erziehungsauftrag erfüllt werden kann, ist von einem Lehrer besondere Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit zu verlangen.
Vgl. OVG NRW, Urteil vom 16. Februar 2011 - 3d A 331/10.O -; Nds. OVG, Urteile vom 7. Dezember 2010 - 20 LD 3/09 -, a. a. O., und vom 22. Juni 2010 - 20 LD 3/08 -, juris.
Diesen Anforderungen ist die Klägerin nicht nachgekommen, indem sie ohne Genehmigung dem Unterricht fernblieb und sich auch nicht darum gekümmert hat, ob der Unterricht von anderen Lehrern übernommen werden konnte oder ob die Pflichtstunden zum Nachteil der ihr anvertrauten Schüler ausfallen mussten. Ein derartiges Verhalten ist mit dem Erziehungsauftrag eines beamteten Lehrers und dem beamtenrechtlichen Selbstverständnis nicht vereinbar. Die Klägerin hat durch ihr Verhalten nicht die besondere Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit offenbart, die für die Erfüllung des Erziehungsauftrags der ihr anvertrauten Schülerinnen und Schüler unbedingt erforderlich ist.
3. Ferner hat die Klägerin durch die ungenehmigte Teilnahme an den Streiks gegen ihre Dienstpflicht verstoßen, nicht ohne Genehmigung dem Dienst fernzubleiben (§ 79 Abs. 1 Satz 1 LBG NRW a.F.). Ein Beamter bleibt dem Dienst im Sinne dieser Regelung fern, wenn er seiner in zeitlicher und örtlicher Hinsicht konkretisierten Dienstleistungspflicht nicht Rechnung trägt und zu der vorgegebenen Zeit nicht am Ort seiner dienstlichen Tätigkeit erscheint. Dieser Vorschrift liegt - ebenso wie § 9 Abs. 1 BBesG - die formale Pflicht zum Dienstantritt am Dienstort zugrunde, d.h. die Pflicht, „wenigstens zum Dienst zu erscheinen“.
- 19 -
Vgl. BVerwG, Urteil vom 12. Dezember 1979 - 1 D 108.78 -, BVerwGE 63, 315.
Die Dienstpflicht der Klägerin als Lehrerin ergab sich zum Zeitpunkt ihre Teilnahme an den Warnstreiks im Jahr 2009 in zeitlicher und örtlicher Hinsicht aus den §§ 1 und 2 der VO zu § 93 Abs. 2 SchulG vom 18. März 2005 (GV. NRW. S. 218) in der Fassung vom 30. April 2008 (GV. NRW. S. 400) und wurde konkretisiert durch den von der Schulleitung festgesetzten Wochenstundenplan. Die Klägerin, die ohne Genehmigung an den drei Warnstreiks teilgenommen hat und insoweit ihrer konkretisierten Unterrichtsverpflichtung an diesen drei Tagen nicht nachgekommen ist, hat damit gegen ihre Dienstleistungspflicht verstoßen. Das gilt auch dann, wenn - wie hier - zumindest teilweise für eine anderweitige Betreuung der Schüler durch die Schulleitung gesorgt werden konnte, denn dies ändert nichts an der dem Lehrer obliegenden höchstpersönlichen Verpflichtung, den nach dem Stundenplan vorgesehenen Unterricht zu erteilen oder zumindest anzubieten. Ein Beamter darf über seine persönliche Dienstleistungspflicht weder nach eigenem Gutdünken disponieren noch darf er als Lehrer eigenmächtig die durch den Stundenplan festgelegten Dienstzeiten ändern.
4. Die Klägerin hat ferner durch ihre ungenehmigte Streikteilnahme gegen ihre Gehorsamspflicht (§ 58 Satz 2 LBG a.F., jetzt § 35 Satz 2 BeamtStG) verstoßen. Sowohl im Gespräch mit der Konrektorin der Schule am 23. Januar 2009 und der Schulleiterin am 26. Januar 2009 ist sie darauf hingewiesen worden, dass sie an den Warnstreiks nicht teilnehmen darf. Gleichwohl nahm die Klägerin an den Warnstreiks am 28. Januar 2009 und 5. Februar 2009 teil. Mit Schreiben vom 9. Februar 2009 teilte die Schulleiterin der Klägerin nochmals mit, dass sie für die Teilnahme an dem Warnstreik am 10. Februar 2009 nicht von ihrer Unterrichtsverpflichtung freigestellt wird. Entgegen dieser Anordnung nahm die Klägerin gleichwohl auch an diesem Warnstreik teil und kam auch insoweit ihrer Unterrichtsverpflichtung und ihrer Gehorsamspflicht nicht nach.
III. Die Klägerin hat vorsätzlich gegen die vorstehend dargestellten Dienstpflichten verstoßen. Zum einen handelt es sich bei diesen Dienstpflichten um beamtenrechtliche Kernpflichten, die ohne Weiteres für einen Beamten und die Kläge-
- 20 -
rin als Lehrerin einzusehen waren. Zum anderen ist der Klägerin im Vorfeld der Streiks durch die Gespräche mit der Konrektorin und der Schulleiterin sowie das Schreiben vom 9. Februar 2009 hinreichend deutlich klargemacht worden, dass sie für die Teilnahme an den Warnstreiks nicht vom Unterricht freigestellt wird. Hierüber hat sich die Klägerin bewusst und gewollt hinweggesetzt. Ihre Behauptung, es sei nicht - auch nicht mittelbar - ihre Zielsetzung gewesen, dass es zu Unterrichtsausfall komme, ändert daran nichts. Die Klägerin hat sich hier nicht außerhalb der Unterrichtszeiten (z.B. nach Unterrichtsende oder in den Ferien) an entsprechenden Aktionen der GEW oder anderer Vereinigungen beteiligt, sondern während der Unterrichtszeit, um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, so dass ihr bewusst war, dass sich ihr (ungenehmigtes) Verhalten auf den von ihr abzuleistenden Unterricht auswirkte. Sie musste damit rechnen, dass nicht sämtliche Unterrichtsstunden durch andere Lehrer aufgefangen werden konnten, die ihrerseits ihrer Dienst- und Unterrichtspflicht nachkamen. Dies hat die Klägerin durch ihre ungenehmigte Streikteilnahme an drei Tagen letztlich in Kauf genommen.
IV. Die Arbeitsniederlegung der Klägerin wegen der Teilnahme an den Warnstreiks am 28. Januar 2009, 5. Februar 2009 und 10. Februar 2009 war weder verfassungsrechtlich (1.) noch völker- und europarechtlich (2.) und auch nicht mit Blick auf § 103 LBG a.F. (3.) gerechtfertigt.
1. Die in Art. 9 Abs. 3 GG normierte Koalitionsfreiheit begründet für Beamte in der Bundesrepublik Deutschland kein Streikrecht (a.). Die Koalitionsfreiheit wird hinsichtlich der Beamten in der Bundesrepublik Deutschland durch die in Art. 33 Abs. 5 GG verankerten beamtenrechtlichen Strukturprinzipien eingeschränkt (b.).
a. Beamte sind - wie alle anderen Bürger auch - Grundrechtsträger. Der persönliche Anwendungsbereich des Art. 9 Abs. 3 GG ist nicht eingeschränkt, so dass auch den Beamten die in dieser Verfassungsnorm verankerte Koalitionsfreiheit im Grundsatz zusteht.
Vgl. BVerfG, Entscheidung vom 30. November 1965 - 2 BvR 54/62 -, BVerfGE 19, 303; Kutzki, Beamte und Streikrecht - eine aktuelle Bestands-
- 21 -
aufnahme, DÖD 2011, 169; Gooren, Das Ende des Beamtenstreikverbots, ZBR 2011, 400 (401).
Art. 9 Abs. 3 GG schützt den Einzelnen in seiner Freiheit, eine Vereinigung zur Wahrung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen zu gründen, ihr beizutreten oder fernzubleiben oder sie zu verlassen. Geschützt ist auch die Koalition selbst in ihrem Bestand, ihrer organisatorischen Ausgestaltung und ihren Betätigungen, sofern diese der Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen dienen.
Vgl. BVerfG, Beschlüsse vom 3. April 2001 - 1 BvL 32/97 -, BVerfGE 103, 293, und vom 27. Ap-ril 1999 - 1 BvR 2203/93 u.a. -, BVerfGE 100, 27; Urteil vom 10. Januar 1995 - 1 BvF 1/90 u.a. -, BVerfGE 92, 26.
Beamte können sich insoweit wie ihre Kolleginnen und Kollegen im privatrechtlich geregelten Arbeitnehmerbereich gewerkschaftlich organisieren. Dies wird von Niemandem in Frage gestellt und Beamte organisieren sich auch in Deutschland in einer Vielzahl von berufsständischen Vereinigungen (vgl. z.B. BDR, BDZ, BLBS, dbb, DPolG, DSTG, GdP, GdV, VDR, VBB etc.). Die Klägerin selbst hat sich im vorliegenden Fall der GEW angeschlossen.
Der Schutz der Koalitionsfreiheit ist nicht von vornherein auf einen Kernbereich koalitionsmäßiger Betätigung beschränkt, die für die Sicherung des Bestands der Koalitionen unerlässlich sind. Er erstreckt sich vielmehr auf alle koalitionsspezifischen Verhaltensweisen,
vgl. BVerfG, Beschlüsse vom 11. Juli 2006 - 1 BvL 4/00 -, BVerfGE 116, 202, vom 24. April 1996 - 1 BvR 712/86 -, BVerfGE 94, 268, und vom 14. November 1995 - 1 BvR 601/92 -, BVerfGE 93, 352,
und beinhaltet nach höchstrichterlicher Rechtsprechung und nach allgemeiner Ansicht,
vgl. BVerfG, Beschluss vom 2. März 1993 - 1 BvR 1213/85 -, BVerfGE 88, 103; Scholz, in Maunz/Dürig, Grundgesetz Kommentar, Art. 9 Rdnr. 309,
- 22 -
auch das Recht zur Führung von Arbeitskämpfen (insbesondere Streikmaßnahmen).
b. Aus den vorstehenden Grundsätzen folgt indes noch nicht, dass sich auch Beamte - wie hier die Klägerin - auf ein Streikrecht berufen können. Die in Art. 9 Abs. 3 GG garantierte Koalitionsfreiheit unterliegt, obwohl sie ohne Gesetzesvor-behalt gewährleistet ist, verfassungsimmanenten Beschränkungen zum Schutz von Rechtsgütern und Gemeinwohlbelangen, denen im gleichen Maße verfassungsrechtlicher Rang gebührt.
Vgl. BVerfG, Beschlüsse vom 6. Februar 2007 - 1 BvR 978/05 -, NZA 2007, 394, und vom 26. Juni 1991 - 1 BvR 779/85 -, BVerfGE 84, 212.
Die kollidierenden Verfassungsrechte sind in ihrer Wechselwirkung zu erfassen und im Wege der praktischen Konkordanz so zu begrenzen, dass sie für alle Beteiligten möglichst weitgehend wirksam werden. Die Grenzen zulässiger Beeinträchtigungen sind überschritten, soweit einschränkende Auslegungen und Regelungen nicht zum Schutz anderer gleichrangiger Rechtsgüter von der Sache her geboten sind.
Vgl. BVerfG, Beschlüsse vom 6. Februar 2007 - 1 BvR 978/05 -, a. a. O., vom 27. Januar 1998 - 1 BvL 15/87 -, BVerfGE 97, 169, und vom 26. Juni 1991 - 1 BvR 779/85 -, a. a. O.
Vor diesem Hintergrund wird die Koalitionsfreiheit der Beamten in der Bundesrepublik Deutschland durch die ebenfalls mit Verfassungsrang - in Art. 33 Abs. 5 GG - verankerten beamtenrechtlichen Strukturprinzipien geprägt und eingeschränkt. Nach Maßgabe des Art. 33 Abs. 5 GG ist das Recht des öffentlichen Dienstes unter Berücksichtigung der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums zu regeln und fortzuentwickeln. Art. 33 Abs. 5 GG ist unmittelbar geltendes Recht und enthält einen Regelungsauftrag an den Gesetzgeber sowie eine institutionelle Garantie des Berufsbeamtentums. Unter den „hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums“ i.S.d. Verfassungsnorm ist der Kernbestand von Strukturprinzipien zu verstehen, die allgemein oder doch ganz überwiegend während eines längeren traditionsbildenden Zeitraums, mindestens un-
- 23 -
ter der Reichsverfassung von Weimar, als verbindlich anerkannt und gewahrt worden sind.
Vgl. BVerfG, Urteil vom 6. März 2007 - 2 BvR 556/04 -, BVerfGE 117, 330; Beschlüsse vom 7. November 2002 - 2 BvR 1053/98 -, BVerfGE 106, 225, und vom 13. November 1990 - 2 BvF 3/88 -, BVerfGE 83, 89.
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts,
vgl. BVerfG, Beschlüsse vom 19. September 2007 - 2 BvF 3/02 -, BVerfGE 119, 247, vom 30. März 1977 - 2 BvR 1039/75 u.a. -, BVerfGE 44, 249, und vom 11. Juni 1958 - 1 BvR 1/52 u.a. -, BVerfGE 8, 1,
und des Bundesverwaltungsgerichts,
vgl. BVerwG, Urteile vom 23. Februar 1994 - 1 D 65.91 -, BVerwGE 103, 70, - 1 D 48.92 -, DokBer B 1994, 231, vom 10. Mai 1984 - 2 C 18.82 -, BVerwGE 69, 20, vom 3. Dezember 1980 - 1 D 86.79 -, BVerwGE 73, 97, vom 22. November 1979 - 1 D 84.78 -, BVerwGE 63, 293, und vom 16. November 1978 - 1 D 82.77 -, BVerwGE 63, 158; Beschluss vom 19. September 1977 - 1 DB 12.77 -, BVerwGE 53, 330,
sowie einer Vielzahl von Obergerichten,
vgl. OVG NRW, Urteil vom 10. September 2007 - 1 A 3529/06 -, juris; Hamburgisches OVG, Be-schluss vom 22. Oktober 1988 - Bs I 195/88 -, DÖV 1989, 127; OVG Berlin, Urteil vom 18. Feb-ruar 1986 - D 16.85 -, Die Personalvertretung 1986, 283,
ist die Unzulässigkeit des Beamtenstreiks - auch in Form von „Warnstreiks“, der gezielten Verlangsamung der Arbeitsleistung („go-slow“), Dienst nach Vorschrift (work-to-rule“), der unberechtigten Krankmeldungen („sick-out“) etc. und ungeachtet ihrer Dauer - als hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums verfassungsrechtlich bestimmt.
- 24 -
Das Streikverbot für Beamte als hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums hat zum einen historische Wurzeln (aa.), beruht zum anderen auf grundlegend systemimmanenten dienstrechtlichen Unterschieden zwischen privatrechtlich geregelten Angestelltenverhältnissen und dem öffentlich-rechtlich geregelten Dienstverhältnis der Beamten (bb.) und ist zudem in der Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Staates (cc.) begründet.
aa. Die hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums und mithin die Institution des deutschen Berufsbeamtentums werden durch Art. 33 Abs. 5 GG nicht um ihrer selbst willen geschützt. Die Verfassungsbestimmung konserviert nicht „das Gestrige“, sondern übernimmt nur die tradierten und funktionswesentlichen Grundstrukturen des Berufsbeamtentums. Der Parlamentarische Rat verstand das Berufsbeamtentum insoweit als ein Instrument zur Sicherung von Rechtsstaat und Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Hierfür erschien ihm ein auf Sachwissen gegründeter, unabhängiger Beamtenapparat, der die Funktionsfähigkeit des Staates sicherstellt, unerlässlich. Die Entwicklung des Berufsbeamtentums ist historisch eng mit derjenigen des Rechtsstaats verbunden. War der Beamte ursprünglich als sog. „Fürstendiener“ allein dem Regenten verpflichtet,
vgl. Brakensiek, Fürstendiener, Staatsbeamte, Bürger, 1999, S. 18, 49, 159, 440, im Internet allgemein zugänglich unter:
http://books.google.de/books?id=xZArNL-o724C&printsec=frontcover&hl=de& sour-ce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=snippet&q=Beamte&f=false,
so veränderten sich unter dem Einfluss der Ideen der Französischen Revolution und der napoleonischen Fremdherrschaft im 18. und 19. Jahrhundert die politischen Strukturen und der Beamte wandelte sich zum „Staatsdiener“. Von diesem Verständnis ging auch das „Allgemeine Landrecht für die Preußischen Staaten“ vom 5. Februar 1794 in den §§ 68 ff. unter „Zehnter Titel. Von den Rechten und Pflichten der Diener des Staats“ in bezug auf die „Civilbeamten“ aus.
Vgl. Textabdruck des ALR im Internet allgemein zugänglich unter: http://www.smixx.de/ra/Links_FR/PrALR/PrALR_II_10.pdf
- 25 -
Bayern folgte diesen Ansätzen, indem es im Jahr 1805 als erster deutscher Staat die Rechte der Beamten durch eine Dienstpragmatik sicherte und die Eingriff-möglichkeiten der Krone einschränkte.
Vgl. Krauss, Herrschaftspraxis in Bayern und Preussen im 19. Jahrhundert, 1997, S. 189, im Internet allgemein zugänglich unter: http://books.google.de/books?id=xnX80Q8NiSQ C&pg=PA189&lpg=PA189&dq=Bayern+Dienst-pragmatik+1805+Beamte&source=bl&ots=-ggXY9QBdl&sig=O7_dkju0s_TNI9P7Au_O1K_O n6A&hl=de#.
In der bayerischen Verfassung vom 26. Mai 1818 wurden diese Beamtenrechte unter § 6 „Titel V. Von Besondern Rechten und Vorzügen“ unter Bezugnahme auf das Edict über die Verhältnisse der Staatsdiener (Beilage IX. zur Verfassungsurkunde) erneut bekräftigt.
Vgl. im Internet allgemein zugänglich unter: http://www.verfassungen.de/de/by/bayern18-in-dex.htm.
Gemäß § 1 des Edicts über die Verhältnisse der Staatsdiener wurde der Beamte ausdrücklich als „Staats“diener bezeichnet, dessen Stand durch das „Anstellungs-Rescript“ erworben wird. Entsprechende Regelungen enthielt auch das Gesetz betreffend die Rechtsverhältnisse der Reichsbeamten vom 31. März 1873,
ReichsGesetzbl. 1873, S. 61, auch im Internet allgemeinzugänglich unter: http://www.documentarchiv.de/ksr/1873/reichs-beamte-rechtverhaeltnisse_ges.html, entsprechendes galt für das Reichsbeamtengesetz i.d.F. der Bekanntmachung vom 18. Mai 1907 (Reichs-Gesetzbl. 1907, S. 245) und der F.v. 21. Juli 1922 (Reichs-Gesetzbl. I 1922, S. 590),
- Reichsbeamtengesetz, im folgenden RBeamtG -. Nach § 4 RBeamtG erhielt der Reichsbeamte eine Anstellungs-Urkunde und nach § 3 RBeamtG war jeder Reichsbeamte auf die Erfüllung aller Obliegenheiten des ihm übertragenen Amtes eidlich zu verpflichten. Das Reichsbeamtengesetz enthielt in den §§ 5 ff. Re-
- 26 -
gelungen zu den Einkünften, in den §§ 55 f. zur Pension, in den §§ 61 ff. zur zwangsweisen Versetzung in den Ruhestand und in den §§ 80 ff. zu Disziplinarverfahren. In § 13 RBeamtG wurde ausdrücklich ausgeführt, dass jeder Reichsbeamte für die Gesetzmäßigkeit seiner amtlichen Handlungen verantwortlich ist.
Bereits im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts war damit die Treuepflicht des Beamten und die Ausgestaltung einer grundsätzlich auf Lebenszeit ausgerichteten Tätigkeit, die durch einen besonderen förmlichen Akt (i.d.R. einer Ernennung) übertragen wird, ein Grundprinzip des Beamtenrechts. Auch die Besoldung des Beamten sah man bereits in dieser Zeit nicht als Leistungsentgelt, sondern als Unterhalt an. Man besoldete den Inhaber einer bestimmten Rangstufe, und das in der Höhe, die für eine standesgemäße Lebensführung angemessen war. Im Volksmund war die Rede vom „sicheren Brot“.
Vgl. Henning, Die deutsche Beamtenschaft im 19. Jahrhundert, 1984, S. 24, im Internet allgemein zugänglich unter: http://books.google.de/books?ei=r_w5T57TKYrlt QaW8eXYBg&hl=de&id=sQVLAQAAIAAJ&dq=b eamtenrecht+sichere+brot+19.+jahrhundert&q=B rot+.
Historisch findet sich bereits hier die Grundlage des beamtenrechtlichen Alimentationsprinzips, wonach die Dienst- und Versorgungsbezüge des Beamten so zu bemessen sind, dass sie einen je nach Dienstrang, Bedeutung und Verantwortung des Amtes und entsprechenden Entwicklung der Verhältnisse angemessenen Lebensunterhalt gewähren und als Voraussetzung dafür genügen, dass sich der Beamte ganz dem öffentlichen Dienst als Lebensberuf widmen und in wirtschaftlicher Unabhängigkeit zur Erfüllung der dem Berufsbeamtentum von der Verfassung und den Gesetzen zugewiesenen Aufgabe im politischen Kräftespiel eine stabile, gesetzestreue Verwaltung zu sichern, beitragen kann.
Vgl. zum Inhalt des Alimentationsprinzip: BVerfG, Beschluss vom 30. März 1977 - 2 BvR 1039/75 -, a. a. O.
Die Aufgabe des Beamten war (und ist es auch heute), Verfassung und Gesetze im Interesse des Bürgers umzusetzen. Die Alimentation und die Anstellung auf
- 27 -
Lebenszeit bieten insoweit die hinreichende persönliche Unabhängigkeit und stehen seit jeher in einem synallagmatischen Verhältnis zur Treuepflicht des Beamten.
Der Wesensinhalt dieser beamtenrechtlichen Grundzüge ist zur Zeit der Weimarer Verfassung erhalten und weiter konkretisiert worden. Art. 129 Satz 3 der Verfassung des deutschen Reichs vom 19. Juli 1919 - am 11. August 1919 ausgefertigt und am 14. August 1919 in Kraft getreten (im Folgenden Weimarer Reichsverfassung - WRV -) -,
vgl. im Internet allgemein zugänglich unter:
http://www.dhm.de/lemo/html/dokumente/verfas-sung/index.html,
bestimmte, dass die wohlerworbenen Rechte der Beamten unverletzlich sind. Art. 129 Satz 1 WRV regelte, dass die Anstellung der Beamten auf Lebenszeit erfolgt. Art. 130 Satz 1 WRV beinhaltete die Regelung, dass Beamte Diener der Gesamtheit und nicht einer Partei sind. In Art. 130 Satz 2 WRV war bestimmt, dass den Beamten die Freiheit ihrer politischen Gesinnung und die Vereinigungsfreiheit gewährleistet wird. Der Rat der Volksbeauftragten - die Übergangsregierung des Deutschen Reichs vom 10. November 1918 bis zum 11. Februar 1919 - verkündete in seinem Aufruf an das deutsche Volk vom 12. November 1918 mit Gesetzeskraft unter Ziff. 2 folgendes: „Das Vereins- und Versammlungsrecht unterliegt keiner Beschränkung, auch nicht für Beamte und Staatsarbeiter“.
Vgl. Aufruf des Rates der Volksbeauftragten vom 12. November 1918, in: Reichs-Gesetzbl. 1918, 1303.
In der Kabinettssitzung der Reichsregierung vom 11. April 1919 führte Reichsminister Gothein aus, dass „seines Erachtens die Koalitionsfreiheit nicht notwendig das Streikrecht in sich schließe. Die Beamten seien lebenslänglich angestellt und könnten daher kein Streikrecht haben, ebensowenig wie ihnen gegenüber ein Aussperrungsrecht bestehe“. Reichsminister Schiffer stimmte zu und führte aus, eine von Preußen abweichende Stellungnahme des Reichs sei übrigens gar nicht möglich.
- 28 -
Vgl. Akten der Reichskanzlei. Weimarer Republik zum Thema Streikrecht der Beamten, im Internet allgemein zugänglich unter: http://www.bundesarchiv.de/aktenreichskanzlei/1 919-1933/0000/sch/sch1p/kap1_2/kap2_43/ para3_1.html#d8e45.
Im Zuge des Eisenbahnerstreiks im Jahr 1922 verbot der Reichspräsident mit einer auf Art. 48 Abs. 2 WRV gestützten Notverordnung vom 1. Februar 1922,
vgl. Verordnung des Reichspräsidenten, betreffend Verbot der Arbeitsniederlegung durch Beamte der Reichsbahn vom 1. Februar 1922, in Reichs-Gesetzbl. 1922, 187; auch im Internet allgemein zugänglich abrufbar unter: http://www.documentarchiv.de/da/fs-notverord-nungen_reichspraesident.html,
die Arbeitsniederlegung. In § 1 Abs. 1 dieser Verordnung ist ausgeführt:
„Den Beamten der Reichsbahn ist ebenso wie allen übrigen Beamten nach dem geltenden Beamtenrechte die Einstellung oder Verweigerung der ihnen obliegenden Arbeit verboten.“
Diese Verordnung ist - nach entsprechender Vereinbarung zwischen der Reichsregierung und den Gewerkschaften, die zugesichert haben, sämtliche Streikmaßnahmen aufzugeben - durch weitere Verordnung vom 9. Februar 1922,
vgl. Verordnung des Reichspräsidenten, betreffend die Aufhebung der Verordnung vom 1. Februar 1922 über das Verbot der Arbeitsniederlegung durch Beamte der Reichsbahn, in: Reichs-Gesetzbl. 1922 I, S. 205; auch im Internet allgemein zugänglich abrufbar unter: http://www.documentarchiv.de/da/fs-notverord-nungen_reichspraesident.html,
aufgehoben worden. In der Folgezeit wurden in Straf-, Disziplinar- und Schadensersatzprozessen die Gerichte aller Gerichtszweige mit der Arbeitsniederlegung durch Beamte befasst, und alle Reichsobergerichte (ebenso wie das Preußische Oberverwaltungsgericht) bestätigten ein Streikverbot für Beamte. Dies wurde auf die dem Beamten gegenüber dem Staate obliegende Gehorsams-, Treue- und Dienstpflicht gestützt. Ein Streikrecht der Beamten könne nicht aner-
- 29 -
kannt werden, „weil es unvereinbar ist mit der Stellung eines Beamten in einem geordneten Rechtsstaate. Der Beamte steht zum Staate nicht in einem nur privatrechtlichen Vertragsverhältnisse, sondern die Anstellung begründet ein öffentlich-rechtliches Gewaltverhältnis mit besonderen Pflichten der Treue, des Gehorsams und der gewissenhaften Erfüllung der übertragenen Aufgaben“.
Vgl. Reichsgericht, Urteile vom 24. Februar 1927 - 574/26 IV. -, JW 1927, 1249, und vom 30. Oktober 1922 - III 402/22 -, RGSt 56, 419 (422); Ur-teile des Reichsdisziplinarhofs, in: Schulze-Simons, Die Rechtsprechung des Reichsdisziplinarhofes, 1926, S. 21, 77, 405; Preuß. OVG, Ur-teil vom 17. Januar 1924 - D. U. 7/22 -, in: Entscheidungen des Preuß. OVG Bd. 78, 448 (452); siehe auch: Kittner, Arbeitskampf: Geschichte, Recht, Gegenwart, 2005, S. 435 f. 442 ff., im Internet allgemein zugänglich unter: http://books.google.de/bookshl=de&id=JoeyAAAAIAAJ&dq=Kittner&q=445; Zum Streik der Eisenbahner 1922, in: Arbeiterpolitik 2007, 14, im Internet allgemein zugänglich unter: http://www.labournet.de/diskussion/geschichte/ei senbahn1922.pdf.
Die Treuepflicht des Beamten ist seither bis heute ein prägendes Strukturmerkmal des Berufsbeamtentums,
vgl. BVerfG, Beschluss vom 22. Mai 1975 - 2 BvL 13/73 -, BVerfGE 39, 334,
und neben dem Alimentationsprinzip (dazu noch unter bb.) die tragende verfassungsrechtliche Säule für ein Streikverbot der Beamten als hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums i.S.d. Art. 33 Abs. 5 GG. Mit dem Eintritt in das Beamtenverhältnis - das auf eigenen Antrag erfolgt; niemand wird zu dem Beamtenverhältnis gezwungen - wird der Beamte verpflichtet, sich voll für den Dienstherrn einzusetzen und diesem seine gesamte Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen.
Vgl. BVerfG, Entscheidung vom 11. April 1967 - 2 BvL 3/62 -, BVerfGE 21, 329.
- 30 -
Als Korrelat hat der Dienstherr - aus dem zuvor aufgezeigten Gesamtzusammen-hang der Historie und der beamtenrechtlichen Grundsätze - dem Beamten und seiner Familie in Form von Dienstbezügen sowie einer Alters- und Hinterbliebenversorgung nach Dienstrang, Bedeutung des Amtes und entsprechend der Entwicklung der allgemeinen Verhältnisse angemessenen Lebensunterhalt zu gewähren. Denn mit dem Eintritt in das Beamtenverhältnis verliert der Beamte grundsätzlich die Freiheit zu anderweitiger Erwerbstätigkeit, weil der Staat die ganze Arbeitskraft des Beamten und damit seine volle Hingabe fordert. Dienstbezüge, Ruhegehalt und Hinterbliebenversorgung bilden also die Voraussetzung dafür, dass sich der Beamte ganz dem öffentlichen Dienst als Lebensberuf widmen und in rechtlicher sowie wirtschaftlicher Unabhängigkeit zur Erfüllung der dem Berufsbeamtentum vom Grundgesetz zugewiesenen Aufgabe, im politischen Kräftespiel eine stabile, gesetzestreue Verwaltung zu sichern, beitragen kann. Dies ist zugleich die vom Staat festzusetzende Gegenleistung dafür, dass sich der Beamte ihm - mit seiner ganzen Arbeitsleistung - treu zur Verfügung stellt und seine Dienstpflichten nach Kräften erfüllt. Vor diesem Hintergrund ist der Beamte dem Allgemeinwohl und damit zur uneigennützigen Amtsführung verpflichtet und hat bei der Erfüllung der ihm anvertrauten Aufgaben seine eigenen Interessen zurückzustellen. Der Einsatz wirtschaftlicher Kampf- und Druckmittel zur Durchsetzung eigener Interessen, insbesondere auch kollektive Kampfmaßnahmen i.S.d. Art. 9 Abs. 3 GG - wie das Streikrecht -, sind ihm vor dem Hintergrund seiner historisch und durch das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis geprägten Treuepflicht verwehrt.
Vgl. BVerfG, Beschlüsse vom 19. September 2007 - 2 BvF 3/02 -, a. a. O., und vom 11. Juni 1958 - 1 BvR 1/52 -, a. a. O.; Müller, Grundzüge des Beamtendisziplinarrechts, 2010, Rdnr. 58.
bb. In diesem Zusammenhang steht ein Streikrecht der Beamten auch im Widerspruch zu dem Alimentationsprinzip und dem Lebenszeitprinzip als jeweils weitere tragende Säulen des Berufsbeamtentums und als hergebrachte Grundsätze des Berufsbeamtentums.
Vgl. zum Alimentationsprinzip im Allgemeinen:
- 31 -
BVerfG, Beschlüsse vom 2. Oktober 2007 - 2 BvR 1715/03 -, ZBR 2007, 416, und vom 20. März 2007 – 2 BvL 11/04 -, BVerfGE 117, 372; siehe auch Wichmann/Langer, Öffentliches Dienstrecht, 6. Aufl., 2007, S. 710, 711; im Internet allgemein zugänglich unter: http://books.google.de/books?id=2sL25Rl7d-MC&printsec=frontcover&dq=Wichmann/langer& hl=de#v=onepage&q=Alimentationsprinzip&f=fals e.; zum Lebenszeitprinzip im Allgemeinen:
BVerfG, Beschluss vom 19. September 2007 - 2 BvF 3/02 -, a. a. O.; BVerwG, Beschluss vom 27. September 2007 - 2 C 21.06 u.a. -, BVerwGE 129, 272 m.w.N.
Der Streik ist ein Arbeitskampfmittel von Arbeitnehmern in einem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis gegenüber ihrem Arbeitgeber. Der Streik ist insoweit nur rechtmäßig, wenn er von einer Gewerkschaft organisiert ist, sich gegen die andere Tarifvertragspartei richtet, die Friedenspflicht des gültigen Tarifvertrags erloschen ist, alle anderen Verhandlungsmöglichkeiten einschließlich der Schlichtung ausgeschöpft sind und der Arbeitskampf nur in notwendigem Maße und fair betrieben wird.
Vgl. BAG, Urteile vom 21. Juni 1988 - 1 AZR 651/86 -, BAGE 58, 364, vom 5. März 1985 - 1 AZR 468/83 -, juris, Beschluss vom 21. April 1971 - GS 1/68 -, BAGE 23, 292.
Mit einem Streik soll auf den Arbeitgeber in „Augenhöhe“ Druck ausgeübt wer-den. Denn ohne die Möglichkeit der Druckausübung durch Streiks oder sonstige Kollektivmaßnahmen wären Tarifverhandlungen nichts anderes als „kollektives Betteln“.
Vgl. BAG, Urteil vom 10. Juni 1980 - 1 AZR 822/79 -, BAGE 33, 140; Gooren, Das Ende des Beamtenstreikverbots, ZBR 2011, 400.
Hier zeigen sich aber die systemimmanenten grundlegenden Unterschiede zwischen einem privatrechtlich geregelten Arbeitsverhältnis und dem öffentlich-rechtlich geregelten Dienstverhältnis eines Beamten. Die Besoldung des Beamten ist keine Verhandlungsposition, die zwischen Tarifvertragsparteien auf „Augenhöhe“ geregelt werden könnte. Die Regelung der Besoldung und Versorgung
- 32 -
unterliegt dem Gesetzesvorbehalt (§ 2 Abs. 1 BBesG, § 3 Abs. 1 BeamtVG). D.h., der Gesetzgeber legt einseitig die Besoldung und Versorgung der Beamtenschaft fest. Im Hinblick auf die Beamten fehlt insoweit systembedingt von vornherein eine verhandelbare und tariffähige Situation. Ein Streik der Beamten würde sich mithin gegen den Gesetzgeber selbst richten, wobei zu berücksichtigen ist, das der Dienstherr in einer Vielzahl von Fällen (vgl. z.B. die Kommunal-beamten etc.) überhaupt nicht Besoldungsgesetzgeber ist. Die einseitige Festsetzung der Besoldung der Beamten durch den Gesetzgeber ist ein Kernstrukturprinzip des Beamtenwesens, das historisch verbürgt auf Unterhalt sowie Alimentation entsprechend dem Dienstrang und damit der Bedeutung und Verantwortung des Beamten angelegt ist. Zwischen dem Dienstherrn und dem Beamten besteht ein Über- und Unterordnungsverhältnis und gerade nicht - wie bei Tarifparteien - ein Gleichgewicht der Kräfte. Insbesondere stellt die Besoldung als Alimentation nicht „Vergütung“, „Entgelt“ oder „Lohn“ für zu erbringende oder erbrachte Leistungen dar, wie es aber bei den privatrechtlich geregelten Arbeitsverhältnissen der Angestellten und Arbeiter der Fall ist. Dies zeigt sich auch im Krankheitsfall. Während privatrechtlich beschäftigte Angestellte oder Arbeiter, wenn sie arbeitsunfähig erkrankt sind, (ungeachtet von etwaigen tarifrechtlichen Sonderbestimmungen) nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz lediglich einen Anspruch darauf haben, dass der Arbeitgeber das Entgelt für die Dauer der Arbeitsunfähigkeit - maximal 6 Wochen - weiter zahlt und ab der 7. Woche von der Krankenkasse ein der Höhe nach geringeres Krankengeld beziehen, haben die Personen in öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen, wie u.a. die Beamten, im Krankheitsfall ohne entsprechende Fristen einen fortbestehenden Anspruch auf (ungekürzte) Besoldung, da in diesem Beschäftigungsverhältnis der Unterhalts-und Alimentationscharakter im Vordergrund steht. Eine Vergleichbarkeit dieser Beschäftigungssysteme besteht nicht. Insbesondere fehlt es im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis auf der Grundlage der systembedingten Unterschiede zu privatrechtlichen Arbeitsverhältnissen an entsprechenden tariffähigen Zielen, die im Rahmen eines Arbeitskampfes einer Verhandlung zugänglich wären.
Der Arbeitskampf passt auch im Übrigen nicht in die verfassungsrechtlich vorgegebene Systematik des öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses. Denn unter
- 33 -
Paritätsgesichtspunkten - die im Tarifrecht maßgeblich sind - wäre eine Streikmaßnahme von Beamten gegenüber den Dienstherrn ein ungleicher Kampf. Wer sich zum Arbeitskampf entschließt, muss dem Grunde nach auch das Risiko dieses Kampfes tragen.
Vgl. BAG, Beschluss vom 28. Januar 1955 - GS 1/54 -, BAGE 1, 291.
Der Arbeitnehmer trägt (unabhängig von einem etwaigen Streikgeld der Gewerkschaft) das Risiko des Lohnausfalls und riskiert ggfs. sogar seinen Arbeitsplatz. Der Arbeitgeber riskiert neben dem Produktionsausfall die Gefahr steigender Verluste und Schäden bis zum wirtschaftlichen Zusammenbruch. Der streikende Beamte hat aufgrund des Lebenszeitprinzips eine unkündbare Stellung und aufgrund des Alimentationsprinzips hätte er selbst während eines Arbeitskampfes - wenn man diesen als legitim ansehen würde - gegenüber dem Dienstherrn einen Anspruch auf weitere Alimentation. Der Beamte würde durch eine Streikmaßnahme mithin keinerlei Risiko tragen. Der Dienstherr - der im Übrigen auch nicht immer Besoldungsgesetzgeber ist (z.B. bei Kommunalbeamten etc.) - wäre de lege lata wehrlos dem Streik ausgesetzt. Dies würde dem im Arbeitsrecht geprägten Prinzip der Arbeitskampfparität widersprechen und das Risiko des Arbeitskampfes einseitig zugunsten des Beamten erleichtern.
Vgl. Isensee, Beamtenstreik, Zur Zulässigkeit des Dienstkampfes, 1971, S. 44 f.
Hier schließt sich letztlich auch der L. der Argumentation, denn die (bereits unter aa. abgehandelte) Treuepflicht des Beamten dient insoweit auch dem Schutz des Dienstherrn, der seinem Beamten eine amtsangemessene Besoldung, eine laufbahnentsprechende Beschäftigung und einen sicheren Arbeits-platz zur Verfügung zu stellen hat. Es handelt sich damit zwischen dem Beamten und seinem Dienstherrn um ein öffentlich-rechtlich verbürgtes gegenseitiges Geben und Nehmen. Im Übrigen bedarf auch der Beamte zum Schutz seiner Rechte keiner „Arbeitskampfbefugnisse“ wie der privatrechtlich Beschäftigte. Ist der Beamte mit Maßnahmen seines Dienstherrn nicht einverstanden, steht ihm nach Maßgabe des § 54 Abs. 2 BeamtStG (zuvor § 126 Abs. 3 BRRG) die Möglichkeit des Widerspruchs und im Anschluss der Verwaltungsrechtsweg offen. Ist der Be-
- 34 -
amte der Ansicht, dass sein Nettoeinkommen nicht mehr ausreicht, um ihm und seiner Familie eine amtsangemessene Besoldung zu ermöglichen, kann er - im Gegensatz zu einem Angestellten oder Arbeiter - eine verfassungswidrig zu niedrige Alimentation im Wege einer Feststellungsklage gegen seinen Dienstherrn geltend machen.
Vgl. BVerwG, Urteile vom 28. Mai 2009 - 2 C 23.07 -, Buchholz 11 Art. 57 Nr. 1, vom 20. März 2008 - 2 C 49.07 -, BVerwGE 131, 20; Beschluss vom 26. Mai 2011 - 2 B 22.10 -, juris.
Ein solcher Weg ist den privatrechtlich Beschäftigten verschlossen, so dass diese - im Gegensatz zu Beamten - auf Arbeitskampfmaßnahmen angewiesen sind, um ihren Interessen gegenüber dem jeweiligen Arbeitgeber Nachdruck zu verleihen.
cc. Das aus der Treuepflicht, dem Alimentations- und Lebenszeitprinzip ableit-bare Streikverbot der Beamten dient zudem der Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des öffentlichen Dienstes. Der Beamte hat die Einhaltung und Ausführung der staatlichen Regelungen sicherzustellen. Die Aufgabe der Beamten besteht gerade darin, die staatliche Ordnung im Rahmen der Eingriffsverwaltung, aber auch bei der Gewährung staatlicher Leistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge, die in besonderer Weise den Bürgerinnen und Bürgern dient, funktionsfähig zu halten. Vor diesem Hintergrund sieht das Grundgesetz in Art. 33 Abs. 5 den Beamtenstatus als besonderes öffentlich-rechtliches Beschäftigungsverhältnis ausdrücklich vor. Alle wichtigen Aufgabenbereiche des Staates sollen durch die Tätigkeit der Beamtenschaft in ihrer Struktur aufrechterhalten und voll funktionsfähig bleiben.
Vgl. BVerwG, Urteile vom 19. September 1984 - 1 D 38.84 -, BVerwGE 76, 193, vom 3. Dezember 1980 - 1 D 86.79 -, BVerwGE 73, 97, und vom 22. November 1979 - 1 D 84.78 -, BVerwGE 63, 293; OVG Berlin, Urteil vom 18. Februar 1986 - D 16.85 -, a. a. O.; Lindner, Dürfen Beamte doch streiken ?, DÖV 2011, 305 (306); Heesen, Streik-recht für Lehrer ?, ZfPR 2000, 162.
- 35 -
c. Das Streikverbot, das - wie die vorstehenden Ausführungen zu aa. bis cc. zeigen - zu den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums gehört, ist nicht nur - wie der Wortlaut in Art. 33 Abs. 5 GG nahe legen könnte -,
vgl. hierzu: Gooren, a. a. O., S. 403,
zu „berücksichtigen“, sondern auch zu beachten. Diese „Berücksichtigungspflicht“ hat nicht bloßen „Appellcharakter“ und ihr mangelt es auch nicht an der insoweit erforderlichen Verbindlichkeit. Das Bundesverfassungsgericht hat dies mit der Formulierung zum Ausdruck gebracht, dass die zum Kernbestand der Strukturprinzipien gehörenden Grundsätze des Berufsbeamtentums nicht nur zu „berücksichtigen“, sondern zu „beachten“ sind.
Vgl. BVerfG, Beschlüsse vom 20. März 2007 - 2 BvL 11/04 -, a. a. O., vom 7. Juli 1982 - 2 BvL 14/78 -, BVerfGE 61, 43, vom 14. Juni 1960 - 2 BvL 7/60 -, BVerfGE 11, 203, und vom 11. Juni 1958 - 1 BvR 1/52 -, a. a. O.
Sicherlich wird nicht jedwede beamtenrechtliche Regelung, die bereits seit längerer Zeit besteht, von der institutionellen Garantie des Berufsbeamtentums erfasst. Bezugspunkt des Art. 33 Abs. 5 GG ist das gewachsene Berufsbeamten“tum“. Geschützt sind insoweit nur diejenigen Regelungen und Grundsätze, die das Bild des Beamtentums in seiner überkommenen Gestalt maßgeblich prägen, so dass ihre Beseitigung auch das Wesen des Berufsbeamtentums antasten würde.
Vgl. BVerfG, Urteil vom 27. September 2005 - 2 BvR 1387/02 -, BVerfGE 114, 258.
Zu diesem Kernbestand von Strukturprinzipien des Beamtenverhältnisses gehörten - wie bereits oben dargestellt - seit jeher die Treuepflicht des Beamten,
vgl. BVerfG, Beschlüsse vom 19. September 2007 - 2 BvF 3/02 -, a. a. O., und vom 22. Mai 1973 - 2 BvL 13/73 -, a. a. O.,
und das Alimentationsprinzip,
vgl. BVerfG, Urteil vom 14. Februar 2012 - 2 BvL 4/10 -, juris; Beschlüsse vom 15. Oktober 1985 - 2 BvL 4/83 -, BVerfGE 71, 39, und vom 25. No-
- 36 -
vember 1980 - 2 BvL 7/76 u.a. -, BVerfGE 55, 207.
Das Grundgesetz selbst nimmt in Art. 33 Abs. 4 (Dienst- und „Treue“-verhältnis) auf den Begriff der Treue des Beamten Bezug. Der Grund für das Festhalten an diesem hergebrachten Grundsatz liegt auf der Hand: Der moderne "Verwaltungsstaat" mit seinen ebenso vielfältigen wie komplizierten Aufgaben, von deren sachgerechter, effizienter, pünktlicher Erfüllung das Funktionieren des gesellschaftlich-politischen Systems und die Möglichkeit eines menschenwürdigen Lebens der Gruppen, Minderheiten und jedes Einzelnen Tag für Tag abhängt, ist auf einen intakten, loyalen, pflichttreuen, dem Staat und seiner verfassungsmäßigen Ordnung innerlich verbundenen Beamtenkörper angewiesen. Ist auf die Beamtenschaft kein Verlass mehr, so sind die Gesellschaft und ihr Staat in kritischen Situationen "verloren". Den Beamten und den Staat verbindet ein besonderes Band. Vor diesem Hintergrund kann das - wie oben aufgezeigt - historisch und funktionell begründete Streikverbot als hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums nicht hinweg gedacht werden, ohne dass die Treuepflicht des Beamten in ihrer Struktur und ihrem Wesensgehalt wegfiele. Das hergebrachte Berufsbeamtentum würde sich, wenn den Beamten ein Streikrecht zustünde, im wesentlichen nicht mehr grundlegend von einem privatrechtlich geregelten Arbeitsverhältnis unterscheiden. Das Beamtentum als solches wäre dann überflüssig. Ebenso überflüssig wäre dann das Alimentationsprinzip als weiterer Kernbestand der beamtenrechtlichen Struktur. Warum soll der Dienstherr weiterhin zur Alimentation (insbesondere Besoldung, Versorgung, Beihilfe) verpflichtet sein, wenn im Gegenzug das Korrelat, nämlich die Treuepflicht des Beamten durch ein Streikrecht perforiert und in seinen Grundzügen aufgehoben wäre ? Dies zeigt, dass das Streikverbot für Beamte zum Kernbestand der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums gehört und damit von dem einfachen Gesetzgeber, den Gerichten, der Verwaltung und den Beteiligten dieses öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses (Dienstherr und Beamter) zu beachten ist.
Vgl. in diesem Sinne auch: BVerfG, Beschluss vom 19. September 2007 - 2 BvF 3/02 -, a. a. O.
- 37 -
Die mit dem 52. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 28. August 2006 (BGBl. I S. 2034) der bis dahin geltenden Fassung des Art. 33 Abs. 5 GG angefügte sogenannte „Fortentwicklungsklausel“ hat nichts daran geändert, dass bei der Regelung und Gestaltung des öffentlichen Dienstrechts weiterhin die hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums zu berücksichtigen sind. Änderungen, die mit den Grundstrukturen des von Art. 33 Abs. 5 GG geschützten Leitbildes des deutschen Berufsbeamtentums nicht in Einklang gebracht werden können, verstoßen auch weiterhin gegen die Vorgaben des Grundgesetzes.
Vgl. BVerfG, Beschlüsse vom 28. Mai 2008 - 2 BvL 11/07 -, BVerfGE 121, 205, und vom 19. September 2007 - 2 BvF 3/02 -, a. a. O.; OVG Rh.-Pf., Beschluss vom 4. Dezember 2009 - 10 A 10507/09 -, Schütz BeamtR ES/C I Nr. 10.
Schon aus dem insoweit unveränderten Wortlaut der Bestimmung ergibt sich, dass bei der Auslegung des Art. 33 Abs. 5 GG sowie der Regelung und Gestaltung des öffentlichen Dienstrechts weiterhin die hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums - also auch das Alimentationsprinzip, die Treupflicht und das Streikverbot für Beamte - zu berücksichtigen sind. Nach dem eindeutigen Wortlaut dieser Bestimmung enthält die „Fortentwicklungsklausel“ lediglich einen Auftrag an den Gesetzgeber, das öffentliche Dienstrecht fortzuentwickeln, nicht aber den hierfür geltenden Maßstab, die hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums, abzuändern.
Vgl. Seifert, Recht auf Kollektivverhandlungen und Streikrecht für Beamte, KritV 2009, 357 (374).
Dieses Ergebnis anhand des Wortlauts wird durch die Entstehungsgeschichte der "Fortentwicklungsklausel" bestätigt (vgl. BT-Drucks 16/813, S. 8 und 10). Eine Verschiebung der verfassungsrechtlichen Grenzen der gesetzgeberischen Regelungsbefugnis war damit von vornherein nicht beabsichtigt. Vielmehr heißt es hierzu (BT-Drucks 16/813, S. 10): "Die hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums sind auch weiterhin zu berücksichtigen. Unberührt bleibt die verfassungsrechtliche Garantie des Berufsbeamtentums." In der abschließenden Aussprache der 44. Sitzung des Deutsche Bundestags vom 30. Juni 2006 (Plenar-
- 38 -
protokoll 16/44, S. 4258) betonte die Bundeskanzlerin ausdrücklich: „... Deshalb möchte ich an dieser Stelle noch einmal betonen, dass es für uns sehr wichtig ist, dass weiterhin die im Grundgesetz verankerten so genannten hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums gelten sollen. ...".
d. Auch für eine funktionsbezogene Differenzierung des Streikverbots für Beamte ergibt sich aus dem Grundgesetz keine Grundlage. Art. 33 Abs. 4 GG bestimmt, dass die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse als ständige Aufgabe in der Regel Angehörigen des öffentlichen Dienstes zu übertragen ist, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen. Dieser „Funktionsvorbehalt“ begründet kein Recht des Einzelnen, sondern enthält eine objektiv-rechtliche Verfassungsregelung.
Vgl. Badura, in: Maunz/Dürig, GG, Bd. IV, Art. 33 Rdnr. 55.
Um die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse handelt es sich jedenfalls, wenn Befugnisse zum Grundrechtseingriff im engeren Sinne ausgeübt werden, die öffentliche Gewalt also durch Befehl oder Zwang unmittelbar beschränkend (Eingriffsverwaltung) auf grundrechtlich geschützte Freiheiten einwirkt.
Vgl. BVerfG, Urteil vom 18. Januar 2012 - 2 BvR 133/10 -, juris.
Wie weit der Begriff der hoheitsrechtlichen Befugnisse über diesen engen Bdeutungsgehalt hinausreicht, ist durch das Bundesverfassungsgericht bislang noch nicht geklärt,
vgl. zum Meinungsstand in der Literatur: Masing, in: Sachs, GG, Bd. II, 2. Aufl., 2006, Art. 33 Rdnr. 64,
und bedarf hier im vorliegenden Fall auch keiner Auslegung durch den Senat. Dass Lehrer - wie die Klägerin - auch im Angestelltenverhältnis beschäftigt werden können und dies mit dem Funktionsvorbehalt in Art. 33 Abs. 4 GG vereinbar ist, weil Lehrer in der Regel nicht schwerpunktmäßig hoheitlich geprägte Aufgaben wahrnehmen, die der besonderen Absicherung durch den Beamtenstatus bedürfen, ist durch das Bundesverfassungsgericht geklärt.
- 39 -
Vgl. BVerfG, Beschluss vom 19. September 2007 - 2 BvF 3/02 -, a. a. O.
Dass mithin Angestellte und Beamte zum Teil dieselben Aufgaben übernehmen, rechtfertigt verfassungsrechtlich jedoch keine Differenzierung danach, jedenfalls für diejenigen Beamten, die nicht dem Bereich der Eingriffsverwaltung zuzuordnen sind, ein Streikrecht anzunehmen. Das Beamtenverhältnis ist seit jeher statusbezogen. Es wird begründet durch eine Ernennung (vgl. § 8 LBG NRW a.F., § 8 BeamtStG). Die Rechte (§§ 85 f. LBG NRW a.F., §§ 43 ff. BeamtStG) und Pflichten (§§ 55 ff. LBG NRW a.F., §§ 33 ff. BeamtStG) der Beamten sind typisierend bestimmt und zwar unabhängig davon, welche konkrete Funktion der einzelne Beamte gerade ausübt. Der Beamtenstatus kennt keine Klassifizierung und ist nicht aufspalt- und teilbar. Die besondere Treuepflicht des Beamten gegenüber seinem Dienstherrn ist unabhängig von der Tätigkeit, die er ausübt, und gewissermaßen Geschäftsgrundlage für seine auf eigenen Antrag erfolgte Ernennung zum Beamten. Der Polizeibeamte oder Beamte im Ordnungsamt hat die gleichen beamtenrechtlichen Rechte und Pflichten wie der beamtete Lehrer oder der Kommunalbeamte in dem Liegenschaftsamt oder im Beschaffungswesen. Auch die rechtliche Stellung des Beamten ist im einzelnen unabhängig von der Tätigkeit, die er ausübt. Das Beamtenrecht i.S.d. Art. 33 Abs. 5 GG und der Bundes- und Landesgesetze kennt keine funktionsbezogenen Beamtenkategorien mit unterschiedlichen Rechten und Pflichten. Den Beamten in der Leistungsverwaltung trifft dieselbe Treuepflicht gegenüber dem Dienstherrn wie den Beamten in der Eingriffsverwaltung. Umgekehrt gelten auch das Alimentationsprinzip und das Lebenszeitprinzip zugunsten des Beamten unabhängig davon, in welchem Tätigkeitsbereich er eingesetzt ist. Eine funktionsbezogene Differenzierung wäre ein Aliud und künstliches Konstrukt, das mit den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums nicht zu vereinbaren ist. Die Beamtenschaft sitzt insgesamt „im selben Boot“. Würde man dem Beamten in der Eingriffsverwaltung ein Streikrecht absprechen und dem Beamten in der Leistungsverwaltung oder den beamteten Lehrern ein Streikrecht zusprechen, wären - abgesehen von den sozialen Spannungen - gleichheitswidrige Unterscheidungen zwischen dienstrechtlich Gleichgestellten eingeführt.
- 40 -
Vgl. Isensee, a. a. O., S. 104 f.
Ein Verwischen der beamtenrechtlichen Strukturprinzipien durch Mischung mit Elementen aus privatrechtlich geregelter Beschäftigungsverhältnissen wider-spricht den durch Art. 33 Abs. 5 GG geschützten hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums. Im öffentlichen Dienst ist daher klar zwischen dem Beamtenverhältnis einerseits und dem Angestellten- bzw. Arbeiterverhältnis andererseits - mit seiner jeweiligen rechtlich geregelten Ausprägung (Rechte- und Pflichtenverhältnis einerseits durch Gesetz, andererseits durch Vertrag oder Tarifvertrag geregelt) - zu unterscheiden. Eine Mischform beider Systeme sieht das deutsche Recht nicht vor.
Vgl. auch mit zutreffenden Argumenten: VG Osnabrück, Urteil vom 19. August 2011 - 9 A 1/11 -, ZBR 2011, 389.
Dem Dienstherrn bleibt es damit unbenommen im öffentlichen Dienst - wie hier im Schulwesen in Bezug auf Lehrer - Angestellte einzustellen. Er ist dann den besonderen institutionellen Vorgaben nicht unterworfen, die das Grundgesetz mit der Einrichtung des Berufsbeamtentums verbindet. Entscheidet sich der Dienstherr indes für eine Verbeamtung des Bediensteten - hier einer Lehrerin -, so ist das begründete Beamtenverhältnis auch den Bindungen des Art. 33 Abs. 5 GG unterworfen. In bezug auf das Schulwesen hat die Übernahme der Lehrkräfte ins Beamtenverhältnis für den Dienstherrn viele - insbesondere auch finanzielle - Vorteile. Sie befreit ihn von dem Zwang, Arbeits- und Entgeltbedingungen mit den Tarifparteien auszuhandeln und abzustimmen. Die Ausgestaltung des Beamtenverhältnisses ist der einseitigen Regelungskompetenz des Beamtengesetzgebers unterstellt. Dementsprechend liegt es in seinem Gestaltungsspielraum, die wöchentliche Arbeitszeit oder die Festsetzung des Ruhestandsalters zu bestimmen. Das Beamtenverhältnis erlaubt dem Dienstherrn einen flexiblen Einsatz der Beschäftigten. Der Handlungsspielraum besteht auch in Bezug auf die örtliche Verwendung, weil das Beamtenrecht die Versetzung eines Beamten auch gegen seinen Willen im dienstlichen Interesse ermöglicht. Der Beamte ist seinem Dienstherrn zur Treue verpflichtet und zum Einsatz kollektiver Druckmittel wie des Streiks nicht befugt. Er hat seinen Dienstherrn loyal zu unterstützen und ist
- 41 -
auch bei der Aufnahme von Nebentätigkeiten nicht frei. Schließlich untersteht der Beamte der Disziplinargewalt des Dienstherrn.
Vgl. BVerfG, Beschluss vom 19. September 2007 - 2 BvF 3/02 -, a. a. O.
Die Doppelrolle des Staates als tariffähiger Arbeitgeber gegenüber den Angestellten und Arbeitern im öffentlichen Dienst auf der einen Seite und als Dienstherr gegenüber den Beamten auf der anderen Seite ändert an der statusbezogenen Sichtweise mit Blick auf das Streikverbot der Beamten nichts. Dem steht insbesondere auch nicht die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 7. Juni 2000 - 1 D 4.99 -, BVerwGE 111, 231, entgegen, in der einem beurlaubten Fernmeldebeamten während seiner Beschäftigung bei einer Tochtergesellschaft der Telekom AG ein Streikrecht zugesprochen wurde, weil er - wie sich aus den Entscheidungsgründen ergibt - während seiner Beurlaubung nach Tarif, d.h. privatrechtlich, bezahlt worden ist. Die Dienstleistungspflicht und die Besoldungsansprüche ruhten für die Zeit der Beurlaubung, so dass kein Grund ersichtlich war und ist, dem in einem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis stehenden beurlaubten Beamten das Streikrecht gegenüber dem privaten Arbeitgeber nach Art. 9 Abs. 3 GG abzusprechen. Dieser Fall ist aber nicht vergleichbar mit dem eines Beamten, der - wie die Klägerin - nicht beurlaubt ist, sondern in einem aktiven Beamtenverhältnis der Treue- und Dienstleistungspflicht gegenüber seinem Dienstherrn unterliegt.
Der vorliegende Fall bietet auch unter Berücksichtigung der Besonderheit der Beschäftigung im Schulwesen keinen Anlass zu einer anderen Bewertung. Gerade auch im Schulbereich ist das Streikverbot für beamtete Lehrer notwendig und sinnvoll. Bei dem Schulwesen handelt es sich nicht lediglich um einen schlicht fiskalischen Bereich, sondern um ein öffentlich-rechtliches Rechte- und Pflichtenverhältnis (vgl. § 42 Abs. 1 SchulG NRW). Das Schulwesen unterliegt gemäß Art. 7 Abs. 1 GG der staatlichen Aufsicht. Der Staat hat den Schulfrieden sicherzustellen,
vgl. BVerfG, Beschlüsse vom 22. Februar 2006 - 2 BvR 1657/05 -, juris, und vom 27. Januar 1976 - 1 BvR 2325/73 -, BVerfGE 41, 251; BVerwG,
- 42 -
Beschluss vom 16. Dezember 2008 - 2 B 46.08 -, NJW 2009, 1289,
und ihm obliegt der staatliche Bildungs- und Erziehungsauftrag (vgl. auch § 2 SchulG NRW).
Vgl. BVerfG, Beschluss vom 16. April 2002 - 1 BvR 279/02 -, DVBl. 2002, 971; BVerwG, Urteil vom 30. November 2011 - 6 C 20.10 -, Städte-und Gemeinderat 2012, 29; OVG NRW, Beschluss vom 29. Juli 2010 - 19 A 590/08 -, juris.
Lehrer - wie die Klägerin - erfüllen diesen Bildungs- und Erziehungsauftrag des Staates. Sie haben dabei die unmittelbare pädagogische Verantwortung für den Unterricht und die Erziehung der Schüler.
Vgl. BVerfG, Urteil vom 24. September 2003 - 2 BvR 1436/02 -, BVerfGE 108, 282.
Ein Streik durch beamtete Lehrer im Bildungsbereich richtet sich faktisch nicht gegen den Dienstherrn, sondern benachteiligt die Menschen, die sich im Bildungsprozess befinden, also die Schülerinnen und Schüler, die ohne jeden Einfluss sind auf solche Bereiche, die Gegenstand von Arbeitskampfmaßnahmen sind, also Bezahlung, Arbeitszeit etc.
Vgl. Heesen, a. a. O., S. 162.
Der Schul- und Unterrichtsteilnahmepflicht der Schülerinnen und Schüler (vgl. §§ 34 ff., 43 Abs. 1 Satz 1 SchulG NRW) - die auch mit Zwangsmitteln durchgesetzt werden kann (vgl. § 41 Abs. 3 und 5 SchulG NRW) - entspricht die Unterrichts-und Dienstleistungspflicht der beamteten Lehrer. Der Staat wäre schlichtweg nicht in der Lage, seinen Erziehungs- und Bildungsauftrag zu erfüllen und auch im Hinblick auf die minderjährigen Schülerinnen und Schüler (Stichwort „Sichere Schule“) seiner Betreuungspflicht nachzukommen, wenn er zur Erfüllung dieser Pflichten nicht wenigstens auf die zur besonderen Treue verpflichteten beamteten Lehrer zurückgreifen könnte. Im Übrigen ist zu berücksichtigen, dass durch das Streikverbot die Koalitionsfreiheit (Art. 9 Abs. 3 GG), Versammlungsfreiheit (Art. 8 Abs. 1 GG) und Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG) der beamteten Lehrer an-
- 43 -
sonsten unangetastet bleibt. Auch wenn Lehrer durch die wöchentlichen Unterrichtspflichtstunden,
bei der an einer Realschule eingesetzten Klägerin sind dies 28 Stunden, vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 3 der VO zu § 93 Abs. 2 SchulG v. 18. März 2005 (GV. NRW. S. 218), zuletzt geändert durch VO v. 10. Juli 2011 (SGV. NRW. 223),
sowie die Unterrichtsvorbereitung, die Unterrichtsnachbearbeitung, Elternsprechtage, Klassenfahrten etc. stark dienstlich beansprucht sind, bleibt in den Ferien und sonstigen unterrichtsfreien Zeiten ausreichend Möglichkeit, sich für die Belange des Schulwesens und der eigenen Besoldung einzusetzen.
2. Ein Streikrecht für Beamte in der Bundesrepublik Deutschland lässt sich auch nicht aus dem Völker- oder Europarecht herleiten.
a. Ein Streikrecht für deutsche Beamte ergibt sich insbesondere nicht aus der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (Europäische Menschenrechtskonvention - EMRK) und der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR).
aa. Die EMRK und ihre Zusatzprotokolle sind völkerrechtliche Verträge. Die Konvention überlässt es den Vertragsparteien, in welcher Weise sie ihrer Pflicht zur Beachtung der Vertragsvorschriften genügen. In der Bundesrepublik Deutschland ist die Konvention keine allgemeine Regel des Völkerrechts (Art. 25 GG).
Vgl. BVerfG, Urteil vom 4. Mai 2011 - 2 BvR 2333/08 u.a. -, BGBl. I 2011, 1003 = NJW 2011, 1931; Meyer-Ladewig, EMRK Handkommentar, 3. Aufl., 2011, Einleitung Rdnr. 33.
Der Bundesgesetzgeber hat der EMRK aber jeweils mit förmlichem Gesetz gemäß Art. 59 Abs. 2 GG zugestimmt (vgl. Gesetz über die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 7. August 1952 , BGBl. II S. 685; die Konvention ist gemäß der Bekanntmachung vom 15. Dezember 1953, BGBl. 1954 II S. 14, am 3. September 1953 für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft getreten; inzwischen in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Okto-
- 44 -
ber 2010, BGBl. II S. 1198). Damit hat der Gesetzgeber die EMRK in deutsches Recht transformiert und einen entsprechenden Rechtsanwendungsbefehl erteilt. Innerhalb der deutschen Rechtsordnung stehen die EMRK und ihre Zusatzprotokolle - soweit sie für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft getreten sind - im Range eines Bundesgesetzes.
Vgl. BVerfG, Urteil vom 4. Mai 2011 - 2 BvR 2333/08 u.a. -, a. a. O.; Beschlüsse vom 14. Oktober 2004 - 2 BvR 1481/04 -, BVerfGE 111, 307, und vom 29. Mai 1990 - 2 BvR 254/88 u.a. -, BVerfGE 82, 106.
Diese Rangzuweisung bedeutet, dass deutsche Gerichte die Konvention wie anderes Gesetzesrecht des Bundes im Rahmen methodisch vertretbarer Auslegung zu beachten und anzuwenden haben. Die Gewährleistungen der EMRK sind aber kein unmittelbarer verfassungsrechtlicher Prüfungsmaßstab, sie beeinflussen jedoch die Auslegung der Grundrechte und rechtsstaatlichen Grundsätze des Grundgesetzes und bieten insoweit eine Orientierungshilfe. Die Grenzen dieser Auslegung ergeben sich jedoch aus dem Grundgesetz.
Vgl. BVerfG, Beschluss vom 14. Oktober 2004 - 2 BvR 1481/04 -, a. a. O.
Die Aufgabe des EGMR ist es sicherzustellen, dass die Vertragsparteien der EMRK die durch die Ratifizierung übernommenen Verpflichtungen einhalten. Der EGMR kann Konventionsverletzungen feststellen und den Unterzeichnerstaat nach Art. 41 EMRK zum Ersatz immateriellen Schadens verurteilen,
vgl. EGMR, Urteil vom 16. Juli 2009 - 8453/04 -, NVwZ 2010, 1015; BVerwG, Beschluss vom 26. Oktober 2011 - 2 B 69.10 -, juris; Meyer-Ladewig, EMRK, a. a. O. Art. 41 Rdnr. 1 ff.,
hat jedoch nicht die Vollstreckungsbefugnis das der Konvention entgegenstehende innerstaatliche Recht selbst aufzuheben. Die Entscheidungen des EGMR besitzen insbesondere keine Gesetzesqualität, vielmehr spricht Art. 46 Abs. 1 EMRK nur eine Bindung der beteiligten Verfahrensparteien („inter partes“) an das endgültige Urteil in Bezug auf einen bestimmten Streitgegenstand aus („res iudicata“).
- 45 -
Vgl. BVerfG, Urteil vom 4. Mai 2011 - 2 BvR 2333/08 u.a. -, a. a. O.
bb. Weder aus der EMRK noch aus der Rechtsprechung des EGMR lässt sich ein Streikrecht für deutsche Beamte ableiten (1). Aber selbst wenn man aus dem Konventionsrecht ein Streikrecht auch für Beamte - oder zumindest für diejenigen Beamten, die nicht hoheitlich geprägte Aufgaben wahrnehmen - ableiten würde, steht dem jedenfalls in der Bundesrepublik Deutschland das durch Art. 33 Abs. 5 GG - als hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums - verbürgte Streikverbot für Beamte entgegen. Die Regelungen der EMRK stehen in der deutschen Rechtsordnung im Range eines Bundesgesetzes unterhalb des Grundgesetzes und können somit das verfassungsunmittelbare Streikverbot für Beamte nicht in Frage stellen (2).
(1) Ausgehend vom Wortlaut ist weder im ursprünglichen Text der EMRK noch in den Zusatzprotokollen ein Streikrecht als Grund- oder Menschenrecht ausdrücklich genannt.
Vgl. auch Lindner, a. a. O. S. 306; B. / Schubert, in: Karpenstein, EMRK, 2012, Art. 11 Rdnr. 53; Fütterer, Das Koalitions- und Streik-recht im EU-Recht nach dem Wandel der Rechtsprechung des EGMR zur Koalitionsfreiheit gemäß Art. 11 EMRK (Demir und Baykara und an-dere), EuZA 2011, 505 (511).
In Art. 11 Abs. 1 EMRK ist bestimmt, dass jede Person das Recht hat, sich frei und friedlich mit anderen zu versammeln und sich frei mit anderen zusammenzuschließen; dazu gehört auch das Recht, zum Schutz seiner Interessen Gewerkschaften zu gründen und Gewerkschaften beizutreten. Ein Streikrecht - insbesondere für Beamte - findet sich in dem Text ausdrücklich nicht.
Allerdings ist der Rechte- und Wertekatalog der EMRK nicht isoliert an dem Wortlaut der Konvention zu messen, sondern im Zusammenhang mit der Rechtsprechung des zur Interpretation der EMRK berufenen EGMR zu sehen. Der EGMR hat im Hinblick auf die Bundesrepublik Deutschland als Verfahrenspartei in keiner Entscheidung die Feststellung getroffen, dass das Streikverbot der
- 46 -
deutschen Beamten gegen Bestimmungen der Konvention - namentlich Art. 11 EMRK - verstoße. Auch den einschlägigen Entscheidungen des EGMR kann nach Auffassung des erkennenden Senats,
anders das VG Kassel, Urteil vom 27. Juli 2011 - 28 K 1208/10.KS.D -, AuR 2011, 375,
nicht entnommen werden, dass das Streikverbot für Beamte in der Bundesrepublik Deutschland konventionswidrig sei. So hat der EGMR in dem Verfahren Schmidt und Dahlström . /. Schweden,
vgl. EGMR, Urteil vom 6. Februar 1976 – 5589/72, EGMR 1, 172; im Internet auch allgemein zugänglich abrufbar unter: http://www.eugrz.info/pdf/EGMR22.pdf,
zur Rdnr. 36 der Entscheidungsgründe ausgeführt: „Das Streikrecht, das in Art. 11 nicht ausdrücklich verankert ist, kann durch das innerstaatliche Recht einer Regelung unterworfen werden, die so gestaltet ist, dass sie seine Ausübung in bestimmten Fällen einschränkt“. Eine Kehrtwende in seiner Rechtsprechung hat der EGMR in dem Verfahren Wilson und National Union of Journalists . /. Vereinigtes Königreich,
vgl. EGMR, Urteil vom 2. Oktober 2002 – 30668/96, 30671/96, 30678/96, Rdnr. 46, im Internet allgemeinzugänglich unter: http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item= 2&portal=hbkm&action=html&highlight=30668/96 &sessionid=86181956&skin=hudoc-en,
vollzogen, indem er die Beschränkungen eines Streiks an den Rechtfertigungsgründen des Art. 11 Abs. 2 EMRK gemessen hat und ausführte, dass zu einem System freiwilliger Kollektivverhandlungen auch das Recht gehört, Arbeitskampfmaßnahmen zu ergreifen. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat in der hier angefochtenen Entscheidung ebenso wie das Verwaltungsgericht Kassel,
vgl. VG Kassel, Urteil vom 27. Juli 2011 - 28 K 1208/10.KS.D -, a. a. O.,
und Teile der Literatur,
- 47 -
vgl. Löber, Anmerkung zu dem hier in Rede stehenden Urteil des VG Düsseldorf vom 15. Dezember 2010 - 31 K 3904/10.O -, AuR 2011, 76; Niedobitek, Denationalisierung des Streikrechts – auch für Beamte ? - Tendenzen im europäischen und im internationalen Recht -, ZBR 2010, 361 (367); Lörcher, Das Menschenrecht auf Kollektivverhandlung und Streik - auch für Beamte, AuR 2009, 229 f.,
aus der Rechtsprechung des EGMR in dem Verfahren Demir und Baykara . /. Türkei,
vgl. EGMR, Urteil vom 12. November 2008 – 34503/97, NZA 2010, 1425, AuR 2009, 269, im französischen Originaltext im Internet allgemein zugänglich unter:
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp ?item=1&portal=hbkm&action=html& high-light=34503/97&sessionid=86181956&
skin=hudoc-en,
eine völkerrechtliche Gewährleistung des Streikrechts auch für Beamte abgeleitet. Dem vermag sich der Senat nicht anzuschließen. Im Kern ging es in diesem Verfahren darum, dass es nach Ansicht des EGMR der Auslegung des Art. 11 EMRK widerspreche, wenn Angehörige des öffentlichen Dienstes keine Gewerkschaften bilden und keine Tarifverhandlungen mit ihrem Arbeitgeber führen dü¬fen. Die Einschränkungen in Art. 11 Abs. 2 EMRK seien eng auszulegen. Gemeindebedienstete seien danach grundsätzlich keine „Angehörigen der Staatsverwaltung“ i.S.d. Art. 11 Abs. 2 Satz 2 EMRK. Der EGMR hat unter Rdnr. 158 der Entscheidungsgründe ausdrücklich klargestellt,
„Quant aux arguments des requérants tirés de l'insuffisance des dispositions de la no-velle législation du point de vue des droits syndicaux des fonctionnaires, la Cour rappelle que l'objet de la présente requête ne s'étend pas au fait que la nouvelle législation turque n'impose pas à l'administration l'obligation de conclure des conventions collectives avec les syndicats de fonctionnaires, ni au fait que ces derniers n'ont pas le droit de grève en cas de non-aboutissement des négociations collectives. “,
dass Fragen des Verbots des Streikrechts im öffentlichen Dienst - damit auch eines Beamtenstreikrechts - nicht Gegenstand dieses Verfahrens sind.
- 48 -
Vgl. EGMR, Urteil vom 12. November 2008 - 34503/97, ausführlich in: AuR 2009, 269 (273) und im französischen Originaltext, a. a. O.
Deutlicher kann ein Gericht die Grenzen des Verfahrensgegenstandes kaum formulieren. Ein völkerrechtlich verankertes Streikrecht für Beamte oder bestimmte Kategorien von Beamten lässt sich aus dieser Entscheidung nicht ableiten. Aus dieser Entscheidung ergibt sich nur, dass Art. 11 EMRK auch im Bereich des öffentlichen Dienstes Geltung entfaltet und dass dem EGMR eine Differenzierung danach vorschwebt, ob Beschäftige im öffentlichen Dienst Staatsgewalt im eigentlichen Sinne („...droit pour les fonctionnaires des administrations locales non détenteurs de pouvoirs étatiques de mener des négociations collectives pour la détermination de leur rémunération et de leurs conditions de travail a été reconnu dans la majorité des Etats contractants ...“, vgl. Rdnr. 151 im französischen Originaltext, a. a. O.). ausüben. Die Unterzeichnerstaaten sollen dabei frei bleiben, ihr Rechtssystem so zu organisieren, dass sie repräsentativen Gewerkschaften möglicherweise eine besondere Rechtsstellung gewähren. Angehörige des öffentlichen Dienstes müssen von ganz besonderen Ausnahmen abgesehen, wie andere Arbeitnehmer diese Rechte haben, unbeschadet der rechtmäßigen Einschränkungen, die den Angehörigen der Staatsverwaltung i.S. von Art. 11 Abs. 2 EMRK auferlegt werden können („... en principe, devenu l'un des éléments es-sentiels du « droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts » énoncé à l'article 11 de la Convention, étant entendu que les Etats demeurent libres d'organiser leur système de ma-nière à reconnaître, le cas échéant, un statut spécial aux syndicats représenta-tifs. Comme les autres travailleurs, les fonctionnaires, mis à part des cas très par-ticuliers, doivent en bénéficier, sans préjudice toutefois des effets des « res-trictions légitimes » pouvant devoir être imposées aux « membres de l'adminis-tration de l'Etat » au sens de l'article 11 ...“, vgl. Rdnr. 154 im französischen Ori¬ginaltext, a. a. O). Hieraus zieht der EGMR in der Entscheidung Demir und Bay-kara . /. Türkei die Schlussfolgerung, dass die türkischen Gemeindebediensteten den Einschränkungen des Art. 11 Abs. 2 EMRK nicht unterlägen (...dont cependant les requérants en l'espèce ne font pas partie ...“, vgl. Rdnr. 154 im französischen Originaltext, a. a. O) . Abgesehen davon, dass diese Entscheidung
- 49 -
sich nicht mit dem Streikrecht im öffentlichen Dienst auseinandersetzt und nur inter partes (s.o.) im Verhältnis zur Türkei Bindung entfaltet, sind die Rechtsverhältnisse in der Türkei - die allein Gegenstand der Entscheidung waren - offen-kundig auch nicht ohne Weiteres auf die Rechtsverhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland übertragbar, denn Bedienstete in den Kommunalverwaltungen üben in Deutschland durchaus Staatsgewalt aus (vgl. in der Eingriffsverwaltung: z.B. Bedienstete im Ordnungsamt, Bauordnungsamt, Gewerbeaufsicht - durch Erlass von ordnungsrechtlichen Bescheiden und Anordnungen -, im Bereich der Gemeindekasse - durch den Erlass von Abgabenbescheiden und Vollstreckungsmaßnahmen - etc., aber auch im Bereich der Leistungsverwaltung z.B. Sozialämter - Gewährung von Sozialhilfe durch Bescheid -, Wirtschaftsförderung - Subventionsgewährung durch Bescheid -, BAföG-Leistungen durch Bescheid, Elterngeldgewährung durch Bescheid etc.). Es kann nicht ernsthaft in Abrede gestellt werden, dass es sich hierbei um hoheitliche Maßnahmen des Staates und damit der Staatsverwaltung handelt.
Eine andere Beurteilung ergibt sich auch nicht aus der Entscheidung des EGMR in dem Verfahren Enerji Yapi-Yol Sen . /. Türkei.
Vgl. EGMR, Urteil vom 21. April 2009 – 68959/01, AuR 2009, 274, NZA 2010, 1423; im französischen Originaltext im Internet allgemeinzugänglich unter:
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?
item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=689 59/01&sessionid=86181956&skin=hudocen.
In dieser Entscheidung hat der EGMR entschieden, dass ein von Gewerkschaften organisierter Streik von dem Schutzbereich des Art. 11 Abs. 1 EMRK erfasst sei. Dem Verfahren lag der Sachverhalt zugrunde, dass die türkische Regierung „allen“ Beschäftigten des öffentlichen Dienstes per Runderlass untersagt hatte, an einem Tag an landesweiten Streiks im Rahmen von gewerkschaftlichen Aktionen mit Versammlungen und Demonstrationen teilzunehmen. Der EGMR sah hierin einen Eingriff in den Schutzbereich des Art. 11 Abs. 1 EMRK. Das Streikrecht sei aber nicht absolut. Es könne von Voraussetzungen abhängig gemacht und beschränkt werden. So könne es mit der Gewerkschaftsfreiheit vereinbar
- 50 -
sein, Streiks von Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zu verbieten, die im Namen des Staates Hoheitsgewalt ausüben. Ein Streikverbot könne also bestimmte Gruppen von Beschäftigten des öffentlichen Dienstes betreffen, dürfe aber nicht insgesamt für den öffentlichen Dienst - wie hier - ausgesprochen wer-den. Vorschriften über das Streikverbot müssten so eindeutig und begrenzt wie möglich die Gruppe der betroffenen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bestimmen. Die türkische Regierung habe nicht nachgewiesen, dass die umstrittene Beschränkung in einer demokratischen Gesellschaft notwendig gewesen sei.
Soweit das Verwaltungsgericht Düsseldorf in der angefochtenen Entscheidung,
ebenso wie das VG Kassel, Urteil vom 27. Juli 2011 - 28 K 1208/10.KS.D -, a. a. O., und Teile der Literatur: Lörcher, Beamtenstreikrecht zum ersten Mal grundsätzlich anerkannt, Der Personalrat 2011, 452; Niedobitek, a. a. O. S. 367; Lörcher, a. a. O., AuR 2009, 229 f.; siehe auch: Polakiewicz/Kessler, Das Streikverbot für deutsche BeamtInnen auf dem Prüfstand der Europäischen Menschenrechtskonvention, von der Klägerin zur Gerichtsakte gereicht,
hieraus „völker- bzw. europarechtlich“ ein generelles Streikrecht für Beamte - oder zumindest für diejenigen, die keine hoheitsrechtliche Funktionen ausüben - ableitet, vermag der Senat dem nicht zu folgen. Zur Überzeugung des Senats handelt es sich hierbei um Fehlinterpretationen des Urteils, die zum einen aus unterschiedlichen Übersetzungen der Originalfassung der Entscheidung herrühren und die zum anderen nicht berücksichtigen, dass der EGMR in diesem Fall eine Beweislastentscheidung getroffen hat. Gemäß Art. 34 Abs. 1 der Verfahrensordnung des EGMR (vgl. Bekanntmachung der Neufassung der Verfahrensordnung des EGMR vom 27. Juli 2006, BGBl. II, S. 693, vom 22. Oktober 2010, BGBl. II, S. 1198, und vom 1. April 2011, im Internet unter: http://www.bmj.de/ SharedDocs/Downloads/EN/Verfahrensordnung_des_Gerichtshofs.pdf;jsessionid =0279BC91967AD494E 198BDA4EA11493C.1_cid155?_blob=publicationFile) sind die Amtssprachen des Gerichtshofs Englisch und Französisch. Die hier vorliegenden deutschen Übersetzungen der Entscheidung des EGMR vom 21. April 2009 - AuR 2009, 274 und NZA 2010, 1423 - sind nicht von dem Gerichtshof au-
- 51 -
torisiert und können keinen Anspruch auf vollständige Authentizität erheben. Der Begriff „fonctionnaires“ in der französischen Originalfassung des Urteils ist in der deutschen Fassung von Buschmann/Lörcher mit „Beamte/r/n“ übersetzt worden [AuR 2009, 274 (275)], während Meyer-Ladewig/Petzold in ihrer deutschen Fassung den Begriff mit „Angehörige/n des öffentlichen Dienstes“ übersetzt haben [NZA 2010, 1423 (1423, 1424, 1425)]. Diesen Begrifflichkeiten kommt gerade in der Rechtssprache eine besondere Bedeutung zu. In herkömmlichen Deutsch-Französisch Wörterbüchern und Online-Übersetzungsportalen wird der Begriff „fonctionnaire“ zwar häufig mit „Beamter“ übersetzt,
vgl. http://de.pons.eu/dict/search/results/?q= fonctionnaire&l=defr&in=&lf=de&kbd=fr ; http://dictionnaire.reverso.net/francais-alle-mand/fonctionnaire/forced,
allerdings handelt es sich hierbei nicht um rechtstechnische Übersetzungen. Bei diesen umgangssprachlichen Übersetzungen wird nicht zwischen Staatsbediensteten (Beamte, Angestellte und Arbeiter) und Beamten im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis im Rechtssinne unterschieden. In einschlägigen Rechtswörterbüchern,
vgl. Doucet, Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache 1. Französisch – Deutsch, Band 1, 6. Aufl. 2007, Begriff: fonctionnaire (S. 362), siehe auch: Paepke, Im Übersetzen leben, 1986, S. 262, zu fonction publique – fonctionnaire, im Internet allgemein zugänglich unter: http://books.google.de/books?id=RF7OgGghOPs C&pg=PA262&dq=fonction+%C3%B6ffentlicher+ Dienst&hl=de#v=onepage&q=fonction&f=false,
wird der Begriff „fonctionnaire“ mit zwei Bedeutungen übersetzt, nämlich zum einen im engeren Sinne mit Beamter – beamtenrechtlich aber „agent titulaire“ (vgl. Doucet S. 362, 34) – und zum anderen im weiteren Sinne mit Amtsträger, Inhaber eines öffentlichen Amtes, Angehöriger des öffentlichen Dienstes. Dies entspricht im Übrigen auch der eigenen differenzierten Diktion des EGMR. Im Verfahren Pellegrin . /. Frankreich,
- 52 -
vgl. EGMR, Urteil vom 8. Dezember 1999 – 28541/95, Rdnr. 62, NVwZ 2000, 661 (663); im französischen Originaltext im Internet allgemein-zugänglich unter: http://cmiskp.echr.coe. int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action =html& highlight=28541/95&sessionid=86181956 &skin=hudoc-en,
hatte der EGMR zwischen den verschiedenen Bediensteten im öffentlichen Dienst zu unterscheiden, nämlich den Angestellten des öffentlichen Dienstes und den Beamten („Dans la présente affaire, les parties ont tiré argument de la distinction qui existe en France, comme dans d’autres Etats contractants, entre les deux catégories d’agents au service de l’Etat, ä savoir les agents contractuels et les agents titulaires“, vgl. französischer Originaltext, a. a. O.). Die Beamten wurden hier mit „agents titulaires“ bezeichnet, so dass der EGMR in dem Verfahren Enerji Yapi-Yol Sen . /. Türkei zur Überzeugung des Senats den Begriff - wie in der Übersetzung von Meyer-Ladewig/ Petzold, a. a. O. - im Sinne der „Angehörigen des öffentlichen Dienstes“ verwendet hat.
Vgl. zutreffend auch: Lindner, a. a. O., S. 307 (Fn. 22).
Hiervon ausgehend stellt das Streikverbot für Beamte in Deutschland kein Streikverbot für den gesamten öffentlichen Dienst dar. Nur im letzten Fall würde der EGMR auf der Basis dieses Urteils einen Verstoß gegen Art. 11 Abs. 1 EMRK sehen. In der Bundesrepublik Deutschland sind im öffentlichen Dienst neben den Beamten auch Angestellte und Arbeiter beschäftigt. Die Angestellten und Arbeiter - deren Arbeitsverhältnis im Gegensatz zu dem der Beamten privatrechtlich geregelt ist - haben auf der Grundlage der nach Art. 9 Abs. 3 GG gewährleisteten Tarifautonomie ein Streikrecht, so dass nicht der gesamte öffentliche Dienst einem Streikverbot unterliegt. Im Hinblick auf die unterschiedlich ausgestalteten Beschäftigungsverhältnisse - privatrechtlich auf der einen Seite und öffentlich-rechtlich auf der anderen Seite -, ist das Streikverbot für Beamte in Deutschland hinreichend bestimmt und begrenzt. Ein Streikrecht für Beamte oder zumindest diejenigen Beamten, die Hoheitsgewalt ausüben, ergibt sich mithin aus der Entscheidung des EGMR in dem Verfahren Enerji Yapi-Yol Sen . /. Türkei nicht. Abgesehen davon hat der EGMR in diesem Verfahren eine Beweislastentscheidung
- 53 -
getroffen und nicht gesagt, dass das Streikrecht im öffentlichen Dienst nicht beschränkt werden könne. Im Gegenteil, unter Rdnr. 32 der Entscheidungsgründe hat der EGMR ausgeführt, dass das Streikrecht nicht absolut sei. Es könne von Voraussetzungen abhängig gemacht und beschränkt werden. Am Ende der Entscheidungsgründe unter Rdnr. 32 hat er ausgeführt, dass die türkische Regierung „nicht nachgewiesen“ habe, dass die umstrittene Beschränkung in einer demokratischen Gesellschaft notwendig war („La Cour relève que le Gouvernement n’a pas démontré la nécessité dans une société démocratique de la restriction incriminée“, vgl. im französischen Original, a. a. O.). Auch dies ist nicht auf die Rechtslage in der Bundesrepublik Deutschland übertragbar, denn im deutschen Recht ist - wie bereits oben dargelegt - das Streikverbot für Beamte ein hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums, der unter dem Gesichtspunkt der Treuepflicht und der Erhaltung der Funktionsfähigkeit staatlichen Handelns zu den verfassungsrechtlichen Kernstrukturprinzipien gehört. Dass der Staat zumindest mit einem Teil seiner Beschäftigten im öffentlichen Dienst in jeder Lebens-und Notsituation handlungsfähig bleibt, ist gerade zur Aufrechterhaltung und Sicherung der demokratischen Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland notwendig, historisch verbürgt und verfassungsrechtlich verankert. Im Übrigen ergibt sich auch mit Blick auf das Prozessverhalten der Türkei in dem Verfahren Enerji Yapi-Yol Sen . /. Türkei keinerlei Aussagewert für das deutsche Beamtenrecht. Unzulänglichkeiten der Prozessführung eines am Verfahren beteiligten Konventionsstaates, der - wie hier die Türkei - die Notwendigkeit eines (im Übrigen generellen) Streikverbots im öffentlichen Dienst nach Auffassung des EGMR nicht hinreichend dargelegt hat, kommt kein Aussagewert im Hinblick auf die Rechtslage in den anderen Konventionsstaaten - hier insbesondere der Bundesrepublik Deutschland - zu. Der EGMR hat in dieser Entscheidung ausdrücklich ausgeführt, dass das Streikrecht von Voraussetzungen abhängig gemacht und eingeschränkt werden kann, wenn es denn notwendig ist. Dass ein Streikverbot für einen Teil des öffentlichen Dienstes - nämlich die Beamten - in der Bundesrepublik Deutschland notwendig ist, ist bereits oben ausgeführt worden.
Ein Streikrecht für deutsche Beamte lässt sich insbesondere auch nicht aus der Entscheidung des EGMR in dem Verfahren L1. und T1. . /. Türkei,
- 54 -
vgl. EGMR, Urteil vom 15. September 2009 - 30946/04, im Internet allgemein zugänglich unter: http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item= 1&portal=hbkm&action=html&highlight=30946/04 %20%7C%2030946/04&sessionid=86840536&sk in=hudoc-en,
ableiten. Abgesehen davon, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht Verfahrenspartei war, lässt sich der Entscheidung bereits nicht entnehmen, dass es sich bei den Beschwerdeführern dieses Verfahrens um Beamte - vergleichbar dem deutschen Recht - gehandelt hat bzw. dass das Bestehen eines entsprechenden öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses von entscheidungserheblicher Bedeutung war und dass die Rechtslage in der Türkei mit der deutschen Rechtslage insoweit überhaupt vergleichbar ist. Die Beschwerdeführer waren Lehrer und Mitglieder im Gewerkschaftsbund der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (Kesk). Am 11. Dezember 2003 nahmen sie einem Aufruf der Kesk folgend an einem nationalen Aktionstag teil, um gegen den Gesetzentwurf über die Organisation des öffentlichen Dienstes zu protestieren, der im türkischen Parlament debattiert wurde. Auf der Grundlage des Art. 125 (A) des Gesetzes Nr. 657 erhielten sie am 15. Januar 2004 zum Zwecke der Verteidigung der nationalen und öffentlichen Sicherheit, der Aufrechterhaltung der Ordnung und Verhütung von Straftaten eine „Warnung“ als Disziplinarmaßnahme. Der EGMR sah keine notwendige Rechtfertigung in dieser Maßnahme und stellte u.a. eine Verletzung des Art. 11 EMRK fest, sah aber keine Veranlassung für eine Entschädigung. Dieser Entscheidung kann nicht entnommen werden, dass der EGMR von einem Streikrecht für deutsche Beamte ausgeht oder dass er aus Art. 11 EMRK ein solches Streikrecht für deutsche Beamte ableitet. Dass in dem Verfahren L1. und T1. . /. Türkei gegen die Beschwerdeführer eine „Warnung“ nach dem türkischen „Beamten“-gesetz ausgesprochen wurde, besagt nicht, dass es sich bei den Beschwerdeführern um Beamte - vergleichbar dem deutschen Beamtenrecht - gehandelt hat. Denn gemäß Art. 128 und 129 der türkischen Verfassung (im Internet allgemein abrufbar unter: http://www.verfassungen.eu/tr/ index.htm) und dem türkischen Gesetz Nr. 657 v. 14. Juli 1965 (RG Mr- 12056 v. 23. Juli 1965; vgl. auch Gutachten Dr. D2. S1. für das Arbeitsgericht L. v. 18. Dezember
2003 – Az: 14 (1) Ca 7860/01, im Internet allgemein abrufbar unter: www.tuerkei-
- 55 -
recht.de/downloads/ gutachten-arbg-koeln.pdf) unterliegen in der Türkei - im Gegensatz zu dem deutschen Recht - neben Beamten („memur“) auch die übrigen Angestellten („sözlesmeli personel“) und Arbeiter („isci“) im öffentlichen Dienst dem Disziplinarrecht. Der Entscheidung lässt sich mithin nicht entnehmen, dass die beiden Lehrer Beamte - vergleichbar dem deutschen Recht - waren oder dass der EGMR hier bewusst eine Entscheidung im Hinblick auf Beamte getroffen hat. Die Entscheidung beinhaltet - zumal sie sich auch auf die Türkei bezieht - insbesondere keinen Tenor dahingehend, dass sich beamtete Lehrer in der Bundesrepublik Deutschland auf ein nach Art. 11 EMRK völkerrechtlich verankertes Streikrecht berufen können. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass auch in der Bundesrepublik Deutschland ein generelles Streikverbot für Lehrer nicht besteht, da diejenigen Lehrer, die sich in einem Angestelltenverhältnis befinden, ein Streikrecht haben. Darüber hinaus zeigt der der Entscheidung zugrunde liegende Sachverhalt, dass die türkische Rechtslage nicht mit der Rechtslage in der Bundesrepublik Deutschland vergleichbar ist, denn in dem Verfahren L1. und T1. . /. Türkei ging es um einen sog. „politischen“ Streik, da sich die Streikenden gegen einen Gesetzentwurf gewandt haben und sich damit nicht für ein tariffähiges Ziel eingesetzt haben. Derartige „politische“ Streiks sind in Deutschland,
vgl. hierzu im Einzelnen: BAG, Urteile vom 27. Juni 1989 - 1 AZR 404/88 -, BAGE 62, 171, und vom 5. März 1985 - 1 AZR 468/83 -, BAGE 48, 160; Beschluss vom 23. Oktober 1984 - 1 AZR 126/81 -, DB 1985, 1239; ArbG Osnabrück, Urteil vom 4. Juni 1996 - 4 Ga 10/96 -, NZA-RR 1996, 341; Scholz, in: Maunz/Dürig, GG, Bd. II, Art. 9 Rdnr. 375; Schweiger/Brandl, Der Kampf um Arbeit, 2010, S. 60,
selbst für Angestellte und Arbeiter nicht von der Koalitionsfreiheit nach Art. 9 Abs. 3 GG erfasst, da solche Streikmaßnahmen nicht tariffähigen Zielen und damit nicht der Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen dienen. Hierbei handelt es sich um ein verfassungsrechtlich verankertes Kernstrukturprinzip in der Bundesrepublik Deutschland und um eine historisch und rechtspolitisch gewachsene Besonderheit im deutschen Rechtssystem. Die insoweit die Türkei betreffende Entscheidung zeigt damit weder in tatsächlicher noch in rechtlicher Hin-
- 56 -
sicht eine Vergleichbarkeit zum deutschen Rechtssystem - insbesondere Beamtenrecht - auf, noch lassen sich - mangels einer entsprechenden Vergleichbarkeit der Fallkonstellationen - hieraus völkerrechtliche Rückschlüsse daraus ziehen, dass auch den deutschen Beamten mit Blick auf Art. 11 EMRK i.V.m. Art. 9 Abs. 3 GG ein Streikrecht zustehen müsse.
Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der von der Klägerin zitierten Entscheidung des EGMR in dem Verfahren D. . /. Türkei.
Vgl. EGMR, Urteil vom 13. Juli 2010 - 333222/07, im Internet allgemein zugänglich unter: http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item= 1&portal=hbkm&action=html&highlight=33322/07 %20%7C%2033322/07&sessionid=86846802&sk in=hudoc-en,
Zum einen ist auch hier die Bundesrepublik Deutschland nicht Verfahrenspartei gewesen. Zum anderen kann der in dieser Entscheidung verwendete Begriff „agents publics“ (vgl. Nr. 13 der französischen Originalfassung, a. a. O.) ebenfalls sowohl Beamter als auch Angestellter des öffentlichen Dienstes bedeuten,
vgl. Doucet, a. a. O., S. 34 zum Begriff „agent public“,
und das türkische Gesetz Nr. 657 betrifft - wie bereits oben ausgeführt - alle An-gehörigen des öffentlichen Dienstes (Beamte, Angestellte und Arbeiter), so dass auch dieser Entscheidung nicht zu entnehmen ist, dass es sich bei dem Beschwerdeführer um einen Beamten - vergleichbar dem deutschen Recht - gehandelt hat oder dass ein Beamtenstatus des Beschwerdeführers in diesem Verfahren überhaupt von Relevanz war. Der Sachverhalt zeigt auch im Übrigen sowohl in rechtlicher als auch in tatsächlicher Hinsicht keine Vergleichbarkeit zur deutschen Rechtslage auf. Es ging in dem Verfahren D. . /. Türkei um die Teilnahme an einem nationalen Aktionstag am 1. Mai 2007, um den Tag der Arbeit zu feiern. In der Bundesrepublik Deutschland ist der 1. Mai bekanntlich ein gesetzlicher Feiertag, so dass eine Teilnahme an entsprechenden Aktionen auch für Beamte - soweit sie nicht zu Feiertagsdienst eingeteilt sind - unproblematisch wäre. Inwieweit sich hieraus eine Vergleichbarkeit der Sach- und Rechtslage und
- 57 -
insbesondere ein Streikrecht für beamtete Lehrer - wie die Klägerin - ableiten soll, ist nicht ersichtlich. Aber selbst wenn man den in dem Verfahren D. . /. Türkei entschiedenen Sachverhalt auf einen normalen Arbeitstag in der Bundesrepublik Deutschland übertragen würde, lässt sich hieraus ein Streikrecht für deutsche Beamte nicht ableiten. Der EGMR hat in anderem Zusammenhang in der letzten Zeit bereits häufiger in seinen Entscheidungen darauf abgestellt, dass sich die Staaten in Europa historisch sehr unterschiedlich entwickelt haben, dass diesen Besonderheiten auch bei der Auslegung der EMRK Rechnung zu tragen ist und dass die Entscheidung darüber, ob eine historisch verbürgte Tradition aufrecht erhalten werden soll, grundsätzlich in den Ermessensspielraum („margin of appreciation“) des verantwortlichen Staates falle,
vgl. EGMR, Urteile vom 18. März 2011 – 30814/06, NVwZ 2011, 737, im englischen Originaltext im Internet allgemein zugänglich abrufbar unter: http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=308 14/06&sessionid=86181956&skin=hudoc-en (Rdnr. 68); und vom 21. September 2010 - 66686/09, NVwZ 2011, 31; siehe auch Battis, Streikrecht für Beamte ?, ZBR 2011, 397 (400),
so dass auch vor diesem Hintergrund und mit Blick auf die historische Entwicklung des Berufsbeamtentums und der verfassungsrechtlichen Verankerung der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums in der Bundesrepublik Deutschland nichts dafür ersichtlich ist, dass die Rechtslage in der Türkei - die allein zur Entscheidung stand - mit der in der Bundesrepublik Deutschland vergleichbar ist. Bei dem deutschen Berufsbeamtentum handelt es sich um dogmatisch ausdifferenzierte nationale Regelungen im Hinblick auf das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis, die historisch gewachsen und verfassungsrechtlich verbürgt sind. Unter Berücksichtigung dieser Besonderheiten lässt sich jedenfalls der Entscheidung D. . /. Türkei nicht entnehmen, dass das in der Bundesrepublik Deutschland in Art. 33 Abs. 5 GG als hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentum enthaltene Streikverbot für Beamte gegen Art. 11 EMRK verstößt.
- 58 -
cc. Aber selbst wenn man davon ausginge, dass die EMRK ein Streikrecht auch für deutsche Beamte oder zumindest für diejenigen, die nicht hoheitsrechtliche Funktionen wahrnehmen, verbürgen würde,
so VG Kassel, Urteil vom 27. Juli 2011 - 28 K 1208/10.KS.D -, a. a. O.; Niedobitek, a. a. O., S. 368; Lörcher, Der Personalrat 2011, 452 f.,
wird hierdurch das in Art. 33 Abs. 5 GG verfassungsrechtlich verankerte Streikverbot für deutsche Beamte nicht in Frage gestellt. Die EMRK und ihre Zusatzprotokolle sind - wie bereits oben dargestellt - völkerrechtliche Verträge, denen der Bundesgesetzgeber jeweils mit förmlichen Gesetz gemäß Art. 59 Abs. 2 GG zugestimmt hat und die in der deutschen Rechtsordnung im Range eines Bundesgesetzes stehen. Die Rangzuweisung führt dazu, dass deutsche Gerichte die Konvention wie anderes Gesetzesrecht des Bundes im Rahmen methodisch vertretbarer Auslegung zu beachten und anzuwenden haben. Die Rangzuordnung bedeutet aber auch, dass die EMRK im deutschen Rechtsanwendungsbereich an dem Grundgesetz zu messen ist. Das Grundgesetz erstrebt die Einfügung Deutschlands in die Rechtsgemeinschaft friedlicher und freiheitlicher Staaten, so dass die EMRK und die Rechtsprechung des EGMR als Orientierungs- und Auslegungshilfe bei der Anwendung von Grundrechten heranzuziehen sind. Dies ist letztlich Ausdruck der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes. Die Heranziehung der EMRK als Orientierungs- und Auslegungshilfe verlangt allerdings keine schematische Parallelisierung. Die Rechtsprechung des EGMR und die EMRK sind auf der Ebene des einfachen Rechts möglichst schonend in das vorhandene, dogmatisch ausdifferenzierte nationale Rechtssystem einzupassen, weshalb sich eine unreflektierte Adaption völkerrechtlicher Begriffe verbietet. Die Grenzen der völkerrechtlichen Auslegung ergeben sich aus dem Grundgesetz. Das „letzte Wort“ haben für den deutschen Rechtsanwendungsbereich mithin das Grundgesetz und die darin verankerten ausdifferenzierten verfassungsrechtlichen Gewährleistungen. Dies ist Ausdruck der Souveränität Deutschlands. Die Möglichkeiten einer konventionsfreundlichen Auslegung von Grundrechten endet mithin dort, wo diese nach den anerkannten Methoden der Gesetzesauslegung und Verfassungsinterpretation nicht mehr vertretbar erscheint, insbesondere dann, wenn hierdurch die verfassungsrechtliche Kernstruktur in Frage gestellt würde.
- 59 -
Vgl. BVerfG, Beschlüsse vom 14. Oktober 2004 - 2 BvR 1481/04 -, a. a. O., und vom 19. September 2007 - 2 BvF 3/02 -, a. a. O.
Will man den Inhalt und die Reichweite der im Grundgesetz garantierten Grundrechte über den Kernbestand an Strukturprinzipien hinaus modifizieren, ist es Sache des Verfassungsgesetzgebers das Grundgesetz entsprechend abzuändern. Die Fachgerichte hingegen sind unter Berücksichtigung des Hierarchieverhältnisses zwischen Verfassungsrecht und einfachem Recht an die Vorgaben des Grundgesetzes und die Auslegung des Grundgesetzes durch das Bundesverfassungsgericht gebunden.
Hiervon ausgehend verstößt - wie bereits oben dargestellt - ein Streikrecht für Beamte in Deutschland gegen die hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums nach Art. 33 Abs. 5 GG. Die Treuepflicht der Beamtenschaft - ein damit nicht zu vereinbarendes Streikrecht - und das dieser Treuepflicht (als Synallagma) korrespondierende Alimentationsprinzip gehören zu dem Kernbestand an verfassungsrechtlichen Strukturprinzipien, die die Funktionalität des deutschen Staates sicherstellen sollen und die einer anderen inhaltlichen Ausgestaltung durch bloße Auslegung entzogen sind. Dies gilt für das Streikverbot der Beamtenschaft als Gesamtheit, so dass wegen der statusbezogenen Ausprägung des Beamtenrechts - wie bereits oben dargestellt - auch eine funktionsbezogene Differenzierung nach den geltenden verfassungsrechtlichen Maßstäben nicht möglich ist. Auch wenn z.B. Lehrer - wie die Klägerin - nicht schwerpunktmäßig hoheitlich geprägte Aufgaben wahrnehmen, kommt den beamteten Lehrern ein Streikrecht verfassungsrechtlich nicht zu. Die Treuepflicht der Beamtenschaft, die in einer Vielzahl von beamtenrechtlichen Bestimmungen ihre konkrete Ausprägung erfahren hat (vgl. §§ 34 ff. LBG NRW a.F.; §§ 33 ff. BeamtStG etc.) differenziert nicht nach dem jeweiligen Tätigkeitsbereich des Beamten. Die rechtliche Stellung der Beamten ist gleich, und zwar unabhängig davon, ob sie in ihrem konkreten Tätigkeitsbereich hoheitliche Aufgaben wahrnehmen oder nicht. Auf die Frage, ob der jeweilige Beamte in seiner konkreten Funktion hoheitlich in Rechte anderer eingreift, kommt es mithin nicht an. Auch die Fortentwicklungsklausel in Art. 33 Abs. 5 GG ändert hieran nichts. Denn Änderungen, die - wie
- 60 -
hier - mit dem Kernbestand der Grundstrukturen des von Art. 33 Abs. 5 GG geschützten Berufsbeamtentums nicht in Einklang gebracht werden können, verstoßen auch weiterhin gegen die Vorgaben des Grundgesetzes.
Vgl. auch VG Osnabrück, Urteil vom 19. August 2011 - 9 A 1/11 -, a. a. O.; Kutzki, a. a. O., S. 169 f.; Seifert, a. a. O., S. 373 f.
b. Auch aus anderen völker- und europarechtlichen Übereinkommen und Regelungen lässt sich ein Streikrecht für deutsche Beamte nicht ableiten.
aa. Insbesondere den ILO-Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation Nr. 87 (Übereinkommen über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechts, 1948),
vgl. im Internet allgemein zugänglich unter:
http://www.ilo.org/ilolex/german/docs/gc087.htm,
und Nr. 98 (Übereinkommen über die Anwendung der Grundsätze des Vereinigungsrechts und des Rechts zu Kollektivverhandlungen, 1949),
vgl. im Internet allgemein zugänglich unter:
http://www.ilo.org/ilolex/german/docs/gc098.htm,
kommen im Vergleich zur EMRK im deutschen Recht keine über den Rang eines einfachen Bundesgesetzes hinausgehende Wirkung zu (Art. 59 Abs. 2 GG) und sind daher ebenfalls an Art. 33 Abs. 5 GG zu messen. Abgesehen davon sind diese Abkommen auf Beamte nicht anwendbar.
Vgl. Art. 6 ILO-Übereinkommen Nr. 98; Stellungnahme der Bundesregierung zu dem ILO-Über-einkommen Nr. 151, BT-Drucks. 10/2123, S. 8.
Das ILO-Übereinkommen Nr. 151 (Übereinkommen über den Schutz des Vereinigungsrechts und über Verfahren zur Festsetzung der Beschäftigungsbedingungen im öffentlichen Dienst, 1978),
vgl. im Internet allgemein zugänglich unter:
http://www.ilo.org/ilolex/german/docs/gc151.htm,
- 61 -
ist von der Bundesrepublik Deutschland nicht ratifiziert worden, weil nicht auszuschließen war, dass die Interpretation der Art. 7 und 8 dieses Übereinkommens durch die zuständigen Gremien der Internationalen Arbeitsorganisation in einer Weise erfolgen könne, dass diese Bestimmungen mit der innerstaatlichen Rechtslage nicht vereinbar sind.
Vgl. Stellungnahme der Bundesregierung zu dem ILO-Übereinkommen Nr. 151, BT-Drucks. 10/2123, S. 8; Kutzki, a. a. O., S. 170; Seifert, a. a. O., S. 366.
bb. Auch aus unmittelbar geltenden EU-Recht ergibt sich kein Streikrecht der deutschen Beamten. Die EU-Verträge räumen der Europäischen Union nicht die Kompetenz ein, das Streikrecht zu regeln. Art. 153 Abs. 5 AEUV, wonach die Regelungen in Art. 153 Abs. 1 bis 4 AEUV nicht für das Arbeitsentgelt, das Koalitionsrecht, das Streikrecht sowie das Aussperrungsrecht gilt, schließt eine derartige Kompetenz ausdrücklich aus. Auch aus Art. 6 Abs. 1 EUV i.V.m. der Grundrechtecharta (EU-GRCharta), die nunmehr den Rang des EU-Primärrechts hat, ergibt sich kein Streikrecht für Beamte. Zwar beinhaltet Art. 12 Abs. 1 EU-GRCharta das Vereinigungsrecht und Art. 28 EU-GRCharta das Recht auf Kollektivverhandlungen und Kollektivmaßnahmen, das auch das Streikrecht erfasst. Nach Maßgabe des Art. 51 Abs. 1 EU-GRCharta bindet die Europäische Grundrechtecharta in erster Linie aber nur die Organe der Europäischen Union. Für die Mitgliedstaaten sind die Verbürgungen der Grundrechtecharta „ausschließlich bei der Durchführung des Rechts der Union“ zu beachten. Gemäß Art. 6 EUV werden durch die Bestimmungen der Charta die in den Verträgen festgelegten Zuständigkeiten in keiner Weise erweitert. Die Regelung des innerstaatlichen Beamtenrechts stellt keine Durchführung des EU-Rechts dar. Es verbleibt hierbei bei der originären Kompetenz der Mitgliedstaaten (Art. 4 Abs. 1 EUV). Da die Europäische Union mit Blick auf den in Art. 5 Abs. 1 Satz 1 EUV geregelten Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung keine Regelungskompetenz für das Arbeitskampfrecht hat, kann eine solche auch nicht über Art. 28 EU-GRCharta begründet werden.
- 62 -
Vgl. VG Osnabrück, Urteil vom 19. August 2011 - 9 A 1/11 -, a. a. O; Lindner, a. a. O., S. 309; Kutzki, a. a. O., S. 170.
3.) Die Arbeitsniederlegung der Klägerin wegen der Teilnahme an den Warnstreiks am 28. Januar 2009, 5. Februar 2009 und 10. Februar 2009 war auch nicht durch § 103 LBG a.F. gerechtfertigt. Nach § 103 Abs. 1 Satz 1 LBG a.F. haben die Beamten das Recht, sich in Gewerkschaften oder Berufsverbänden zusammenzuschließen, und nach Absatz 2 dieser Regelung darf kein Beamter wegen der Betätigung für seine Gewerkschaft oder seinen Berufsverband dienstlich gemaßregelt oder benachteiligt werden. Diese einfachgesetzliche Regelung steht jedoch unter dem Vorbehalt, dass die gewerkschaftlichen Betätigungen mit den verfassungsrechtlich geregelten und höherrangigen hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums (Art. 33 Abs. 5 GG) im Einklang stehen, was jedoch im Falle eines Streiks - wie oben dargestellt - nicht der Fall ist.
Vgl. hierzu auch: Hildebrandt/Demmler/Bachmann, Beamtengesetz für das Land NRW,
§ 103 Rdnr. 1. § 103 LBG a.F. gewährt damit kein Arbeitskampfrecht für Beamte.
V. Dadurch, dass die Klägerin am 28. Januar, 5. Februar und 10. Februar 2009 an den Warnstreiks teilnahm und unentschuldigt ihrer Unterrichtspflicht nicht nachkam, hat sie die unter II. 1 bis 4 dargestellten Dienstpflichten schuldhaft verletzt. Insbesondere kann sie sich nicht auf einen das Verschulden ausschließenden Verbotsirrtum (vgl. § 17 Abs. 1 Satz 1 StGB) berufen. Durch die Gespräche mit der Konrektorin ihrer Schule vom 23. Januar 2009, mit der Schulleiterin am 26. Januar 2009 und aufgrund des Schreibens der Schulleiterin vom 9. Februar 2009 ist die Klägerin ausdrücklich auf die Unzulässigkeit ihrer geplanten und ungenehmigten Streikteilnahme hingewiesen worden. Ihre abweichende Haltung konnte die Klägerin auch nicht auf eine gegenläufige Rechtsprechung stützen. Die wesentlichen, hier interessierenden Entscheidungen des EGMR sind erst nach dem relevanten Zeitraum ergangen und geben noch dazu - wie ausgeführt wurde - für ein Streikrecht der Beamten in Deutschland nichts her. Sonstige An-
- 63 -
haltspunkte für eine Schuldunfähigkeit oder eine verminderte Schuldfähigkeit bestehen nicht und sind seitens der Klägerin auch nicht vorgetragen worden.
VI. Das beklagte Land hat gegen die Klägerin zu Recht mit der streitbefangenen Disziplinarverfügung vom 10. Mai 2010 eine Geldbuße i.H.v. 1.500,00 Euro verhängt.
1. Die vom beklagten Land verhängte Disziplinarmaßnahme ist im Hinblick auf die Schwere des von der Klägerin begangenen einheitlichen innerdienstlichen Dienstvergehens angemessen.
Nach Maßgabe des § 59 Abs. 3 Satz 1 LDG NRW prüft das Gericht bei der Klage gegen eine Disziplinarverfügung neben der Rechtmäßigkeit auch die Zweckmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung. Aus der vergleichbaren Vorschrift des § 60 Abs. 3 BDG leitet das Bundesverwaltungsgericht,
vgl. BVerwG, Urteil vom 15. Dezember 2005 - 2 A 4.04 -, Schütz/Maiwald, Beamtenrecht in Bund und Ländern, ES/B II 1.1 Nr. 13 = Buchholz 235.1 § 24 BDG Nr. 1,
ab, dass das Gericht nicht auf die Prüfung der Frage beschränkt ist, ob das der Klägerin mit der Disziplinarverfügung zum Vorwurf gemachte Verhalten (Lebenssachverhalt) tatsächlich vorliegt und als Dienstvergehen zu würdigen ist. Das Gericht hat vielmehr unter Beachtung des Verschlechterungsverbots auch darüber zu entscheiden, welches die angemessene Disziplinarmaßnahme ist. Anders als sonst bei einer Anfechtungsklage ist das Gericht danach nicht gemäß § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO darauf beschränkt, eine rechtswidrige Verfügung aufzuheben; es trifft in Anwendung der in § 13 Abs. 1 LDG NRW niedergelegten Grundsätze innerhalb der durch die Verfügung vorgegebenen Obergrenze vielmehr eine eigene Ermessensentscheidung. Der Hinweis des Bundesverwaltungsgerichts auf den wortgleichen § 13 BDG besagt, dass auch bei einer Klage gegen eine Disziplinarverfügung über die Disziplinarmaßnahme unter Berücksichtigung der Schwere des Dienstvergehens, des Persönlichkeitsbildes des Beamten sowie der Beeinträchtigung des Vertrauens des Dienstherrn oder der Allgemeinheit nach pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden ist.
- 64 -
Vgl. OVG NRW, Beschluss vom 19. September 2007 - 21d A 2259/07.O -.
Welche Disziplinarmaßnahme im Einzelfall erforderlich ist, richtet sich gemäß § 13 Abs. 2 Satz 1 bis 3 LDG NRW nach der Schwere des Dienstvergehens unter angemessener Berücksichtigung der Persönlichkeit des Beamten und des Umfangs der durch das Dienstvergehen herbeigeführten Vertrauensbeeinträchtigung.
Eine objektive und ausgewogene Zumessungsentscheidung setzt voraus, dass die sich aus § 13 Abs. 2 Satz 1 bis 3 LDG NRW ergebenden Bemessungskriterien mit den ihnen im Einzelfall zukommenden Gewicht ermittelt (vgl. § 21 Abs. 1 Satz 2 LDG NRW) und in die Entscheidung eingestellt werden. Dieses Erfordernis beruht letztlich auf dem im Disziplinarverfahren geltenden Schuldprinzip und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Danach muss die gegen den Beamten ausgesprochene Disziplinarmaßnahme unter Berücksichtigung aller belastenden und entlastenden Umstände des Einzelfalls in einem gerechten Verhältnis zur Schwere des Dienstvergehens und zum Verschulden des Beamten stehen.
Vgl. BVerfG, Beschluss vom 8. Dezember 2004 - 2 BvR 52/02 -, NJW 2005, 1344, 1346.
Bei der Auslegung des Begriffs "Schwere des Dienstvergehens" ist maßgebend auf das Eigengewicht der Verfehlung abzustellen. Hierfür können bestimmend sein objektive Handlungsmerkmale (insbesondere Eigenart und Bedeutung der Dienstpflichtverletzung, z.B. Kern- oder Nebenpflichtverletzung, sowie besondere Umstände der Tatbegehung, z.B. Häufigkeit und Dauer eines wiederholten Fehlverhaltens), subjektive Handlungsmerkmale (insbesondere Form und Gewicht der Schuld des Beamten, Beweggründe für sein Verhalten) sowie unmittelbare Folgen des Dienstvergehens für den dienstlichen Bereich und für Dritte (z.B. materieller Schaden).
Wenn es in § 13 Abs. 2 Satz 2 LDG NRW heißt, das Persönlichkeitsbild des Beamten sei angemessen zu berücksichtigen, so bedeutet dies, dass es für die Bestimmung der Disziplinarmaßnahme auch auf die persönlichen Verhältnisse und
- 65 -
das sonstige dienstliche Verhalten des Beamten vor, bei und nach dem Dienstvergehen ankommt, insbesondere soweit es mit seinem bisher gezeigten Persönlichkeitsbild übereinstimmt oder davon abweicht.
In Anwendung dieser Grundsätze pflichtet der erkennende Senat dem beklagten Land darin bei, dass sich die Klägerin mit dem hier vorliegend zu beurteilenden Verhalten eines schweren einheitlichen innerdienstlichen Dienstvergehens im Kernbereich ihres Pflichtenkreises schuldig gemacht hat. Der Klägerin oblag es, auch am 28. Januar, 5. Februar und 10. Februar 2009 ihrer Unterrichts- und Dienstverpflichtung nachzukommen und gegenüber den ihr anvertrauten Schülern den staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag (§ 2 SchulG NRW) zu erfüllen. Trotz mehrerer Hinweise ihrer Vorgesetzten, dass die Teilnahme an den Warnstreiks einen Verstoß gegen ihre beamtenrechtlichen Dienst- und Treuepflichten darstellt, ist sie dem Dienst ferngeblieben. Neben der Qualität dieses Verstoßes gegen ihre Dienstpflichten fällt bei der Bemessung der Disziplinarmaßnahme auch ins Gewicht, dass es sich um eine wiederholte Verfehlung handelt. Die Klägerin ist im vorliegenden Fall nicht lediglich eine Schulstunde dem Dienst ferngeblieben. Sie ist vielmehr an drei kompletten Schultagen dem Dienst ohne Genehmigung des Dienstherrn ferngeblieben. Durch die Streikteilnahme der Klägerin waren an den drei Tagen insgesamt 12 Unterrichtsstunden betroffen, von denen acht Stunden ersatzlos ausfielen. Allein an ihrem ersten Streiktag, dem 28. Januar 2009 fielen die erste und zweite Unterrichtstunde (Sport in der Klasse 7c) sowie die fünfte und sechste Unterrichtsstunde (Sport in der Klasse 5d) ersatzlos aus. Dieses Verhalten zeigt ein besonders hohes Maß an Pflichtvergessenheit und Verantwortungslosigkeit auf. Die Klägerin hat sich nicht darum gekümmert, ob die Betreuung der ihr anvertrauten Schülerinnen und Schüler ebenso wie der durch ihr Verhalten verursachte Unterrichtsausfall von anderen Lehrern, die dem Streikaufruf der GEW nicht gefolgt waren, übernommen werden konnte. Hierdurch ist das Vertrauen des Dienstherrn, aber auch der Allgemeinheit - wie der Eltern und Schüler - in ihre Zuverlässigkeit und in ihr Verantwortungsbewusstsein als beamtete Lehrerin in erheblichem Maße beeinträchtigt worden. Die Klägerin hat ihre eigenen u.a. wirtschaftlichen Interessen - insbesondere auch den Arbeitskampf für eine höhere Besoldung - über ihre Dienstpflichten ge-
- 66 -
stellt und dies auf dem Rücken der Schülerinnen und Schüler ausgetragen, die ihrerseits ihrer Schulpflicht (§§ 34 ff. SchulG NRW) nachgekommen waren. Dabei fällt besonders die Hartnäckigkeit der Klägerin ins Gewicht, die sich auch angesichts des von ihr verursachten Unterrichtsausfalls am ersten Streiktag sowie der im Vorfeld geführten Gespräche mit ihrer Konrektorin sowie ihrer Schulleiterin nicht davon hat abhalten lassen, sich über ihre Dienstpflichten hinwegzusetzen und rechtswidrig an den Streikmaßnahmen an drei Tagen teilzunehmen.
Für die Klägerin spricht, dass sie bislang weder strafrechtlich noch disziplinarrechtlich vorbelastet ist. Für die Klägerin spricht auch, dass sie sich in der Folgezeit darum bemüht hat, Vertretungsunterricht zu übernehmen. Insgesamt hat sie 17 Schulstunden Vertretungsunterricht geleistet, die nicht über Mehrarbeit vergütet wurden. Allerdings wurden von ihr nicht diejenigen Unterrichtsstunden in den Klassen nachgeholt, die am 28. Januar 2009, 5. Februar 2009 und 10. Februar 2009 wegen ihrer Streikteilnahme ausgefallen waren bzw. fachfremd erteilt worden sind. Weitere in den Umständen des Falles oder in der Persönlichkeit der Klägerin liegende durchgreifende Milderungsgründe sind weder ersichtlich noch vorgetragen.
Unter Abwägung aller für und gegen die Klägerin sprechenden Gesichtspunkte ist die Verhängung einer Disziplinarmaßnahme unabweisbar, um die begangene Dienstpflichtverletzung zu ahnden und die Klägerin künftig zur Einhaltung ihrer Dienstpflichten im Interesse eines ordnungsgemäßen Schulbetriebs anzuhalten. Ihre Beteuerung, sich künftig rechtmäßig zu verhalten, reicht nicht. Die verhängte Disziplinarmaßnahme ist auch erforderlich, um andere Lehrer künftig von der rechtswidrigen Teilnahme an Streikmaßnahmen abzuhalten. Mit Blick auf die Schwere des Dienstvergehens einerseits und unter Berücksichtigung des Bemühens der Klägerin, wenigstens ihren Dienst „nachzuleisten“ erweist sich die verhängte Geldbuße i.H.v. 1.500,00 Euro als angemessene Disziplinarmaßnahme. Die Geldbuße als einmalige Pflichtenermahnung genügt auch nach Auffassung des Senats im vorliegenden Fall, um die Klägerin künftig zur Einhaltung ihrer Dienstpflichten zu bewegen. Auch die Höhe der verhängten Geldbuße erweist sich als angemessen. Nach Maßgabe des 7 Abs. 1 LDG NRW kann eine Geldbuße bis zur Höhe der monatlichen Dienstbezüge auferlegt werden. Hinter die-
- 67 -
sem Höchstbetrag der Geldbuße ist der Dienstherr deutlich zurückgeblieben. Die Geldbuße umfasst in etwa die Hälfte der monatlichen Brutto-Dienstbezüge der Klägerin. Ein niedrigerer Betrag kam mit Blick auf den besonders hartnäckigen Gehorsamsverstoß und die Schwere des Dienstvergehens, insbesondere unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Klägerin ihre Dienst- und Unterrichtspflicht an insgesamt drei Tagen verweigert hat, nicht in Betracht. Besondere - zu berücksichtigende - finanzielle Belastungen sind seitens der Klägerin nicht geltend gemacht worden. Der Betrag i.H.v. 1.500,00 Euro (je Tag der Streikteilnahme von 500,00 Euro) ist gegenüber der Klägerin als Pflichtenmahnung erforderlich und auch angemessen. Die in der Disziplinarmaßnahme liegende Härte für die Beamtin ist nicht unverhältnismäßig. Sie beruht auf dem ihr zurechenbaren vorangegangenen Fehlverhalten, wobei es für sie vorhersehbar war, was sie damit aufs Spiel setzte.
C. Das Disziplinarverfahren ist entgegen der Ansicht des Verwaltungsgerichts Düsseldorf nicht nach § 33 LDG NRW einzustellen.
I. Entgegen der Ansicht des Verwaltungsgerichts hätte das vorliegende Disziplinarverfahren nicht nach § 33 Abs. 1 Nr. 4 LDG NRW von dem Dienstherrn der Klägerin eingestellt werden müssen. Nach Maßgabe dieser Regelung wird das Disziplinarverfahren eingestellt, wenn das Disziplinarverfahren oder eine Disziplinarmaßnahme aus sonstigen Gründen unzulässig ist. Diese Tatbestandsvoraussetzungen liegen im vorliegenden Fall jedoch nicht vor. Der Auffangtatbestand nach § 33 Abs. 1 Nr. 4 LDG NRW betrifft Verfahrensfehler und kommt zum Tragen, wenn ein Disziplinarverfahren nicht wirksam eingeleitet wurde, z.B. eine unzuständige Behörde gehandelt hat oder nicht erkennbar ist, auf welchen Sachverhalt das Dienstvergehen gestützt wird, und eine spätere Heilung der Verfahrensfehler nicht erfolgt ist bzw. aus Rechtsgründen nicht eintreten konnte. Auch dann, wenn trotz Verbrauchs der Disziplinarbefugnis ein Disziplinarverfahren eingeleitet wird oder wenn die Voraussetzungen des persönlichen (§ 1 LDG NRW) oder sachlichen (§ 2 LDG NRW) Geltungsbereichs fehlen oder weggefallen sind, kommt eine Einstellung nach § 33 Abs. 1 Nr. 4 LDG in Betracht.
- 68 -
Vgl. zum wortgleichen § 32 Abs. 1 Nr. 4 BDG: Wittkowski, in: Urban/Wittkowski, BDG, 2011, § 32 Rdnr. 7; Gansen, Disziplinarrecht in Bund und Ländern, Bd. 1, § 32 Rdnr. 10; Hummel, in: Hummel/ Köhler/Mayer, BDG, § 32 Rdnr. 9 u. 10.
Ein solcher Sachverhalt liegt hier nicht vor. Das Verwaltungsgericht hat im vorliegenden Verfahren selbst erkannt, dass hier die zuständige Behörde ein Disziplinarverfahren gegen die Klägerin nach § 17 LDG NRW einzuleiten hatte, da die Klägerin - eine Beamtin - ein Dienstvergehen begangen hatte, und dass der Disziplinarmaßnahme auch nicht die Regelungen in den §§ 14, 15 LDG NRW i.V.m. § 17 Abs. 2 LDG NRW entgegen gestanden haben. Die Annahme des Verwaltungsgerichts, im vorliegenden Fall sei eine Disziplinarmaßnahme „aus sonstigen Gründen“ unzulässig, nämlich „wegen Verstoßes gegen die EMRK“, teilt der erkennende Senat aus mehreren Gründen nicht. Zum einen stellt das verfassungsrechtlich verankerte Streikverbot für Beamte in der Bundesreplik Deutschland - wie bereits oben dargelegt - keinen Verstoß gegen Art. 11 EMRK dar. Zum anderen verkennt das Verwaltungsgericht die Rangordnung der EMRK im deutschen Rechtssystem als einfaches Bundesgesetz, das letztlich an dem Grundgesetz als höherrangiger Norm zu messen ist. Selbst wenn man aus der EMRK und der Rechtsprechung des EGMR ein generelles Streikrecht für deutsche Beamte - oder zumindest für diejenigen, die keine hoheitsrechtliche Funktionen ausüben - ableiten wollte, hindert dies in der Bundesrepublik Deutschland den jeweiligen Dienstherrn rechtlich nicht, gegen Beamte - die ihrer Dienst- und Gehorsamspflicht wegen eines Streiks nicht nachkommen - ein Disziplinarverfahren einzuleiten und eine Disziplinarmaßnahme zu verhängen oder gar zum Zwecke der Entfernung aus dem Beamtenverhältnis gegen den Beamten eine Disziplinarklage zu erheben. Der Senat hat bereits oben ausgeführt, dass die Regelungen der EMRK und die Rechtsprechung des EGMR möglichst schonend in das vorhandene dogmatisch ausdifferenzierte nationale Rechtssystem anzupassen sind, wobei sich die Grenzen der völkerrechtsfreundlichen Auslegung aus dem Grundgesetz selbst ergeben. Das Völkerrecht vermag die Rechtswirksamkeit der im Grundgesetz verankerten und geschützten Kernstrukturprinzipien nicht auszuhebeln.
- 69 -
Vgl. BVerfG, Urteil vom 4. Mai 2011 - 2 BvR 2333/08 -, a. a. O; Beschluss vom 19. September 2007 - 2 BvF 3/02 -, a. a. O.
Das Streikverbot für Beamte, und zwar unabhängig davon, welche Funktion sie ausüben, ist - wie oben dargestellt - ein hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums und gehört zu dem Kerngehalt des Grundgesetzes, der zugleich die Grenze - auch die Auslegungsgrenze - für völkerrechtliche Regelungen darstellt. Vor diesem Hintergrund sind auch die Gründe der angefochtenen Entscheidung widersprüchlich und in der Sache inkonsequent, weil das Verwaltungsgericht einerseits selbst davon ausgeht, dass ein Streikrecht der Klägerin als Beamtin verfassungsrechtlich ausgeschlossen ist, sich daran auch mit Blick „auf das europäische Recht“ nichts ändere und die Klägerin mit ihrer Streikteilnahme schuldhaft ein Dienstvergehen begangen habe, aber dass dieses Dienstvergehen - angesichts eines Verstoßes gegen die EMRK - nicht geahndet werden dürfe und deshalb nach § 33 Abs. 1 Nr. 4 LDG NRW einzustellen gewesen sei. Dieses Argumentation beinhaltet einen Zirkelschluss und würde das Disziplinarrecht - das ebenfalls als hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums verfassungsrechtlich verankert ist -,
vgl. BVerfG, Beschlüsse vom 22. November 2001 - 2 BvR 2138/00 -, NVwZ 2002, 467, und vom 22. Mai 1975 - 2 BvL 13/73 -, BVerfGE 39, 334; BVerwG, Urteil vom 23. Februar 1994 - 1 D 65.91 -, a. a. O.,
sinnlos machen, denn es hätte letztlich zur Konsequenz, dass sich ein Beamter bewusst und schuldhaft dienstpflichtwidrig verhält, sein Verhalten jedoch dienstrechtlich folgenlos bliebe. Dies ist mit dem Sinn und Zweck des Disziplinarrechts nicht zu vereinbaren. Das Disziplinarrecht erfüllt als Mittel der Personalführung des Dienstherrn in erster Linie eine Ordnungsfunktion. Mit ihm reagiert der Dienstvorgesetzte auf die durch eine Dienstpflichtverletzung verursachte Störung des beamtenrechtlichen Dienst- und Treueverhältnisses, die geeignet ist, die Funktions- und Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung und das Ansehen der Beamtenschaft zu beeinträchtigen. Das Disziplinarrecht dient damit der Wahrung des Vertrauens des Dienstherrn und der Allgemeinheit in die pflichtgemäße Aufgabenerfüllung durch die Beamten und damit letztlich dem allgemeinen Inte-
- 70 -
resse an der Sicherung der Integrität des Berufsbeamtentums. Die Geldbuße (§ 7 Abs. 1 LDG NRW) - die hier als Disziplinarmaßnahme von dem beklagten Land gegenüber der Klägerin verhängt wurde - dient der Pflichtenmahnung, indem sie die Beamtin selbst (spezialpräventiv), aber auch die übrige Beamtenschaft (generalpräventiv) zu dienstpflichtgemäßem, achtungs- und vertrauensgerechtem Verhalten auffordert.
Vgl. zum Zweck des Disziplinarverfahrens auch: BVerwG, Urteile vom 13. Januar 2011 - 2 WD 20.09 -, juris, vom 14. Oktober 2009 - 2 WD 16.08 -, Buchholz 449 § 17 SG Nr. 43, und vom 23. Januar 1973 - 1 D 25.72 -, BVerwGE 46, 64; Müller, Grundzüge des Beamtendisziplinarrechts, 2010, Rdnr. 13 ff.
Diese Funktion des Disziplinarrechts wäre nicht mehr mit Sinn erfüllt, wenn die durch die Streikteilnahme erfolgte Pflichtverletzung des Beamten - hier der Klägerin - disziplinarrechtlich folgenlos bliebe. Entgegen der Ansicht des Verwaltungsgerichts ändert daran auch die Regelung des § 9 Satz 1 BBesG nichts, wonach ein Beamter, der ohne Genehmigung schuldhaft dem Dienst fernbleibt, für die Zeit des Fernbleibens seine Bezüge verliert. Zum einen wäre der Anwendungsbereich des § 9 Satz 1 BBesG nicht eröffnet, wenn dem Beamten ein Streikrecht zustünde und ihm damit für die Streikteilnahme eine Genehmigung zum Fernbleiben vom Dienst seitens des Dienstherrn zu erteilen wäre. Zum anderen verkennt das Verwaltungsgericht, dass die Regelung des § 9 BBesG keine disziplinarische Maßnahme darstellt und insbesondere nicht bezweckt, den geordneten äußeren Dienstablauf zu sichern.
Vgl. Schinkel/Seifert, in: Fürst, GKÖD, Besoldungsrecht des Bundes und der Länder, Bd. III, § 9 BBesG Rdnr. 2.
Die mit dem Disziplinarrecht verfolgte spezial- und generalpräventive Zielsetzung zur Sicherstellung und Funktionserhaltung des öffentlichen Dienstbetriebs beinhaltet § 9 BBesG nicht. Es handelt sich hierbei ausschließlich um eine besoldungsrechtliche Rechtsfolge. Es geht um eine Leistungsstörung. Der Beamte, der unberechtigt und schuldhaft seine Arbeitszeit verkürzt, soll nicht besser gestellt werden als der Beamte, der entsprechend festgesetzte Teilzeitarbeit leistet.
- 71 -
Vgl. BVerwG, Urteil vom 25. September 2003 - 2 C 49.02 -, NVwZ-RR 2004. 273; Schwegmann/ Summer, Bundesbesoldungsgesetz, Teil II/1, § 9 BBesG Rdnr. 3c.
Auch die Behauptung des Verwaltungsgerichts, es sei davon auszugehen, dass die Beamten „das verfassungsrechtliche Streikverbot auch dann beachten, wenn ein Verstoß keine Disziplinarmaßnahme nach sich zieht“, weil die Beamten in besonderer Weise verpflichtet seien, Verfassung und Gesetze zu befolgen“, ist durch Beispiele nicht belegt und durch zahlreiche Disziplinarverfahren widerlegt. Wenn dies so wäre, dürfte es überhaupt keine Dienstvergehen geben und das Disziplinarrecht wäre überflüssig, da sich nach Auffassung des Verwaltungsgerichts alle Beamten an die Gesetze halten würden. Bei lebensnaher Betrachtung hätte die Nichtsanktionierung eines Dienstvergehens - wie hier die ungenehmigte Streikteilnahme durch Beamte - zur Folge, dass der Dienstherr die loyale Pflichtenerfüllung durch seine Beamten nicht mehr sicherstellen könnte. Es liegt auf der Hand, dass eine Vielzahl von Beamten - wie hier die Lehrerschaft - künftig an zahlreichen Streikaufrufen der Berufsverbände teilnehmen würden, wenn sie in dem Wissen handeln, dass sie zwar ein Dienstvergehen begehen, aber keine Disziplinarmaßnahmen zu befürchten haben. Die ungenehmigte Teilnahme von über 1800 beamteten Lehrern an Warnstreiks in Schleswig-Holstein im Jahr 2010,
vgl. „Mehr als 1800 Lehrer wegen Streik abgestraft“, in: Spiegel Online v. 6. November 2011, im Internet allgemein zugänglich unter: http://www.spiegel.de/schulspiegel/0,1518,79619 0,00.html; „Wegen Streik: Disziplinarverweise für mehr als 1800 Lehrer, in Stuttgarter Nachrichten v. 6. November 2011, im Internet allgemein zugänglich unter: http://www.stuttgarter-nachrich-ten.de/inhalt.schleswig-holstein-wegen-streik:-disziplinarverweise-fuer-mehr-als-1800-leh-rer.387e1b22-7a64-43a5-a847-69662a30c1a1.html,
zeigt, dass in diesem Sektor eine gewisse Streikbereitschaft vorhanden ist und dass dem Dienstherrn disziplinarrechtliche Maßnahmen zur Verfügung stehen müssen, um auf seine Beamten einwirken zu können und um somit einen ord-
- 72 -
nungsgemäßen Schulbetrieb und die Funktionsfähigkeit des öffentlichen Dienstes sicherzustellen. Sofern man derartige Dienstvergehen - wie vom Verwaltungsgericht angenommen - nicht ahnden könnte, würde hierdurch die verfassungsrechtlich verankerte Treuepflicht des Beamten ausgehebelt und die Funktionsfähigkeit des öffentlichen Dienstes in besonderer Weise gefährdet. Insbesondere auch mit Blick auf die Lehrer wäre zu befürchten, dass durch eine Streikteilnahme auch der beamteten Lehrer der Schulbetrieb sowie der staatliche Erziehungs- und Bildungsauftrag massiv beeinträchtigt würde. Der Staat wäre nicht mehr in der Lage das Recht der Schülerinnen und Schüler auf Bildung sowie auch deren Betreuung uneingeschränkt zu gewährleisten.
Vgl. in der Sache zutreffend: VG Osnabrück, Ur-teil vom 19. August 2011 - 9 A 1/11 -, a. a. O.
II. Das Disziplinarverfahren hätte auch nicht nach § 33 Abs. 1 Nr. 2 LDG NRW eingestellt werden müssen. Danach wird das Disziplinarverfahren eingestellt, wenn ein Dienstvergehen zwar erwiesen ist, eine Disziplinarmaßnahme jedoch nicht angezeigt erscheint. Dieser Regelung trägt dem im Disziplinarrecht neben anderen Grundsätzen auch anwendbaren Opportunitätsprinzip Rechnung und ermöglicht eine Abwägung zwischen einer geringfügigen Verfehlung und einem sonst einwandfreien Verhalten des Beamten. Die Regelung basiert unmittelbar auf § 13 Abs. 1 LDG NRW, wonach die Entscheidung über eine Disziplinarmaßnahme unter Beachtung der dort genannten Kriterien nach pflichtgemäßem Ermessen ergeht, und ist mit ihr insoweit tatbestandlich identisch. Ob eine Disziplinarmaßnahme „angezeigt erscheint“ ist deshalb ausschließlich nach den Kriterien des § 13 Abs. 1 LDG NRW zu bewerten.
Vgl. zum wortgleichen § 32 Abs. 1 Nr. 2 BDG: Wittkowski, in: Urban/Wittkowski, a. a. O, BDG § 32 Rdnr. 5; Hummerl/Köhler/Mayer, a. a. O., BDG, § 32 Rdnr. 6; Gansen, a. a. O., BDG, § 32 Rdnr. 8.
Im vorliegenden Fall hat die Klägerin - wie oben dargestellt - durch die Teilnahme an Warnstreiks an drei Tagen, obwohl sie zuvor durch die Konrektorin und die Schulleiterin zur Wahrnehmung ihrer Dienstpflichten angehalten worden ist, ein schwerwiegendes als Einheit zu wertendes innerdienstliches Dienstvergehen be-
- 73 -
gangen, das die Verhängung einer Disziplinarmaßnahme aus spezial- und generalpräventiven Zwecken erfordert. Mit Blick auf die Schwere des Dienstvergehens kommt eine Einstellung nach § 33 Abs. 1 Nr. 2 LDG NRW von vornherein nicht in Betracht.
D. Die Nebenentscheidungen beruhen auf den §§ 74 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 LDG NRW, §§ 154 Abs. 1, 167 Abs. 1 VwGO, §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.
Ein Grund, die Revision zuzulassen, besteht nicht, §§ 67, 3 Abs. 1 LDG NRW, § 132 Abs. 2 VwGO. Insbesondere ist die Revision nicht wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache (§ 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO) zuzulassen. Es entspricht ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung,
vgl. BVerfG, Beschlüsse vom 19. September 2007 - 2 BvF 3/02 -, a. a. O., vom 30. März 1977 - 2 BvR 1039/75 u.a. -, a. a. O., und vom 11. Juni 1958 - 1 BvR 1/52 u.a. -,a. a. O.; BVerwG, Urteile vom 23. Februar 1994 - 1 D 65.91 -, a. a. O., - 1 D 48.92 -, a. a. O., vom 10. Mai 1984 - 2 C 18.82 -, a. a. O., vom 3. Dezember 1980 - 1 D 86.79 -, a. a. O., vom 22. November 1979 - 1 D 84.78 -, a. a. O., und vom 16. November 1978 - 1 D 82.77 -,a. a. O.; Beschluss vom 19. September 1977 - 1 DB 12.77 -, a. a. O.,
dass in der Bundesrepublik Deutschland vor dem Hintergrund des Art. 33 Abs. 5 GG Beamten ein Streikrecht nicht zusteht. Ein neuerlicher Klärungsbedarf ergibt sich auch nicht mit Blick auf die EMRK und die Rechtsprechung des EGMR, da die EMRK - selbst wenn man aus deren Art. 11 entgegen der oben dargestellten Auffassung des Senats ein Streikrecht ableiten wollte - in der Bundesrepublik Deutschland nach höchstrichterlicher Rechtsprechung,
Vgl. BVerfG, Urteil vom 4. Mai 2011 - 2 BvR 2333/08 u.a. -, a. a. O.; Beschlüsse vom 14. Oktober 2004 - 2 BvR 1481/04 -, a. a. O., und vom 29. Mai 1990 - 2 BvR 254/88 u.a. -, a. a. O.,
- 74 -
nur den Rang eines einfachen Bundesgesetzes hat und damit an den Vorgaben des Grundgesetzes - hier Art. 33 Abs. 5 GG - zu messen ist.
Rechtsmittelbelehrung
Die Nichtzulassung der Revision kann durch Beschwerde angefochten werden.
Die Beschwerde ist bei Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster, innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Urteils schriftlich einzulegen. Die Beschwerde muss das angefochtene Urteil bezeichnen.
Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils zu begründen. Die Begründung ist bei dem oben genannten Gericht schriftlich einzureichen.
Statt in Schriftform können die Einlegung und die Begründung der Beschwerde auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen - ERVVO VG/FG – vom 1. Dezember 2010 (GV. NRW. S. 648) erfolgen.
Im Beschwerdeverfahren müssen sich die Beteiligten durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen; dies gilt auch für die Einlegung der Beschwerde und für die Begründung. Die Beteiligten können sich durch einen Rechtsanwalt oder einen Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, der die Befähigung zum Richteramt besitzt, als Bevollmächtigten vertreten lassen. Auf die zusätzlichen Vertretungsmöglichkeiten für Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse wird hingewiesen (vgl. § 67 Abs. 4 Satz 4 der Verwaltungsgerichtsordnung - VwGO - und § 5 Nr. 6 des Einführungsgesetzes zum Rechtsdienstleistungsgesetz - RDGEG -).
Vor dem Bundesverwaltungsgericht sind auch die in § 67 Absatz 2 Nr. 5 VwGO bezeichneten Organisationen einschließlich der von ihnen gebildeten juristischen Personen gemäß § 67 Absatz 2 Satz 2 Nr. 7 VwGO als Bevollmächtigte zugelassen, jedoch nur in Angelegenheiten, die Rechtsverhältnisse im Sinne des § 52
- 75 -
Nr. 4 VwGO betreffen; die hier genannten Bevollmächtigten müssen durch Personen mit der Befähigung zum Richteramt handeln.
Richterin am OVG Flocken-haus ist dienstunfähig krank und kann daher ihre Unterschrift nicht beifügen.
Dr. Schachel
Hoffmann
Dr. Schachel
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gern:
 |
Dr. Martin Hensche Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hensche@hensche.de |
 |
Christoph Hildebrandt Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hildebrandt@hensche.de |
 |
Nina Wesemann Rechtsanwältin Fachanwältin für Arbeitsrecht Kontakt: 040 / 69 20 68 04 wesemann@hensche.de |