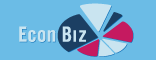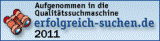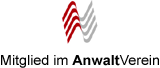- -> zur Mobil-Ansicht
- Arbeitsrecht aktuell
- Tipps und Tricks
- Handbuch Arbeitsrecht
- Gesetze zum Arbeitsrecht
- Urteile zum Arbeitsrecht
- Urteile 2023
- Urteile 2021
- Urteile 2020
- Urteile 2019
- Urteile 2018
- Urteile 2017
- Urteile 2016
- Urteile 2015
- Urteile 2014
- Urteile 2013
- Urteile 2012
- Urteile 2011
- Urteile 2010
- Urteile 2009
- Urteile 2008
- Urteile 2007
- Urteile 2006
- Urteile 2005
- Urteile 2004
- Urteile 2003
- Urteile 2002
- Urteile 2001
- Urteile 2000
- Urteile 1999
- Urteile 1998
- Urteile 1997
- Urteile 1996
- Urteile 1995
- Urteile 1994
- Urteile 1993
- Urteile 1992
- Urteile 1991
- Urteile bis 1990
- Arbeitsrecht Muster
- Videos
- Impressum-Generator
- Webinare zum Arbeitsrecht
-
Kanzlei Berlin
 030 - 26 39 62 0
030 - 26 39 62 0
 berlin@hensche.de
berlin@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Frankfurt
 069 - 71 03 30 04
069 - 71 03 30 04
 frankfurt@hensche.de
frankfurt@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hamburg
 040 - 69 20 68 04
040 - 69 20 68 04
 hamburg@hensche.de
hamburg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hannover
 0511 - 89 97 701
0511 - 89 97 701
 hannover@hensche.de
hannover@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Köln
 0221 - 70 90 718
0221 - 70 90 718
 koeln@hensche.de
koeln@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei München
 089 - 21 56 88 63
089 - 21 56 88 63
 muenchen@hensche.de
muenchen@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Nürnberg
 0911 - 95 33 207
0911 - 95 33 207
 nuernberg@hensche.de
nuernberg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Stuttgart
 0711 - 47 09 710
0711 - 47 09 710
 stuttgart@hensche.de
stuttgart@hensche.de
AnfahrtDetails
BAG, Urteil vom 29.06.2017, 2 AZR 597/16
| Schlagworte: | Datenschutz, Überwachung, Persönlichkeitsrecht, Arbeitnehmerdatenschutz | |
| Gericht: | Bundesarbeitsgericht | |
| Aktenzeichen: | 2 AZR 597/16 | |
| Typ: | Urteil | |
| Entscheidungsdatum: | 29.06.2017 | |
| Leitsätze: | Eine vom Arbeitgeber veranlasste verdeckte Überwachungsmaßnahme zur Aufdeckung eines auf Tatsachen gegründeten konkreten Verdachts einer schwerwiegenden Pflichtverletzung des Arbeitnehmers kann nach § 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG zulässig sein. |
|
| Vorinstanzen: | Arbeitsgericht Heilbronn, Urteil vom 22.10.2015, 8 Ca 28/15 Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 20.07.2016, 4 Sa 61/15 |
|
BUNDESARBEITSGERICHT
2 AZR 597/16
4 Sa 61/15
Landesarbeitsgericht
Baden-Württemberg
Im Namen des Volkes!
Verkündet am
29. Juni 2017
URTEIL
Metze, Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
In Sachen
Beklagte, Widerklägerin, Berufungsbeklagte und Revisionsklägerin,
pp.
Kläger, Widerbeklagter, Berufungskläger und Revisionsbeklagter,
hat der Zweite Senat des Bundesarbeitsgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 29. Juni 2017 durch den Vorsitzenden Richter am Bundesarbeitsgericht Prof. Dr. Koch, die Richterinnen am Bundesarbeitsgericht Berger
- 2 -
und Rachor sowie die ehrenamtlichen Richter Dr. Gerschermann und Koltze für Recht erkannt:
1. Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des Landesarbeitsgerichts Baden-Württemberg vom 20. Juli 2016 - 4 Sa 61/15 - im Kostenausspruch und insoweit aufgehoben, wie es auf die Berufung des Klägers das Teilurteil des Arbeitsgerichts Heilbronn vom 22. Oktober 2015 - 8 Ca 28/15 - abgeändert und festgestellt hat, dass das Arbeitsverhältnis zwischen den Parteien weder durch die außerordentliche noch durch die ordentliche Kündigung der Beklagten vom 11. Juni 2015 aufgelöst worden ist, und wie es die Widerklage auf Ersatz von Detektivkosten in Höhe von 746,55 Euro und auf Auskunft abgewiesen hat.
2. Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten des Revisionsverfahrens - an das Landesarbeitsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen!
Tatbestand
Die Parteien streiten über die Wirksamkeit einer außerordentlichen, hilfsweise ordentlichen Kündigung sowie den Ersatz von Detektivkosten und einen Auskunftsanspruch.
Die Beklagte stellt Stanzwerkzeuge und -formen her. Der Kläger war bei ihr seit Dezember 1978 als Mitarbeiter im Stanzformenbau beschäftigt. Er war im Jahre 2014 mehrfach arbeitsunfähig krankgeschrieben. Seit dem 20. Januar 2015 war ihm durchgehend Arbeitsunfähigkeit attestiert. Die Beklagte leistete an ihn Entgeltfortzahlung bis zum 2. März 2015.
Ein Geschäftsführer der Beklagten erhielt am 29. Mai 2015 Kenntnis von einer E-Mail der M GmbH, einer im Jahre 2013 gegründeten Firma der Söhne des Klägers. Die E-Mail war an eine Kundin der Beklagten gerichtet. Da-
- 3 -
rin hieß es ua., man verkaufe als Familienunternehmen günstig Stanzformen, der Kläger montiere seit 38 Jahren, es sei unglaublich, was er alles so hinbekomme.
Die Beklagte gab dem Kläger Gelegenheit zur Stellungnahme wegen des Verdachts wettbewerbswidriger Konkurrenztätigkeit und des Vortäuschens einer Erkrankung. Dieser äußerte sich nicht.
Die Beklagte kündigte das Arbeitsverhältnis der Parteien mit Schreiben vom 11. Juni 2015 außerordentlich fristlos, hilfsweise ordentlich zum 31. Januar 2016.
Dagegen hat sich der Kläger mit der vorliegenden Klage gewandt. Er hat beide Kündigungen für unwirksam gehalten, da es an einem sie rechtfertigenden Grund fehle. Er habe nicht in der Firma seiner Söhne gearbeitet, sondern sei tatsächlich arbeitsunfähig krank gewesen.
Der Kläger hat - soweit für die Revision von Bedeutung - beantragt festzustellen, dass das Arbeitsverhältnis der Parteien durch die Kündigungen vom 11. Juni 2015 nicht geendet hat.
Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen. Im Wege der Widerklage hat sie - soweit im Revisionsverfahren noch von Interesse - beantragt,
1. den Kläger zu verurteilen, an sie 746,55 Euro nebst Zinsen zu zahlen;
2. den Kläger zur Auskunftserteilung zu verurteilen, welche Aufträge er für die Firma M GmbH bearbeitet hat.
Die Beklagte hat die Kündigungen für gerechtfertigt gehalten. Sie habe Anfang November 2013 - unmittelbar, nachdem sie von der Gründung der Firma M Kenntnis erlangt habe - mit dem Kläger ein Personalgespräch geführt, bei welchem er darauf hingewiesen worden sei, dass er in dem Betrieb nicht konkurrierend tätig werden dürfe. Dies sei dem Kläger - unstreitig - außerdem schriftlich mitgeteilt worden. Das Privatfahrzeug des Klägers habe während sei-
- 4 -
ner Arbeitsunfähigkeit im Februar 2014 auf dem Gelände der Firma M gestanden. Daraufhin habe sie ein Detektivbüro eingeschaltet, welches Anhaltspunkte für eine Konkurrenztätigkeit des Klägers nicht nur im Februar 2014, sondern auch im März und im Juni 2014 ermittelt habe. Weitere Erkenntnisse hätten die Überwachungen, bedingt durch die Lage des Firmengeländes, nicht erbracht. Nachdem sie Kenntnis von der E-Mail der Firma M vom 29. Mai 2015 erlangt habe, habe sie im Juni 2015 erneut ein Detektivbüro beauftragt. Ein Detektiv, der sich als Fahrer einer Kundenfirma ausgegeben habe, habe den Kläger am 3. Juni 2015 bei der Firma M Tätigkeiten erbringen sehen, wie er sie ebenso bei der Beklagten zu verrichten gehabt hätte. Der Kläger schulde ihr daher Schadensersatz jedenfalls für die Detektivkosten iHv. 746,55 Euro wegen des Einsatzes im Juni 2015 sowie Auskunft über die von ihm bei der Firma M bearbeiteten Aufträge.
Das Arbeitsgericht hat die Kündigungsschutzklage abgewiesen und den Kläger zum Ersatz der Detektivkosten für den Einsatz im Juni 2015 sowie zur Auskunft verurteilt. Das Landesarbeitsgericht hat der Klage stattgegeben und die Widerklage abgewiesen. Mit ihrer Revision begehrt die Beklagte die Wiederherstellung der erstinstanzlichen Entscheidung.
Entscheidungsgründe
Die Revision ist begründet. Das führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Landesarbeitsgericht (§ 562 Abs. 1, § 563 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Dieses hat - im Umfang des Revisionsangriffs - das arbeitsgerichtliche Urteil zu Unrecht abgeändert. Die angefochtene Entscheidung beruht insoweit auf einer rechtsfehlerhaften Anwendung von § 286 ZPO iVm. Art. 2 Abs. 1, Art. 1 Abs. 1 GG und § 32 Abs. 1 BDSG. Ob eine der Kündigungen vom 11. Juni 2015 wirksam ist und ob die Ansprüche der Beklagten auf Ersatz von Detektivkosten in Höhe von 746,55 Euro sowie auf Auskunft bestehen, steht noch nicht fest.
- 5 -
I. Mit der bisherigen Begründung durfte das Landesarbeitsgericht nicht annehmen, es fehle für die fristlose Kündigung an einem wichtigen Grund iSd. § 626 Abs. 1 BGB.
1. Nach dieser Bestimmung kann das Arbeitsverhältnis aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden, wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund derer dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses selbst bis zum Ablauf der Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. Dabei ist zunächst zu prüfen, ob der Sachverhalt ohne seine besonderen Umstände „an sich“ und damit typischerweise als wichtiger Grund geeignet ist. Alsdann bedarf es der weiteren Prüfung, ob dem Kündigenden die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des Falls und unter Abwägung der Interessen beider Vertragsteile - jedenfalls bis zum Ablauf der Kündigungsfrist - zumutbar ist oder nicht (BAG 17. März 2016 - 2 AZR 110/15 - Rn. 17; 16. Juli 2015 - 2 AZR 85/15 - Rn. 21).
2. Das Landesarbeitsgericht ist zu Recht davon ausgegangen, das dem Kläger vorgeworfene Verhalten sei „an sich“ geeignet, einen wichtigen Grund iSd. § 626 Abs. 1 BGB darzustellen.
a) Ein Arbeitnehmer, der während des bestehenden Arbeitsverhältnisses Konkurrenztätigkeiten entfaltet, verstößt gegen seine Pflicht zur Rücksichtnahme auf die Interessen des Arbeitgebers aus § 241 Abs. 2 BGB. Es handelt sich in der Regel um eine erhebliche Pflichtverletzung, die „an sich“ geeignet ist, eine außerordentliche Kündigung zu rechtfertigen (BAG 23. Oktober 2014 - 2 AZR 644/13 - Rn. 27, BAGE 149, 367; 28. Januar 2010 - 2 AZR 1008/08 - Rn. 20). Dabei ist dem Arbeitnehmer aufgrund des Wettbewerbsverbots nicht nur eine Konkurrenztätigkeit im eigenen Namen und Interesse untersagt. Es ist ihm ebenso wenig gestattet, einen Wettbewerber des Arbeitgebers zu unterstützen (BAG 23. Oktober 2014 - 2 AZR 644/13 - Rn. 28, aaO; 28. Januar 2010 - 2 AZR 1008/08 - aaO).
- 6 -
b) Das Erschleichen von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen kann eben falls einen wichtigen Grund iSd. § 626 Abs. 1 BGB zur außerordentlichen Kündigung bilden. Dies gilt nicht nur, wenn sich der Arbeitnehmer für die Zeit einer vorgetäuschten Arbeitsunfähigkeit Entgeltfortzahlung gewähren lässt und damit regelmäßig einen Betrug zulasten des Arbeitgebers begeht (dazu BAG 26. August 1993 - 2 AZR 154/93 - zu B I 1 a der Gründe, BAGE 74, 127). Täuscht er eine Arbeitsunfähigkeit erst nach Ablauf des Entgeltfortzahlungszeitraums vor, aber zu dem Zweck, während der attestierten Arbeitsunfähigkeit einer Konkurrenztätigkeit nachgehen zu können, verletzt er ebenfalls in erheblicher Weise seine Pflicht zur Rücksichtnahme auf die Interessen des Arbeitgebers gem. § 241 Abs. 2 BGB. Der Arbeitgeber wird durch die Täuschung daran gehindert, seine Rechte auf die vertragsgerechte Durchführung des Arbeitsverhältnisses geltend zu machen.
c) Als wichtiger Grund iSd. § 626 Abs. 1 BGB „an sich“ geeignet sind nicht nur erhebliche Pflichtverletzungen im Sinne von nachgewiesenen Taten. Auch der dringende, auf objektive Tatsachen gestützte Verdacht einer schwerwiegenden Pflichtverletzung kann einen wichtigen Grund bilden (st. Rspr., zu den Voraussetzungen im Einzelnen BAG 20. Juni 2013 - 2 AZR 546/12 - Rn. 14, BAGE 145, 278).
3. Die Würdigung des Landesarbeitsgerichts, ein in diesem Sinne dringender Verdacht einer unerlaubten Konkurrenztätigkeit des Klägers oder eines Erschleichens von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen könne nicht festgestellt werden, hält mit der gegebenen Begründung einer rechtlichen Überprüfung nicht stand.
a) Das Landesarbeitsgericht hat angenommen, den von der Beklagten behaupteten Erkenntnissen aus den Beobachtungen des Detektivs dürfe nicht über eine Beweiserhebung nachgegangen werden. Die Detektivermittlungen seien weder nach § 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG noch nach Satz 2 der Bestimmung zulässig gewesen. Unter § 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG fielen nur solche Maßnahmen, die nicht auf die Entdeckung konkret Verdächtiger gerichtet seien. Hier
- 7 -
seien die Beobachtungen jedoch zielgerichtet nur gegen den Kläger wegen eines bereits bestehenden konkreten Verdachts erfolgt. Die Maßnahme habe deshalb den Voraussetzungen gem. § 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG genügen müssen. Daran fehle es. Die Datenerhebung sei nicht aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte erfolgt, die den Verdacht einer im Beschäftigungsverhältnis begangenen Straftat begründeten. Ein Betrug zulasten der Beklagten scheide aus, da der Kläger im Juni 2015 schon keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung mehr gehabt habe. Eine unerlaubte Konkurrenztätigkeit erfülle für sich genommen keinen Straftatbestand.
b) Dies beruht auf einer rechtsfehlerhaften Anwendung von § 286 ZPO iVm. Art. 2 Abs. 1, Art. 1 Abs. 1 GG und § 32 Abs. 1 BDSG.
aa) Ein Sachvortrags- oder Beweisverwertungsverbot wegen einer Verletzung des gem. Art. 2 Abs. 1 iVm. Art. 1 Abs. 1 GG geschützten allgemeinen Persönlichkeitsrechts einer Partei (vgl. auch Art. 8 Abs. 1 EMRK) kann sich im arbeitsgerichtlichen Verfahren aus der Notwendigkeit einer verfassungskonformen Auslegung des Prozessrechts - etwa der § 138 Abs. 3, § 286, § 331 Abs. 1 Satz 1 ZPO - ergeben. Wegen der nach Art. 1 Abs. 3 GG gegebenen Bindung an die insoweit maßgeblichen Grundrechte und der Verpflichtung zu einer rechtsstaatlichen Verfahrensgestaltung (BVerfG 13. Februar 2007 - 1 BvR 421/05 - Rn. 93, BVerfGE 117, 202) hat das Gericht zu prüfen, ob die Verwertung von heimlich beschafften persönlichen Daten und Erkenntnissen, die sich aus diesen Daten ergeben, mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Betroffenen vereinbar ist (BAG 20. Oktober 2016 - 2 AZR 395/15 - Rn. 18; 22. September 2016 - 2 AZR 848/15 - Rn. 23, BAGE 156, 370; BGH 15. Mai 2013 - XII ZB 107/08 - Rn. 21). Das Grundrecht schützt neben der Privat- und Intimsphäre und seiner speziellen Ausprägung als Recht am eigenen Bild auch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, das die Befugnis garantiert, selbst über die Preisgabe und Verwendung persönlicher Daten zu befinden (BVerfG 11. März 2008 - 1 BvR 2074/05 ua. - Rn. 67, BVerfGE 120, 378;
- 8 -
15. Dezember 1983 - 1 BvR 209/83 ua. - zu C II 1 a der Gründe, BVerfGE 65, 1).
bb) Die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) über die Anforderungen an eine zulässige Datenverarbeitung konkretisieren und aktualisieren den Schutz des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und am eigenen Bild (§ 1 Abs. 1 BDSG). Sie regeln, in welchem Umfang im Anwendungsbereich des Gesetzes Eingriffe durch öffentliche oder nichtöffentliche Stellen iSd. § 1 Abs. 2 BDSG in diese Rechtspositionen zulässig sind. Sie ordnen für sich genommen jedoch nicht an, dass unter ihrer Missachtung gewonnene Erkenntnisse oder Beweismittel bei der Feststellung des Tatbestands im arbeitsgerichtlichen Verfahren vom Gericht nicht berücksichtigt werden dürften (BAG 20. Oktober 2016 - 2 AZR 395/15 - Rn. 17; 22. September 2016 - 2 AZR 848/15 - Rn. 22, BAGE 156, 370). Ist allerdings die Datenverarbeitung gegenüber dem betroffenen Arbeitnehmer nach den Vorschriften des BDSG zulässig, liegt insoweit keine Verletzung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und am eigenen Bild vor.
cc) Zutreffend ist das Landesarbeitsgericht davon ausgegangen, bei der Observation des Klägers durch einen Detektiv im Juni 2015 im Auftrag der Beklagten habe es sich um Datenerhebung iSv. § 3 Abs. 1, Abs. 3 und Abs. 7, § 32 Abs. 2 BDSG gehandelt (vgl. BAG 19. Februar 2015 - 8 AZR 1007/13 - Rn. 23). Durch die Überwachung wurden in für die Beklagte bestimmten Observationsberichten Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse des Klägers iSd. § 3 Abs. 1 BDSG beschafft (§ 3 Abs. 3 BDSG). Auf eine automatisierte Verarbeitung der Angaben oder einen Dateibezug iSd. § 1 Abs. 2 Nr. 3 bzw. § 27 Abs. 1 BDSG kommt es nach § 32 Abs. 2 BDSG bei der Datenerhebung für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses nicht an.
dd) In der Datenerhebung durch die Observation lag zugleich ein Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Klägers. Betroffen ist sein von Art. 2 Abs. 1 iVm. Art. 1 Abs. 1 GG geschütztes informationelles Selbstbestimmungsrecht. Ein von einer verdeckten Überwachung Betroffener wird in der Befugnis,
- 9 -
selbst über die Preisgabe und Verwendung persönlicher Daten zu befinden, beschränkt, indem er zum Ziel einer nicht erkennbaren systematischen Beobachtung durch einen Dritten gemacht wird und dadurch auf sich beziehbare Daten über sein Verhalten preisgibt, ohne den mit der Beobachtung verfolgten Verwendungszweck zu kennen. Dies gilt unabhängig davon, ob Fotos, Videoaufzeichnungen oder Tonmitschnitte angefertigt werden und damit zugleich ein Eingriff in das Recht am eigenen Bild bzw. Wort vorliegt. Ein Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung setzt auch nicht notwendig voraus, dass die Privatsphäre des Betroffenen ausgespäht wird (unklar BVerwG 21. März 1986 - 7 C 71/83 - zu 1 a der Gründe, BVerwGE 74, 115). Zwar muss der Einzelne außerhalb des thematisch und räumlich besonders geschützten Bereichs der Privatsphäre damit rechnen, Gegenstand von Wahrnehmungen beliebiger Dritter zu werden, grundsätzlich aber nicht, Ziel einer verdeckten und systematischen Beobachtung zur Beschaffung konkreter, auf die eigene Person bezogener Daten zu sein (für die automatisierte Erhebung öffentlich zugänglicher Informationen vgl. BVerfG 11. März 2008 - 1 BvR 2074/05 ua. - Rn. 67, BVerfGE 120, 378). Im Streitfall erfolgte die Überwachung in diesem Sinne verdeckt, weil der Kläger infolge der Legendierung des Detektivs als Fahrer einer Kundenfirma nicht erkennen konnte, wem gegenüber und damit zu vermutlich welchem Verwendungszweck er sein Verhalten im Betrieb der Firma M offenbarte.
ee) Unzutreffend ist allerdings die Annahme des Landesarbeitsgerichts, eine anlassbezogene Datenerhebung durch den Arbeitgeber könne ausschließlich nach § 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG zulässig sein (ebenso Brink juris-PR-ArbR 36/2016 Anm. 2; unklar Gola/Schomerus BDSG 12. Aufl. § 32 Rn. 40 f.). Es kann daher dahinstehen, ob das Erschleichen von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen auch nach Ablauf des Entgeltfortzahlungszeitraums eine im Beschäftigungsverhältnis begangene Straftat im Sinne des § 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG darstellen kann. Selbst wenn das Landesarbeitsgericht dies zu Recht verneint hätte, durfte es mit der von ihm gegebenen Begründung die von der Beklagten angebotenen Beweismittel in Bezug auf ihren Sachvortrag zur Tätigkeit des
- 10 -
Klägers für die Firma M am 3. Juni 2015 nicht für unverwertbar halten. Erfolgt die Datenerhebung nicht zur Aufdeckung einer im Beschäftigungsverhältnis begangenen Straftat iSd. § 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG, kommt vielmehr eine Zulässigkeit der Maßnahme nach § 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG in Betracht. Dient die Datenerhebung weder der Aufdeckung von Straftaten iSd. § 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG noch sonstigen Zwecken des Beschäftigungsverhältnisses iSd. § 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG, kann sie überdies „zur Wahrung berechtigter Interessen“ iSd. § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BDSG zulässig sein. Insoweit wird § 28 BDSG von § 32 BDSG nicht verdrängt (BT-Drs. 16/13657 S. 20 f.; Gola/Schomerus BDSG 12. Aufl. § 32 Rn. 2, 45 f.).
(1) Nach § 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG dürfen personenbezogene Daten eines Beschäftigten für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses ua. dann erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn dies für dessen Durchführung oder Beendigung erforderlich ist. Zur Durchführung gehört die Kontrolle, ob der Arbeitnehmer seinen Pflichten nachkommt (Gola/Schomerus BDSG 12. Aufl. § 32 Rn. 16; Grimm JM 2016, 17, 19), zur Beendigung im Sinne der Kündigungsvorbereitung (dazu Grimm aaO) die Aufdeckung einer Pflichtverletzung, die die Kündigung des Arbeitsverhältnisses rechtfertigen kann. Der Wortlaut des § 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG enthält keine Einschränkung, es müsse der Verdacht einer im Beschäftigungsverhältnis verübten Straftat bestehen. Sofern nach § 32 Abs. 1 Satz 1 oder Satz 2 BDSG zulässig erhobene Daten den Verdacht einer Pflichtverletzung begründen, dürfen sie für die Zwecke und unter den Voraussetzungen des § 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG auch verarbeitet und genutzt werden (vgl. BAG 20. Oktober 2016 - 2 AZR 395/15 - Rn. 40; 22. September 2016 - 2 AZR 848/15 - Rn. 37 f.). Der Begriff der Beendigung umfasst dabei die Abwicklung eines Beschäftigungsverhältnisses (BT-Drs. 16/13657 S. 21). Der Arbeitgeber darf deshalb alle Daten speichern und verwenden, die er zur Erfüllung der ihm obliegenden Darlegungs- und Beweislast in einem potentiellen Kündigungsschutzprozess benötigt (Stamer/Kuhnke in Plath BDSG 2. Aufl. § 32 Rn. 149; HWK/Lembke 7. Aufl. § 32 BDSG Rn. 15).
- 11 -
(2) § 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG erlaubt die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung in den Fällen, in denen - unabhängig von den in § 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG näher bestimmten Zwecken - Anhaltspunkte für den Verdacht einer im Beschäftigungsverhältnis begangenen Straftat bestehen. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass Maßnahmen zur Aufdeckung einer Straftat in der Regel besonders intensiv in das allgemeine Persönlichkeitsrecht eingreifen (BT-Drs. 16/ 13657 S. 21). Dies ist insbesondere bei einer zu diesem Zweck erfolgenden (verdeckten) Überwachung von Beschäftigten der Fall, weshalb die - von der Gesetzesbegründung in Bezug genommenen - restriktiven Grundsätze der hierzu ergangenen Rechtsprechung in § 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG gesondert kodifiziert wurden. Die Vorschrift soll hinsichtlich der Eingriffsintensität damit vergleichbare Maßnahmen erfassen (BAG 12. Februar 2015 - 6 AZR 845/13 - Rn. 75, BAGE 151, 1).
(3) Eine „Sperrwirkung“ des § 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG gegenüber der Erlaubnisnorm in Satz 1 der Bestimmung in Fällen, in denen der Arbeitgeber „nur“ einen - auf Tatsachen gestützten und ausreichend konkreten - Verdacht einer schwerwiegenden Pflichtverletzung des Arbeitnehmers hat, nicht aber den einer im Beschäftigungsverhältnis begangenen Straftat, lässt sich weder aus dem Wortlaut von § 32 Abs. 1 BDSG, noch seiner Systematik oder seinem Sinn und Zweck bzw. der Gesetzeshistorie ableiten. Die Gesetzesbegründung macht vielmehr deutlich, dass eine solche Sperrwirkung weder gewollt war noch mit den kollidierenden Interessen des Arbeitgebers im Einklang stünde (ebenso ErfK/Franzen 17. Aufl. § 32 BDSG Rn. 31, der allerdings unmittelbar § 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG auch für den Fall vergleichbarer Verdachtsfälle für anwendbar hält; wohl auch Kempter/Steinat DB 2016, 2415, 2416 f.).
(a) § 32 BDSG sollte nach dem Willen des Gesetzgebers die von der Rechtsprechung erarbeiteten Grundsätze des Datenschutzes im Beschäftigungsverhältnis nicht ändern, sondern lediglich zusammenfassen (vgl. Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses BT-Drs. 16/13657 S. 20; BAG 20. Oktober 2016 - 2 AZR 395/15 - Rn. 22; 12. Februar 2015
- 12 -
- 6 AZR 845/13 - Rn. 75, BAGE 151, 1). Es handelt sich um kein „ausgereiftes“ Gesetz (ErfK/Franzen 17. Aufl. § 32 BDSG Rn. 31; HWK/Lembke 7. Aufl. § 32 BDSG Rn. 1 spricht von einem „Musterbeispiel symbolischer Gesetzgebung“). Ein umfassendes Arbeitnehmerdatenschutzgesetz sollte weder entbehrlich gemacht noch inhaltlich präjudiziert werden, so dass zunächst nur eine Kodifikation der Rechtsprechungsgrundsätze erfolgte (BT-Drs. 16/13657 S. 20; für eine Auslegung des Gesetzes im Zweifel entsprechend dem vorgefundenen Rechtszustand auch HK-ArbR/Hilbrans 3. Aufl. § 32 BDSG Rn. 1). Nach den demgemäß in § 32 BDSG zusammengefassten Rechtsprechungsgrundsätzen sind aber - sofern weniger einschneidende Mittel zur Aufklärung des Verdachts ergebnislos ausgeschöpft sind, die verdeckte Überwachung damit das praktisch einzig verbleibende Mittel darstellt und sie insgesamt nicht unverhältnismäßig ist - Eingriffe in das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Arbeitnehmer durch bspw. eine verdeckte (Video-)Überwachung nicht nur dann zulässig, wenn der konkrete Verdacht einer strafbaren Handlung besteht, sondern ebenso bei einem entsprechenden Verdacht einer anderen schweren Verfehlung zu Lasten des Arbeitgebers (grundlegend BAG 27. März 2003 - 2 AZR 51/02 - zu B I 3 b cc der Gründe, BAGE 105, 356). Dabei muss sich der Verdacht in Bezug auf die konkrete strafbare Handlung oder andere schwere Verfehlung zu Lasten des Arbeitgebers gegen einen zumindest räumlich und funktional abgrenzbaren Kreis von Arbeitnehmern richten. Diese Rechtsprechung steht mit Art. 8 Abs. 1 EMRK im Einklang (EGMR 5. Oktober 2010 - 420/07 - EuGRZ 2011, 471).
(b) Die verdeckte Überwachung eines einer schweren Pflichtverletzung verdächtigen Arbeitnehmers ist demnach nur unter den vergleichbaren Voraussetzungen zulässig wie zur Aufdeckung einer Straftat (aA wohl Grimm JM 2016, 17, 19). Soweit der Gesetzgeber in § 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG lediglich den Fall der Aufdeckung von Straftaten gesondert neben dem Grunderlaubnistatbestand des § 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG geregelt hat, sollte damit jedoch keine Änderung der Rechtsprechungsgrundsätze verbunden sein. Das verlangt und ermöglicht einen „Rückgriff“ auf die Grundnorm des § 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG, sofern es
- 13 -
nicht um die Aufdeckung einer im Beschäftigungsverhältnis begangenen Straftat iSd. § 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG geht. Da der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ebenso dort verankert ist, sind die Rechtsprechungsgrundsätze betreffend die Zulässigkeit einer verdeckten Überwachung zur Aufdeckung des konkreten Verdachts einer schwerwiegenden Pflichtverletzung auch im Rahmen dieser Erlaubnisnorm zur Anwendung zu bringen (für die Anwendbarkeit von § 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG bei der Aufdeckung sonstiger Pflichtverletzungen auch Thüsing NZA 2009, 865, 868; Grimm JM 2016, 17, 20; ebenso für die heimliche Überwachung durch Detektive Seifert in Simitis BDSG 8. Aufl. § 32 Rn. 100; aA Brink juris-PR-ArbR 36/2016 Anm. 2).
(aa) Eine Datenerhebung zur Aufklärung des (konkreten) Verdachts einer schweren Pflichtverletzung erfolgt „für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses“ iSd. § 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG. Die Bestimmung kodifiziert ebenso wie Satz 2 der Norm die von der Rechtsprechung aus dem verfassungsrechtlich geschützten allgemeinen Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 iVm. Art. 1 Abs. 1 GG) abgeleiteten allgemeinen Grundsätze zum Datenschutz im Beschäftigungsverhältnis (BAG 17. November 2016 - 2 AZR 730/15 - Rn. 29; BT-Drs. 16/ 13657 S. 21). Dabei nimmt die Gesetzesbegründung zur Konkretisierung des Maßstabs der Erforderlichkeit einer Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten zur Durchführung oder Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses auf die Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts vom 22. Oktober 1986 (- 5 AZR 660/85 - BAGE 53, 226) und 7. September 1995 (- 8 AZR 828/93 - BAGE 81, 15) Bezug. Diesen zufolge dürfe sich der Arbeitgeber bei seinen Beschäftigten nicht nur über Umstände informieren oder Daten verwenden, um seine vertraglichen Pflichten ihnen gegenüber erfüllen zu können, wie zB Pflichten im Zusammenhang mit der Personalverwaltung, Lohn-und Gehaltsabrechnung, sondern auch, um seine im Zusammenhang mit der Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses bestehenden Rechte wahrzunehmen, zB durch Ausübung des Weisungsrechts oder durch Kontrollen der Leistung oder des Verhaltens des Beschäftigten (BT-Drs. 16/13657 aaO). Voraussetzung ist ein berechtigtes Interesse des Arbeitgebers an der Datenerhe-
- 14 -
bung, -verarbeitung oder -nutzung, das aus dem bestehenden Arbeitsverhältnis herrühren muss. Es muss ein Zusammenhang mit der Erfüllung der vom Arbeitnehmer geschuldeten vertraglichen Leistung, seiner sonstigen Pflichtenbindung oder mit der Pflichtenbindung des Arbeitgebers bestehen (BAG 7. September 1995 - 8 AZR 828/93 - zu II 2 c aa der Gründe, aaO). Ein solcher Zusammenhang besteht auch dann, wenn der Arbeitgeber konkreten Verdachtsmomenten nachgeht, der Arbeitnehmer verletze in schwerwiegender Weise seine arbeitsvertraglichen Pflichten.
(bb) Der mit einer Datenerhebung verbundene Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers muss auch im Rahmen von § 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG einer Abwägung der beiderseitigen Interessen nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit standhalten (BAG 17. November 2016 - 2 AZR 730/15 - Rn. 30; 7. September 1995 - 8 AZR 828/93 - zu II 2 c bb der Gründe, BAGE 81, 15; 22. Oktober 1986 - 5 AZR 660/85 - zu B I 2 a der Gründe, BAGE 53, 226). Dieser verlangt, dass der Eingriff geeignet, erforderlich und unter Berücksichtigung der gewährleisteten Freiheitsrechte angemessen ist, um den erstrebten Zweck zu erreichen (BAG 17. November 2016 - 2 AZR 730/15 - aaO; 15. April 2014 - 1 ABR 2/13 (B) - Rn. 41, BAGE 148, 26; 29. Juni 2004 - 1 ABR 21/03 - zu B I 2 d der Gründe, BAGE 111, 173). Es dürfen keine anderen, zur Zielerreichung gleich wirksamen und das Persönlichkeitsrecht der Arbeitnehmer weniger einschränkenden Mittel zur Verfügung stehen. Die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne ist gewahrt, wenn die Schwere des Eingriffs bei einer Gesamtabwägung nicht außer Verhältnis zu dem Gewicht der ihn rechtfertigenden Gründe steht (BVerfG 4. April 2006 - 1 BvR 518/02 - zu B I 2 b dd der Gründe, BVerfGE 115, 320; BAG 15. April 2014 - 1 ABR 2/13 (B) - aaO). Die Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung darf keine übermäßige Belastung für den Arbeitnehmer darstellen und muss der Bedeutung des Informationsinteresses des Arbeitgebers entsprechen. Danach muss im Falle einer der (verdeckten) Videoüberwachung vergleichbar eingriffsintensiven Maßnahme zur Aufklärung einer schwerwiegenden, jedoch nicht strafbaren Pflichtverletzung ebenso wie zur Aufdeckung von Straftaten im Rahmen von § 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG
- 15 -
ein auf konkrete Tatsachen gegründeter Verdacht für das Vorliegen einer solchen Pflichtverletzung bestehen. Eine verdeckte Ermittlung „ins Blaue hinein“, ob ein Arbeitnehmer sich pflichtwidrig verhält, ist auch nach § 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG unzulässig.
(c) Die Gegenansicht, wonach § 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG immer dann, wenn der Arbeitgeber verdachts- und anlassbezogene Datenverarbeitung vornehme, Zugriffe auf arbeitsrechtliche Verstöße unterhalb der Schwelle von Straftaten sperre und es daher in einer solchen Konstellation verbiete, auf die Befugnisnorm in Satz 1 zurückzugreifen, erschöpft sich in der begründungslosen Behauptung, ein anderes Verständnis widerspreche offensichtlich dem systematischen Verhältnis der beiden Ermächtigungsgrundlagen (so Brink juris-PR-ArbR 36/2016 Anm. 2). Welches mit der juristischen Methodenlehre begründbare systematische Verhältnis der Vorschrift demnach zu Grunde liegen soll, wird nicht ausgeführt. Aus den vorgenannten Gründen liegt indes gerade kein systematischer Widerspruch vor, wenn § 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG als lediglich gesondert geregelter Spezialfall im Verhältnis zu Satz 1 der Bestimmung verstanden wird.
(d) Ein Verständnis von § 32 Abs. 1 BDSG im Sinne der vom Landesarbeitsgericht befürworteten Sperrwirkung des Satzes 2 bei anlassbezogener Datenerhebung wäre nicht mit Unionsrecht vereinbar. Es stünde nicht im Einklang mit Art. 5, Art. 7 Buchst. f der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (RL 95/46/EG - ABl. L 281 vom 23. November 1995 S. 31). § 32 Abs. 1 BDSG ist unionsrechtskonform unter Beachtung der RL 95/46/EG auszulegen, da die Bestimmungen des BDSG deren Umsetzung dienen (Schaub/Linck ArbR-HdB 16. Aufl. § 153 Rn. 2; Simitis in Simitis BDSG 8. Aufl. Einl. Rn. 89). Wären anlassbezogene Datenerhebungen ausschließlich gem. § 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG zur Aufdeckung von Straftaten zulässig, würden zu den in Art. 7 der RL 95/46/EG genannten zusätzliche Grundsätze eingeführt, was der
- 16 -
RL 95/46/EG widerspräche. Art. 7 RL 95/46/EG sieht eine erschöpfende und abschließende Liste der Fälle vor, in denen eine Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig ist (EuGH 24. November 2011 - C-468/10 und C-469/10 - [ASNEF] Rn. 30, Slg. 2011, I-12181).
(aa) Die Erhebung und Nutzung personenbezogener Daten auf dem Gebiet des Arbeitsrechts fällt in den Anwendungsbereich des Unionsrechts. Nach Art. 3 Abs. 1 RL 95/46/EG gilt diese für die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten sowie für die nicht automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einer Datei gespeichert sind oder gespeichert werden sollen. Die Anwendung der RL 95/46/EG ist nicht davon abhängig, ob in dem zu entscheidenden Sachverhalt ein hinreichender Zusammenhang mit der Ausübung der durch den Vertrag garantierten Grundfreiheiten oder tatsächlich ein Zusammenhang mit dem freien Verkehr zwischen den Mitgliedstaaten besteht (BAG 7. Februar 2012 - 1 ABR 46/10 - Rn. 31, BAGE 140, 350). Dies ergibt sich aus dem Wortlaut von Art. 3 RL 95/46/EG, der mit Ausnahme des in Abs. 2 bestimmten Bereichs die Verarbeitung personenbezogener Daten dem Anwendungsbereich der Richtlinie unterwirft (EuGH 20. Mai 2003 - C-465/00 - [Österreichischer Rundfunk ua.] Rn. 39 ff., 44, Slg. 2003, I-4989).
(bb) Nach Art. 7 Buchst. f RL 95/46/EG darf die Verarbeitung der Daten, wozu nach ihrem Art. 2 Buchst. b RL 95/46/EG die Erhebung und Benutzung gehört, zur Verwirklichung des berechtigten Interesses erfolgen, das von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen oder von dem bzw. den Dritten wahrgenommen wird, denen die Daten übermittelt werden, sofern nicht das Interesse oder die Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person überwiegen. Art. 5 RL 95/46/EG erlaubt den Mitgliedstaaten zwar, nach Maßgabe ihres Kapitels II und damit ihres Art. 7 die Voraussetzungen näher zu bestimmen, unter denen die Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig ist. Doch kann von dem Ermessen, über das die Mitgliedstaaten nach Art. 5 verfügen, nur im Einklang mit dem von der Richtlinie verfolgten Ziel der Wahrung eines Gleich-
- 17 -
gewichts zwischen dem freien Verkehr personenbezogener Daten und dem Schutz der Privatsphäre Gebrauch gemacht werden. Die Mitgliedstaaten dürfen nach Art. 5 RL 95/46/EG in Bezug auf die Zulässigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten daher keine anderen als die in Art. 7 RL 95/46/EG aufgezählten Grundsätze einführen und auch nicht durch zusätzliche Bedingungen die Tragweite der sechs in Art. 7 RL 95/46/EG vorgesehenen Grundsätze verändern (EuGH 19. Oktober 2016 - C-582/14 - [Breyer] Rn. 57; 24. November 2011 - C-468/10 und C-469/10 - [ASNEF] Rn. 33, 34 und 36). Die RL 95/46/EG sieht damit nicht nur eine Mindest-, sondern eine umfassende Harmonisierung vor (zur Begrifflichkeit EuGH 6. November 2003 - C-101/01 - [Lindqvist] Rn. 96 f., Slg. 2003, I-12971). Die Annahme, eine Datenerhebung zur Aufdeckung einer schwerwiegenden Pflichtverletzung unterhalb einer Straftat sei generell unzulässig, ohne dass es auf die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme unter Abwägung der beiderseitigen Interessen ankomme, stünde damit nicht im Einklang.
(cc) Zwar gilt die RL 95/46/EG nach ihrem Art. 3 Abs. 1 nur für die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten sowie für die nicht automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einer Datei gespeichert sind oder gespeichert werden sollen. Als eine solche Datei mit personenbezogenen Daten gilt jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach bestimmten Kriterien zugänglich sind, gleichgültig ob diese Sammlung zentral, dezentralisiert oder nach funktionalen oder geographischen Gesichtspunkten aufgeteilt geführt wird (Art. 2 Buchst. c RL 95/46/EG). Soweit nach deutschem Recht über § 32 Abs. 2 BDSG der Beschäftigtendatenschutz gem. Absatz 1 der Bestimmung über den Anwendungsbereich der Richtlinie hinaus auch dann gilt, wenn es um eine nicht in dieser Weise automatisierte Verarbeitung bzw. nicht in einer Datei gespeicherte Daten geht, ändert dies indes nichts daran, dass § 32 Abs. 1 BDSG ebenso und zuvörderst Sachverhalte im Anwendungsbereich der Richtlinie regelt, und daher nur einheitlich richtlinienkonform ausgelegt werden kann (zur Richtlinie 98/59/EG des Rates vom 20. Juli 1998 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über Massenentlassungen
- 18 -
vgl. EuGH 10. Dezember 2009 - C-323/08 - [Rodríguez Mayor ua.] Rn. 27, Slg. 2009, I-11621).
(e) Umgekehrt entspricht das hier vertretene Verständnis von § 32 Abs. 1 BDSG dem durch die Richtlinie garantierten Schutzniveau für die von einer Datenerhebung Betroffenen. Der Schutz des in Art. 7 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union garantierten Grundrechts auf Privatleben verlangt, dass sich die Ausnahmen und Einschränkungen in Bezug auf den Schutz der personenbezogenen Daten auf das absolut Notwendige beschränken müssen (EuGH 11. Dezember 2014 - C-212/13 - [Ryneš] Rn. 28). Einschränkungen des Rechts auf Schutz der personenbezogenen Daten können gerechtfertigt sein, wenn sie denen entsprechen, die im Rahmen von Art. 8 EMRK geduldet werden (EuGH 9. November 2010 - C-92/09 und C-93/09 - [Volker und Markus Schecke] Rn. 52, Slg. 2010, I-11063; BAG 19. Februar 2015 - 8 AZR 1007/13 - Rn. 20 f.). Diesen Anforderungen genügt der vom Senat herangezogene Verhältnismäßigkeitsgrundsatz (EGMR 5. Oktober 2010 - 420/07 - EuGRZ 2011, 471).
ff) Danach kommt im Streitfall, selbst wenn nicht die Aufdeckung einer im Beschäftigungsverhältnis begangenen Straftat iSd. § 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG in Rede gestanden haben sollte, entgegen der Auffassung des Landesarbeitsgerichts eine Rechtfertigung der durch die Beklagte veranlassten Überwachungsmaßnahme zu Zwecken des Beschäftigungsverhältnisses iSd. § 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG in Betracht. Ob die Verhältnismäßigkeit gewahrt wurde, kann der Senat nicht selbst beurteilen. Dafür bedarf es weiterer Feststellungen.
(1) Die Beklagte hat sich darauf berufen, sie habe das Detektivbüro im Juni 2015 beauftragt, nachdem sie Kenntnis von der E-Mail der Firma M vom 29. Mai 2015 erlangt habe. Danach erscheint nicht ausgeschlossen, dass sich daraus - ggf. zusammen mit schon vorher bestehenden Verdachtsmomenten - hinreichend konkrete Anhaltspunkte für eine schwerwiegende Pflichtverletzung des Klägers ergaben, nämlich einer für die Firma seiner Söhne entfalteten Konkurrenztätigkeit und einer zu diesem Zweck erfolgten Vortäuschung einer Ar-
- 19 -
beitsunfähigkeit. Ausreichend, um weitere Aufklärungsmaßnahmen zu rechtfertigen, wäre insofern bereits ein auf konkrete Tatsachen gestützter „einfacher“ Verdacht gewesen (zu § 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG BAG 22. Oktober 2016 - 2 AZR 395/15 - Rn. 25). Zwar müssen im Falle einer attestierten Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung begründete Zweifel an der Richtigkeit der ärztlichen Bescheinigung bestehen, um einen aufklärungsbedürftigen Verdacht des Vortäuschens einer Arbeitsunfähigkeit annehmen zu können (vgl. BAG 19. Februar 2015 - 8 AZR 1007/13 - Rn. 25). Hier können sich aber aus der E-Mail der Firma M vom 29. Mai 2015 hinreichende Verdachtsmomente sogar auf eine unerlaubte Konkurrenztätigkeit des Klägers ergeben haben. Eine solche würde schon für sich genommen und damit selbst im Falle tatsächlich bestehender Arbeitsunfähigkeit eine schwerwiegende Pflichtverletzung darstellen, deren weitere Aufklärung im berechtigten Interesse des Arbeitgebers läge.
(2) Zur Aufdeckung einer unerlaubten Konkurrenztätigkeit wäre die Einschaltung des medizinischen Dienstes nach § 275 Abs. 1a Satz 3 SGB V (vgl. dazu BAG 28. Mai 2009 - 8 AZR 226/08 - Rn. 26) kein geeignetes milderes Mittel gewesen (ebenso Edenfeld DB 1997, 2273, zu III 3 b; Becker DB 1983, 1253, 1257). Ob andere gleich wirksame, aber weniger stark in das informationelle Selbstbestimmungsrecht des Klägers eingreifende Aufklärungsmaßnahmen zur Verfügung gestanden hätten, wird das Landesarbeitsgericht, ggf. nachdem es ergänzende Feststellungen getroffen hat, zu würdigen haben.
(3) Es ist nach den bisherigen Feststellungen nicht ausgeschlossen, dass die von der Beklagten veranlasste Überwachungsmaßnahme zur Aufklärung des Verdachts auch im Übrigen verhältnismäßig war. Das wäre der Fall, wenn die Schwere des Eingriffs bei einer Gesamtabwägung nicht außer Verhältnis zu dem Gewicht der ihn rechtfertigenden Gründe stand.
II. Die Entscheidung des Landesarbeitsgerichts stellt sich nicht iSd. § 561 ZPO aus anderen Gründen als richtig dar. Sie unterliegt daher der Aufhebung (§ 562 Abs. 1 ZPO). Es sind bislang keine Umstände festgestellt, aufgrund derer die nach § 626 Abs. 1 BGB erforderliche Interessenabwägung im Ergebnis
- 20 -
ausschließlich zugunsten des Klägers ausfallen könnte. Andere Gründe für eine Unwirksamkeit der außerordentlichen Kündigung hat der Kläger nicht geltend gemacht. Die Sache ist deshalb zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Landesarbeitsgericht zurückzuverweisen (§ 563 Abs. 1 ZPO).
III. Von der Aufhebung und Zurückverweisung umfasst ist auch die Entscheidung des Landesarbeitsgerichts über die ordentliche Kündigung. Die Beklagte hat diese nur hilfsweise und damit auflösend bedingt für den Fall erklärt, dass bereits die außerordentliche Kündigung das Arbeitsverhältnis aufgelöst hat. Der auf die hilfsweise ordentliche Kündigung bezogene Kündigungsschutzantrag ist demnach dahin zu verstehen, dass er ebenfalls nur auflösend bedingt für den Fall gestellt ist, dass bereits der Kündigungsschutzantrag gegen die außerordentliche Kündigung ohne Erfolg bleibt.
IV. Ebenso der Aufhebung und Zurückverweisung unterliegt die Entscheidung des Landesarbeitsgerichts über die Widerklage auf Erstattung der Kosten für den Detektiveinsatz im Juni 2015. Die Revision ist auch insoweit begründet. Nach den bisherigen Feststellungen ist nicht ausgeschlossen, dass die Beklagte - sofern ihr Sachvortrag bzw. ihre Beweisangebote dazu verwertbar sind - aus § 280 Abs. 1 BGB gegen den Kläger einen Erstattungsanspruch für den Detektiveinsatz im Juni 2015 hat (zu den Anspruchsvoraussetzungen im Einzelnen vgl. BAG 28. Oktober 2010 - 8 AZR 547/09 - Rn. 24). Nach ihrem vom Landesarbeitsgericht in Bezug genommenen Vorbringen in den Vorinstanzen hat sich die Beklagte darauf berufen, „aufgrund des Ergebnisses (der) Maßnahme (stehe) fest, dass der Kläger zu einem Zeitpunkt, zu dem er bei (ihr) als arbeitsunfähig erkrankt im Betrieb nicht anwesend war, die absolut identischen Aufgaben bei der konkurrierenden Firma seiner Söhne durchführte, die er ansonsten bei (ihr) ausführen muss. Damit (stehe) ... fest, dass zum einen der Kläger für das Konkurrenzunternehmen seiner Söhne (arbeite), darüber hinaus, dass offensichtlich die Arbeitsunfähigkeit nicht (bestehe) und vorgetäuscht (sei)“. Dies legt nahe, dass die Beklagte behaupten will, der Kläger sei infolge der Überwachungsmaßnahme einer vorsätzlichen Vertragspflichtverletzung
- 21 -
nicht nur verdächtig, sondern überführt. Der Umstand, dass sie („nur“) eine Verdachtskündigung erklärt hat, besagt für sich genommen nicht, wie ihr Vortrag zur Konkurrenztätigkeit des Klägers bezogen auf den geltend gemachten Erstattungsanspruch zu verstehen ist.
V. Im Sinne der Aufhebung und Zurückverweisung begründet ist ebenfalls die Widerklage auf Auskunft. Das Landesarbeitsgericht hat ihre Abweisung ausschließlich auf das vermeintliche Verwertungsverbot gestützt.
Koch
Berger
Rachor
Koltze
Gerschermann
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gern:
 |
Dr. Martin Hensche Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hensche@hensche.de |
 |
Christoph Hildebrandt Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hildebrandt@hensche.de |
 |
Nina Wesemann Rechtsanwältin Fachanwältin für Arbeitsrecht Kontakt: 040 / 69 20 68 04 wesemann@hensche.de |