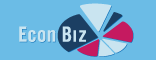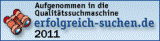- -> zur Mobil-Ansicht
- Arbeitsrecht aktuell
- Tipps und Tricks
- Handbuch Arbeitsrecht
- Gesetze zum Arbeitsrecht
- Urteile zum Arbeitsrecht
- Urteile 2023
- Urteile 2021
- Urteile 2020
- Urteile 2019
- Urteile 2018
- Urteile 2017
- Urteile 2016
- Urteile 2015
- Urteile 2014
- Urteile 2013
- Urteile 2012
- Urteile 2011
- Urteile 2010
- Urteile 2009
- Urteile 2008
- Urteile 2007
- Urteile 2006
- Urteile 2005
- Urteile 2004
- Urteile 2003
- Urteile 2002
- Urteile 2001
- Urteile 2000
- Urteile 1999
- Urteile 1998
- Urteile 1997
- Urteile 1996
- Urteile 1995
- Urteile 1994
- Urteile 1993
- Urteile 1992
- Urteile 1991
- Urteile bis 1990
- Arbeitsrecht Muster
- Videos
- Impressum-Generator
- Webinare zum Arbeitsrecht
-
Kanzlei Berlin
 030 - 26 39 62 0
030 - 26 39 62 0
 berlin@hensche.de
berlin@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Frankfurt
 069 - 71 03 30 04
069 - 71 03 30 04
 frankfurt@hensche.de
frankfurt@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hamburg
 040 - 69 20 68 04
040 - 69 20 68 04
 hamburg@hensche.de
hamburg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hannover
 0511 - 89 97 701
0511 - 89 97 701
 hannover@hensche.de
hannover@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Köln
 0221 - 70 90 718
0221 - 70 90 718
 koeln@hensche.de
koeln@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei München
 089 - 21 56 88 63
089 - 21 56 88 63
 muenchen@hensche.de
muenchen@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Nürnberg
 0911 - 95 33 207
0911 - 95 33 207
 nuernberg@hensche.de
nuernberg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Stuttgart
 0711 - 47 09 710
0711 - 47 09 710
 stuttgart@hensche.de
stuttgart@hensche.de
AnfahrtDetails
ArbG Berlin, Urteil vom 18.12.2013, 54 Ca 6322/13
| Schlagworte: | Diskriminierung: Religion | |
| Gericht: | Arbeitsgericht Berlin | |
| Aktenzeichen: | 54 Ca 6322/13 | |
| Typ: | Urteil | |
| Entscheidungsdatum: | 18.12.2013 | |
| Leitsätze: | ||
| Vorinstanzen: | ||
Arbeitsgericht Berlin
Geschäftszeichen (bitte immer angeben)
54 Ca 6322/13
Verkündet am 18.12.2013
als Urkundsbeamter/in
der Geschäftsstelle
Im Namen des Volkes
Urteil
In Sachen
pp.
hat das Arbeitsgericht Berlin, 54. Kammer, auf die mündliche Verhandlung vom 18.12.2013
durch den Richter am Arbeitsgericht Sch. als Vorsitzender
sowie die ehrenamtliche Richterin Frau V. und die ehrenamtliche Richterin Frau Dr. D.
für Recht erkannt:
I.
Der Beklagte hat an die Klägerin € 1957,73 (eintausendneunhundertsiebenundfünfzig 73/100) zu zahlen.
II.
Die Kosten des Verfahrens trägt der Beklagte.
III.
Der Streitwert wird auf 9.788,65 € festgesetzt.
- 2 -
T a t b e s t a n d :
Die Parteien streiten über einen Entschädigungsanspruch der Klägerin nach § 15 AGG wegen eines Verstoßes gegen das Benachteiligungsverbot.
Der Beklagte ist ein im Oktober 2012 gegründetes Werk der evangelischen Kirche in Deutschland, das durch Zusammenschluss des Diakonischen Werkes mit Brot für die Welt und des Evangelischen Entwicklungsdienstes entstanden ist. Grundlage seiner Tätigkeit ist die Satzung vom 14. Juni 2012 (Bl. 140-160 d.A.).
Zudem regelt die Richtlinie des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland nach Art. 9 Buchst. B Grundordnung über die Anforderungen der privatrechtlichen beruflichen Mitarbeit in der evangelischen Kirche in Deutschland und des Diakonischen Werkes vom 01. Juli 2005 die Anforderungen an die in privatrechtlichen Dienst- und Arbeitsverhältnissen beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Bl. 161-179 d.A.).
§§ 2, 3 der Richtlinie bestimmen:
㤠2 Grundlagen des kirchlichen Dienstes
1. Der Dienst der Kirche ist durch den Auftrag bestimmt, das Evangelium in Wort und Tat zu bezeugen. Alle Frauen und Männer, die in Anstellungsverhältnissen in Kirche und Diakonie tätig sind, tragen in unterschiedlicher Weise dazu bei, dass dieser Auftrag erfüllt werden kann. Dieser Auftrag ist die Grundlage der Rechte und Pflichten von Anstellungsträgern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
2. Es ist Aufgabe der kirchlichen und diakonischen Anstellungsträger, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den christlichen Grundsätzen ihrer Arbeit vertraut zu machen. Sie fördern die Fort- und Weiterbildung zu Themen des Glaubens und des christlichen Menschenbildes.
§ 3 Berufliche Anforderung bei der Begründung des Arbeitsverhältnisses
1. Die berufliche Mitarbeit in der Evangelischen Kirche und ihrer Diakonie setzt grundsätzlich die Zugehörigkeit zu einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche voraus, mit der die evangelische Kirche in Deutschland in Kirchengemeinschaft verbunden ist.
2. Für Aufgaben, die nicht der Verkündigung, Seelsorge, Unterweisung oder Leistung zuzuordnen sind, kann von Absatz 1 abgewichen werden, wenn andere geeignete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht zu gewinnen sind. In diesem Fall können auch Personen eingestellt werden, die einer anderen Mitgliedskirche der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland oder der Vereinigung Evangelischer Freikirchenangehören sollen. Die Einstellung von Personen, die die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht erfüllen, muss im Einzelfall unter Beachtung der Größe der Dienststelle oder Einrichtung und ihrer sonstigen Mitarbeiterschaft sowie der wahrzunehmenden Aufgaben und des jeweiligen Umfeldes geprüft werden. § 2 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.
Ferner gilt bei dem Beklagten die Dienstvertragsordnung der EKD vom 10.07.2008 (im Folgenden DVO-EKD - Bl. 164-179 d.A.), die die allgemeinen Arbeitsbedingungen der privatrechtlich beschäftigten Mitarbeiter der EKD, der Hauptgeschäftsstelle des Diakonischen Werkes und weiterer Werke und Einrichtungen regelt.
- 3 -
Eine von der Diakonie erstellte Mitarbeitendenstatistik zum 01.09.2008 weist einen Anteil von 53 % der Mitarbeiter als Mitglied einer evangelischen Kirche, 28,5 % als Mitglieder der römisch-katholischen Kirche, hingegen aber 16,5 % ohne Glaubensbekenntnis aus. In Berlin sind allein 46,6 % und in Brandenburg sogar 67,2 % der Mitarbeiter der Diakonie ohne Glaubensbekenntnis ausgewiesen (Bl. 283-288 d.A.).
Der Beklagte hat am 25. November 2012 die Stelle eines Referenten/einer Referentin (60%) befristet auf zwei Jahre ausgeschrieben (Bl. 21 d.A.). Gegenstand der Tätigkeit sollte ein unabhängiger Bericht zur Umsetzung der Antirassismuskonvention durch Deutschland als zusätzliche Grundlage für die Vereinten Nationen für ihren Abschließenden Bemerkungen zum deutschen Staatenbericht sein. Die Vergütung sollte in Anlehnung an die Gruppe E 13 TVöD nach der Dienstvertragsordnung der evangelischen Kirche in Deutschland erfolgen (DVO.EKD)
Die Anforderungen an die zu besetzende Stelle wurden wie folgt definiert:
„Das Aufgabengebiet umfasst:
- Begleitung des Prozesses zur Staatenberichterstattung 2012 bis 2014
- Erarbeitung des Parallelberichts zum deutschen Staatenbericht sowie von Stellungnahmen und Fachbeiträgen
- Projektbezogene Vertretung der Diakonie Deutschland gegenüber der Politik, der Öffentlichkeit und Menschrechtsorganisationen sowie Mitarbeit in Gremien
- Information und Koordination des Meinungsbildungsprozesses im Verbandsbereich
- Organisation, Verwaltung und Sachberichterstattung zum Arbeitsbereich
Sie erfüllen folgende Voraussetzungen:
- Abgeschlossenes Hochschulstudium der Rechtswissenschaften oder vergleichbare Qualifikation
- Fundierte Kenntnisse im Völkerrecht und der Antirassismusarbeit
- Gute Kenntnisse und Erfahrungen in der Bewirtschaftung von Projektmitteln
- Sehr gute Englischkenntnisse
- Analysefähigkeit, Lernbereitschaft, Initiative, Belastbarkeit
- Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung
- Kommunikations- und Teamfähigkeit
- Bereitschaft zu häufigen Dienstreisen
Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen ungeachtet ihrer Herkunft oder Hautfarbe, des Geschlechts, einer Behinderung, des Alters oder ihrer sexuellen Identität.
Die Mitgliedschaft in einer evangelischen oder der ACK angehörenden Kirche und die Identifikation mit dem diakonischen Auftrag setzen wir voraus. Bitte geben Sie Ihre Konfession im Lebenslauf an.“
Die Klägerin hat sich auf diese Stelle mit Schreiben 29.11.2012 einschließlich Lebenslauf innerhalb der Bewerbungsfrist beworben. Die Klägerin verfügt über ein abgeschlossenes Fachhochschulstudium der Sozialpädagogik. Einen Hinweis auf die Zugehörigkeit zu
- 4 -
irgendeiner Konfession oder auf das Fehlen einer Konfession enthält das Bewerbungsschreiben nicht (Bl. 22-23, 24-32 d.A.). Die Beklagte hat die Konfessionszugehörigkeit der Klägerin zu keiner Zeit nachgefragt.
Auf die ausgeschriebene Stelle haben sich neben der Klägerin weitere 37 Personen beworben, von denen vier zum Vorstellungsgespräch am 22.01.2013 eingeladen wurden. Die Klägerin wurde nicht zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen.
Ausgewählt wurde in der Folge Herr J. K. A. deutsch-ghanaischer Herkunft. Der Bewerber hat im Februar 2008 sein politikwissenschaftliches Studium an der Freien Universität mit einer englischsprachigen Diplomarbeit und sehr guten Noten abgeschlossen. Seit Februar 2008 arbeitet er an der Universität B. an einer Promotion mit internationalem Bezug (Bl.182-190 d.A.). In Bezug auf seine Konfessionszugehörigkeit hat er sich in seiner Bewerbung „als in der Berliner Landeskirche sozialisierten evangelischen Christen“ bezeichnet. Breiten Raum nimmt in seiner Bewerbung eine Liste von Publikationen und Forschungsarbeiten ein (Bl. 185-186 d.A.).
Nachdem die Klägerin am 23.01.2013 erfahren hatte, dass sie für die ausgeschriebene Stelle nicht berücksichtigt worden ist, hat sie durch Schreiben ihres Prozessbevollmächtigten 25.02.2013 gegenüber der Beklagten Entschädigungs- und Schadenersatzansprüche geltend machen lassen (Bl. 33, 34 d.A.).
Der Beklagte ließ seinerseits durch seine damaligen Prozessbevollmächtigten mitteilen, aufgrund welcher Umstände der bevorzugte Bewerber für die Besetzung der Stelle ausgewählt worden ist. Er verwies darauf, dass der eingestellte Bewerber über „eine weitaus höheres Maß an wissenschaftlicher Qualifikation und Erfahrung“ verfüge (Bl. 35, 36 d.A.).
Mit der am 30.04.2013 beim ArbG Berlin eingegangenen Klage fordert die Klägerin eine Entschädigung. Sie sei wegen ihrer Religion weniger günstig behandelt worden als andere vergleichbare Bewerber. Es bestehe die Vermutung, dass sie wegen ihrer Konfessionslosigkeit die Stelle nicht erhalten habe. Die Berücksichtigung der Religion im Bewerbungsverfahren sei nicht gerechtfertigt und rechtswidrig gewesen.
Die Klägerin erfülle die Voraussetzungen der Ausschreibung. Der bevorzugte Bewerber verfüge wie die Klägerin nicht über ein Studium der Rechtswissenschaften.
Sie bestreitet, dass der bevorzugte Bewerber und die zum Vorstellungsgespräch eingeladenen Bewerber die Anforderungen an die Ausschreibung erfüllten sowie die Ausführungen des Beklagten zu den Mitbewerbern und dem Prüfverfahren. Erfahrungen des bevorzugten Bewerbers mit antirassistischer Arbeit werden ebenfalls bestritten. Im Unterschied dazu verweist die Klägerin auf ihre diesbezüglichen praktischen Erfahrungen
- 5 -
und von ihr gefertigte Veröffentlichungen. Der Klägerin sei mangels Vorstellungsgesprächs die Möglichkeit der Darstellung dieser Arbeiten versagt geblieben.
Die Klägerin sei angesichts ihrer beruflichen Erfahrungen augenscheinlich qualifiziert. So sei sie als politische Referentin beim Bundesvorstand des DGB beschäftigt gewesen. Zudem seien die tatsächlichen beruflichen Erfahrungen und Qualifikationen mit einzubeziehen. Für die ausgeschriebene Stelle sei ein „passendes“ Studium nicht vorhanden. Dies gelte gleichermaßen für das Studium der Rechtswissenschaften wie für das Studium des bevorzugten Bewerbers in Politikwissenschaften und das Studium der Klägerin im Bereich Sozialpädagogik. Die in der Ausschreibung geforderte vergleichbare Qualifikation könne auch durch Berufserfahrungen erworben werden. Die Klägerin habe aufgrund ihrer praktischen Arbeit im Unterschied zum ausgewählten Bewerber umfassende Kenntnisse des internationalen Rechts. Eine Eignung sei nicht bereits dadurch ausgeschlossen, dass der Stellenbewerber nicht alle Anforderungen an die ausgeschriebene Stelle erfülle, sondern nur, wenn ihm die Mindestanforderungen dafür fehlten. Das Kriterium „vergleichbare Situation“ sei ein europarechtliches Kriterium und bedürfe der Auslegung durch den EuGH.
Die Klägerin sei zumindest mit allen Bewerbern zu vergleichen, die durch die Einladung zum Vorstellungsgespräch eine günstigere Behandlung erfahren hätten. Der Vergleich mit dem eingestellten Bewerber sei nur relevant, wenn es um die Frage gehe, ob die Klägerin ohne die Benachteiligung die Stelle erhalten hätte. Wenn die Religionszugehörigkeit ein Faktor in einem Motivbündel von mehreren Faktoren sei, sei bereits objektiv vom Vorliegen einer Benachteiligung auszugehen. Eine Diskriminierung sei nicht dadurch ausgeschlossen, dass es weitere Zulässige Gründe für die Benachteiligung gebe. Die Kirchenmitgliedschaft sei offizielles Einstellungskriterium gewesen.
Die Chancen der Klägerin seien bereits durch die Forderung in der Ausschreibung nach der evangelischen Konfession im Auswahlverfahren mitbeeinflusst worden. Mit der Ausschreibung habe der Beklagte mitgeteilt, dass er nach der Religion zu differenzieren beabsichtige. Bereits die Frage nach der Religion stelle einen erheblichen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht dar. Zudem stünden der Hinweis in der Ausschreibung, wonach die Einstellung „ungeachtet ihrer Herkunft“ erfolge, und die geforderte Religion in einem Spannungsverhältnis. Damit seien Bewerbungen aus der größten Berliner Migrantengruppe faktisch ausgeschlossen worden.
Die Berücksichtigung der Religion im Bewerbungsverfahren sei nur gerechtfertigt, wenn sie eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung angesichts der Tätigkeit darstelle. Dies treffe auf die zu besetzende Stelle nicht zu. Der Beklagte beschäftige auch Personen, die nicht der evangelischen Konfession angehörten. Dies lasse die als Sollvorschrift ausgestaltete Regelung von § 3 Ziffer 2 der Richtlinie es Rates der EKD zu und
- 6 -
werde durch die Mitarbeitendenstatistik der Diakonie belegt. Soweit der Beklagte dies restriktiver sehe, habe dies nichts mit dem Selbstbestimmungsrecht der Kirche zu tun. Der Beklagte müsse sich an die von der Kirche aufgestellten Grundsätze halten und dürfe diese nicht überschreiten. Nach dem Leitbild der evangelische Kirche (§ 3 EKD-RL) werde zwischen verkündigungsnaher und verkündigungsferner Tätigkeit unterschieden und für letztere die Mitgliedschaft in der Kirche nur als Sollvorschrift angesehen.
Die Klägerin bestreitet, dass der zu fertigende „unabhängige“ Bericht aus Sicht der evangelischen Kirche erfolge, da dieser nach Kenntnis der Klägerin auch aus projektbezogenen Fördermitteln der Klassenlotterie finanziert werde. Zudem werde der Bericht gemeinsam mit der Arbeitsgruppe Rassismus im Forum Menschenrechte erstellt, die nicht nur aus christlichen Gruppen bestehe. Beide hätten auch gemeinsam zu Veranstaltungen eingeladen (Bl. 289-290 d.A). Auf der Veranstaltung vom 09.08.2013 seien vom Stelleninhaber erklärt worden, dass es sich um einen unabhängigen Bericht von Nichtregierungsorganisationen handele.
Es sei fraglich, ob es sich bei den Mitgliedern der ACK um eine „bestimmte“ Religion im Sinne von § 9 AGG handeln könne. Die Mitgliedschaft in einer dieser Kirchen gewährleiste nicht, dass die Person tatsächlich den Glauben des Beklagten teile oder nicht vielmehr allein wegen der Beschäftigungsmöglichkeit bei der Kirche deren Mitglied sind.
Es liege keine gerechtfertigte Ungleichbehandlung im Sinne von § 9 AGG vor. Die Regelungen der evangelischen Kirche würden eine Kirchenmitgliedschaft nicht voraussetzen. Entsprechende Regelungen in der Richtlinie der EKD seien als Sollvorschriften ausgestaltet. Tatsächlich erfolge auch ein Beschäftigung von Mitarbeitern, die nicht Mitglied einer Kirche seien. Auch eine Kirchenmitgliedschaft indiziere keineswegs, dass sich die Mitglieder mit den Thesen und dem Leitbild der Kirche identifizieren.
Das Diskriminierungsverbot sei völkerrechtlich begründet und nicht geringer zu bewerten als etwa ein Willkürverbot. Der Beklagte müsse sich auch an europäisches Recht halten.
Wegen der europarechtlich gebotenen Auslegung der Sache, sei das Verfahren dem EuGH vorzulegen.
Es handele sich vorliegend um einen schweren Verstoß mit Wiederholungsgefahr. Deswegen sei eine Entschädigung auf mindestens 5 Bruttogehälter der Gruppe E13 TVöD bei einer Arbeitszeit von 60 % zu bemessen.
Wegen der Einzelheiten wird auf die Klage (Bl. 11-20 d.A.) sowie die Schriftsätze vom 15.11.2013 (Bl. 240-282 d.A.) und vom 02.12.2013 (Bl. 361-363 d.A.) nebst Anlagen verwiesen.
- 7 -
Die Klägerin beantragt,
den Beklagten zu verurteilen, an die Klägerin eine angemessene Entschädigung gem. § 15 AGG zu zahlen, deren Höhe in das Ermessen des Gerichts gestellt wird, € 9.788,65 jedoch nicht unterschreiten sollte.
Der Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.
Er verweist auf das für den Beklagten formulierte Leitbild seiner Tätigkeit und dessen Satzung. Der Beklagte verstehe sich als unmittelbare Lebens- und Wesensäußerung der christlichen Kirche, zu deren Sendungsauftrag vor allem die Verkündung des christlichen Glaubens sowie die tätige Nächstenliebe gehörten. Die Richtlinie über die Anforderungen der privatrechtlichen beruflichen Mitarbeit in der EKD und im Diakonischen sei unmittelbarer Ausfluss kirchlichen Rechts, die Angelegenheiten in eigener Sache frei und vom staatlichen Zugriff unabhängig regeln zu können. Bedeutsam für das Selbstverständnis des Beklagten sei das Bild der christlichen Dienstgemeinschaft, der die Besonderheit des kirchlichen Dienstes, der maßgeblich im Auftrag Jesu Christi geprägt sei. Davon sei neben dem Gottesdienst der aus dem Glauben erwachsende Dienst am Mitmenschen erfasst.
Der Beklagte sei als Teil kirchlichen Handelns kein „normaler“ Arbeitgeber, sondern unterliege über das Grundgesetz einem besonderen Schutz. Die Mitgliedschaft zu einer Kirche sei geeignetes Kriterium, um gewährleisten zu können, dass sich die Mitarbeiter mit dem Auftrag des Arbeitgebers identifizieren. Von den im Jahr 2013 bei dem Beklagten beschäftigten etwa 650 Arbeitnehmern des Beklagten gehörten 99 % einer christlichen Religion an.
Der von dem Beklagten zu erstellende Parallelbericht zur Umsetzung der Antirassismuskonvention sei unabhängig von staatlicher Berichterstattung die nach außen wirkende Positionierung der Beklagten zu der Konvention.
Wegen der starken Außenwirkung des Berichts und der ergänzenden Publikationen und Fachbeiträge sei ein möglichst wissenschaftlicher Hintergrund und publizistische Erfahrung erforderlich, gepaart mit entsprechendem Fachwissen. Die Tätigkeit des Stelleninhabers entfalte somit unmittelbare Außenwirkung für den Beklagten und die Evangelische Kirche sowie ihre Einrichtungen. Für den Beklagten sei daher ein rechtswissenschaftliches oder eine vergleichbare Qualifikation unverzichtbares Kriterium. Nach der Verkehrsanschauung seien für derartige Referentenstetellen typischerweise Personen mit universitärem Hochschulstudium eingestellt. Dies zeige sich auch in der Bewertung durch die Vergütungsgruppe E13 TVöD, die ein wissenschaftliche Hochschulstudium /Master voraussetze und mit dem höheren Beamtendienst vergleichbar sei.
- 8 -
Die eingegangenen Bewerbungen seien von der Fachabteilung des Beklagten gesammelt, registriert und geschlossen an die zuständige Abteilungsleiterin Zwickert weiter geleitet worden. Diese habe dann die Unterlagen gesichtet und die Qualifikationen der Bewerber verglichen. Ausnahmslos die vier Bewerber mit einem nachgewiesenen universitären Hochschulstudium seien in die engere Auswahl genommen und zum Vorstellungsgespräch am 22.01.2013 eingeladen worden. Die Auswahlentscheidung sei noch am selben Tage getroffen und am 24.01.2013 die Mitarbeitervertretung unterrichtet worden. Nachdem diese der Einstellung am 28.01.2013 zugestimmt habe, sei der Bewerber am 29.01.2013 entsprechend informiert worden.
Maßgebliche Auswahlkriterium zugunsten des Herrn J. K. A. seien dessen universitäre Hochschulausbildung sowie die Tätigkeit im wissenschaftlichen und publizierenden Bereich gewesen. Zudem habe er Erfahrungen mit Projektarbeit und -leitung vorweisen können und sich umfassend mit Themen zum Bereich Rassismus beschäftigt. Das Studium der Politikwissenschaften habe große Bezüge zum Bereich Völkerrecht und Staatenlehre. Schließlich seien die erheblichen nationalen und internationalen Qualifikationen beachtlich gewesen.
Eine Benachteiligung der Klägerin liege nicht vor. Bereits der Umstand, dass die Klägerin nicht über das geforderte universitäre Hochschulstudium verfüge, sei der Grund dafür gewesen, sie nicht zum Vorstellungsgespräch einzuladen. Auch die sozialpädagogische Ausrichtung der Klägerin sei weit entfernt vom Anforderungsprofil des Beklagten.
Es bedürfe zur Prüfung des Entschädigungsanspruchs einer vergleichbaren Situation (§ 3 Abs. 1 AGG). Eine solche liege bereits nicht vor. Der Beklagte habe Wert auf ein universitäres Hochschulstudium gelegt, welches die Klägerin im Unterschied zum berücksichtigten Bewerber nicht vorweisen könne.
Bei angenommener unterschiedlicher Behandlung wegen der Religion sei eine solche nach § 9 AGG gerechtfertigt. Der Beklagte sei eine einer Religionsgemeinschaft zugeordnete Einrichtung in diesem Sinne. Die Religion stelle eine unter Beachtung des Selbstverständnisses nach der Art der Tätigkeit eine gerechtfertigte berufliche Anforderung dar. Mit der Tätigkeit werde der Stelleninhaber unmittelbar nach außen für den Beklagten tätig und vertrete dessen Meinung und die seiner nachgeordneten Einrichtungen in Literatur, Öffentlichkeit und Politik. Da der Stelleninhaber einen Parallelbericht zum Staatenbericht der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich der UN-Antirassismuskonvention verfasse, in der Zentrale des Beklagten angesiedelt sei und damit intensive Einblicke in die innere Struktur des Beklagten erhalte, sei es äußerst bedeutsam, dass er im inneren Einklang mit den Werten und Überzeugungen des Beklagten agiere.
- 9 -
Nach den für den Beklagten maßgeblichen Regelungen als Ausfluss von Art. 140 GG in Verbindung mit Art 137 Abs. 3 WRV sei die Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche eine notwendige Anforderung für die Begründung des Arbeitsverhältnisses. Das Recht des Beklagten, eine solche Anforderung zu stellen, sei vom Bundesverfassungsgericht ausdrücklich anerkannt. Zu einem anderen Ergebnis komme man auch nicht bei Auslegung der EU-Richtlinie 2000/78/EG, auf die das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz zurückgehe.
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz berücksichtige die Vorgaben der EG-Richtlinie 2000/78/EG sowie die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts und habe zugleich das kirchliche Arbeitsrecht weder abgeändert noch abändern wollen. Soweit nach der Rechtsprechung anerkannt sei, dass ein Kirchenaustritt die Beendigung des Arbeitsverhältnisses zur Folge haben könne, müsse dies auch für die Begründung von Arbeitsverhältnissen gelten, damit keine systematischen Widersprüche entstünden. Der Gesetzgeber habe mit § 9 AGG die geltende Rechtslage aufrechterhalten wollen.
Eine davon abweichende richtlinienkonforme Auslegung von § 9 AGG sei nicht geboten. Die Regelung bewege sich im Rahmen des gesetzten Gestaltungsrahmens und sei mit der Richtlinie vereinbar. Die Religion sei eine gerechtfertigte berufliche Anforderung im Sinne von § 9 AGG für die zu besetzende Stelle. Ein von der EU-Kommission durchgeführtes Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland wegen der Umsetzung der Richtlinie sei am 06. Mai 2008 eingestellt worden.
Einer Vorlage der Sache an den Europäischen Gerichtshof bedürfe es nicht, da die Frage der europarechtskonformen Auslegung von § 9 AGG nicht entscheidungserheblich sei.
Schließlich sei eine Entschädigung im Falle einer Verurteilung des Beklagten angesichts der Gesamtumstände weit unterhalb der gesetzlich festgesetzten drei Monatsvergütungen gerechtfertigt.
Wegen der Einzelheiten wird auf die Schriftsätze des Beklagten vom 16.09.2013 (Bl. 59-138 d.A.) und vom 29.11.2013 (Bl. 342-354 d.A.) nebst Anlagen verwiesen.
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :
I.
Der auf Zahlung einer Entschädigung gerichtete Klageantrag ist uneingeschränkt zulässig gem. § 253 Abs. 2 ZPO, insbesondere ist er hinreichend bestimmt (§ 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO). Die Klägerin durfte die Höhe der von ihr begehrten Entschädigung in das Ermessen des Gerichts stellen. § 15 Abs. 2 Satz 1 AGG räumt dem Gericht bei der Höhe der Entschädigung einen Beurteilungsspielraum ein, weshalb eine Bezifferung des
- 10 -
Zahlungsantrags nicht notwendig ist. Erforderlich ist allein, dass der Kläger Tatsachen, die das Gericht bei der Bestimmung des Betrags heranziehen soll, benennt und die Größenordnung der geltend gemachten Forderung angibt (BAG v. 13.10.2011, 8 AZR 608/10, EzA § 15 AGG Nr 16, Rn. 16). Diese Voraussetzungen sind erfüllt. Die Klägerin hat einen Sachverhalt dargelegt, der dem Gericht die Bestimmung einer Entschädigung ermöglicht, und den Betrag der angemessenen Entschädigung beziffert.
II.
Die Klage ist auch begründet. Die Klägerin kann die Zahlung einer Entschädigung gem. § 15 Abs. 2 AGG von dem Beklagten verlangen. Der Beklagte hat bei der Besetzung der Stelle des Referenten/der Referentin gegen das Verbot verstoßen, Beschäftigte wegen ihrer Religion zu benachteiligen (§§ 7 und 1 AGG).
1.
Als Bewerberin ist die Klägerin nach § 6 Abs. 1 Satz 2 AGG „Beschäftigte“ und fällt in den persönlichen Anwendungsbereich des AGG. Unerheblich ist dabei, ob der Bewerber für die ausgeschriebene Tätigkeit objektiv geeignet ist (BAG v. 19.08.2010, 8 AZR 466/09, NZA 2011, 203-206; 8 AZR 370/09, NZA 2011, 200-202).
2.
Der Beklagte ist als „Arbeitgeber“ passiv legitimiert. Nach § 6 Abs. 2 Satz 1 AGG ist Arbeitgeber im Sinne des Gesetzes, wer „Personen nach Absatz 1“ des § 6 AGG „beschäftigt“. Arbeitgeber eines Bewerbers ist also der, der um Bewerbungen für ein von ihm angestrebtes Beschäftigungsverhältnis gebeten hat (BAG v. 19.08.2010, 8 AZR 370/09, NZA 2011, 200-202). Aufgrund seiner Stellenausschreibung trifft dies auf den Beklagten zu.
3.
Die Klägerin hat die gesetzlichen Fristen nach § 15 Abs. 4 AGG zur Geltendmachung des Anspruchs auf Entschädigung gewahrt.
a) Nach § 15 Abs. 4 Satz 1 AGG ist ein Anspruch nach Abs. 1 oder Abs. 2 des § 15 AGG innerhalb einer Frist von zwei Monaten schriftlich geltend zu machen. Im Falle einer Bewerbung beginnt die Frist mit dem Zugang der Ablehnung (§ 15 Abs. 4 Satz 2 AGG). Die Klägerin hat unstreitig am 23. Januar 2013 von der Ablehnung ihrer Bewerbung Kenntnis erlangt. Das Schreiben des Prozessbevollmächtigten der Klägerin vom 25. Februar 2013 war damit fristwahrend.
- 11 -
b) Die am 30. April 2013 per Telefax und am 03. Mai 2013 im Original beim Arbeitsgericht Berlin eingegangene und dem Beklagten am 10. Mai 2013 zugestellte Klage wahrte die Dreimonatsfrist des § 61b Abs. 1 ArbGG.
4.
Die Klägerin hat in einer vergleichbaren Situation im Zusammenhang mit der Bewerbung auf die Stelle als Referentin objektiv eine weniger günstige Behandlung erfahren als die vier zu Vorstellungsgesprächen eingeladenen Mitbewerber.
a) Voraussetzung für einen Entschädigungsanspruch nach § 15 Abs. 2 AGG ist ein Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot des § 7 AGG. § 15 Abs. 2 AGG enthält lediglich eine Rechtsfolgenregelung, für die Anspruchsvoraussetzungen ist auf § 15 Abs. 1 AGG zurückzugreifen (BAG v. 16.02.2012, 8 AZR 697/10 NZA 2012, 667, Rn. 30).
b) Gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 AGG liegt eine unmittelbare Benachteiligung vor, wenn ein Beschäftigter wegen eines in § 1 AGG genannten Grundes eine weniger günstige Behandlung erfährt als eine andere Person in einer vergleichbaren Situation erfährt, erfahren hat oder erfahren würde. Zu diesen Gründen zählen auch solche der Religion, also sowohl Benachteiligungen wegen der Zugehörigkeit zu einer solchen als auch des Fehlens einer Religionszugehörigkeit.
aa) Nach § 11 AGG darf ein Arbeitsplatz nicht unter Verstoß gegen § 7 Abs. 1 AGG ausgeschrieben werden. Eine Ausschreibung verstößt gegen § 7 Abs. 1 AGG, wenn Menschen, die ein in § 1 AGG genanntes Merkmal aufweisen, vom Kreis der für die zu besetzende Stelle in Betracht kommenden Personen ausgeschlossen werden (BAG v. 19.08.2010, 8 AZR 530/09 NZA 2010, 1412-1418, Rn. 57). Die Verletzung der Verpflichtung, einen Arbeitsplatz nicht unter Verstoß gegen § 7 Abs. 1 AGG auszuschreiben, kann die Vermutung begründen, die Benachteiligung sei wegen des in der Ausschreibung bezeichneten verbotenen Merkmals erfolgt (BAG v. 19.08.2010, 8 AZR 530/09, Rn. 59, aaO.).
bb) Es liegt eine ungünstigere Behandlung der Klägerin vor.
Diese besteht darin, dass sie aus dem Auswahlverfahren ausgeschieden und im Unterschied zu vier anderen Bewerbern von dem Beklagten nicht zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen worden ist. Der Klägerin wurde damit bereits im Vorfeld der eigentlichen Besetzungsentscheidung die Chance auf Einstellung genommen. Dies stellt eine ungünstigere Behandlung dar, unabhängig davon, ob die Klägerin eingestellt worden wäre (BAG v. 18.03.2010, 8 AZR 1044/08, NZA 2010, 1129-1133, mwN). Ein Nachteil im Rahmen
- 12 -
einer Auswahlentscheidung liegt auch dann vor, wenn der Bewerber - wie hier die Klägerin - nicht in die Auswahl einbezogen, sondern vorab in einem Bewerbungsverfahren ausgeschieden wird. Die Benachteiligung liegt bereits in der Versagung einer Chance (st. Rspr., vgl. BAG v. 13.10.2011, 8 AZR 608/10, EzA AGG § 15 Nr. 16, Rn. 24).
cc) Die Ungleichbehandlung der Klägerin erfolgte wegen der fehlenden konfessionellen Bindung und damit aus Gründen der Religion. Neben den fachlichen Anforderungen an die Bewerber setzte der Beklagte ausdrücklich „die Mitgliedschaft in einer evangelischen oder der ACK angehörenden Kirche und die Identifikation mit dem diakonischen Auftrag“ voraus. Damit wurde bereits in der Ausschreibung deutlich gemacht, dass der Beklagte neben fachlich-inhaltlichen Anforderungen auch an die Religionszugehörigkeit anknüpft und diese sogar ausdrücklich als „Voraussetzung“ für eine erfolgreiche Bewerbung definiert. Die fehlende Einbeziehung der Klägerin in die nähere Auswahl war damit zumindest auch durch das verpönte Merkmal „Religion“ indiziert.
Der Kausalzusammenhang zwischen benachteiligender Behandlung und dem Merkmal der Religion ist bereits dann gegeben, wenn die Benachteiligung an die Religion anknüpft oder durch diese motiviert ist. Dabei ist es nicht erforderlich, dass der betreffende Grund das ausschließliche Motiv für das Handeln des Benachteiligenden ist. Ausreichend ist vielmehr, dass das verpönte Merkmal Bestandteil eines Motivbündels ist, welches die Entscheidung beeinflusst hat. Auf ein schuldhaftes Handeln oder gar eine Benachteiligungsabsicht kommt es nicht an (BAG v. 20.06.2013, 8 AZR 482/12, EzA-SD 2013, Nr. 22, 7-10, Rn. 41, mwN).
dd) Es bestehen entgegen der Ansicht des Beklagten auch keine Bedenken gegen das Vorliegen einer vergleichbaren Situation.
(1) Die objektive Eignung einer Bewerberin ist keine Tatbestandsvoraussetzung für einen Anspruch nach § 15 Abs. 1 oder 2 in Verb. mit § 6 Abs. 1 Satz 2 AGG. Der Wortlaut des § 6 Abs. 1 Satz 1 AGG bietet keinen Anhaltspunkt für das Erfordernis eines solchen Tatbestandsmerkmals. Für eine Auslegung über den Wortlaut hinaus besteht auch angesichts des § 3 Abs. 1 AGG kein Bedürfnis. Vergleichbar i.S.d. § 3 Abs. 1 S. 1 AGG ist die Auswahlsituation nur für Arbeitnehmer, die gleichermaßen die objektive Eignung für die zu besetzende Stelle aufweisen. Maßgeblich für die objektive Eignung ist dabei nicht das formelle Anforderungsprofil des jeweiligen Arbeitgebers, sondern die Anforderungen, welche an die jeweilige Tätigkeit nach der im Arbeitsleben herrschenden Verkehrsanschauung gestellt werden (BAG v. 18.03.2010, 8 AZR 1044/08, aaO, Rn. 23, 31 mwN).
(2) Die ungünstigere Behandlung der Klägerin erfolgte in einer vergleichbaren Situation iSd. § 3 Abs. 1 S. 1 AGG, denn die Klägerin erfüllte die Voraussetzung, objektiv für die
- 13 -
Beschäftigung als Referentin geeignet zu sein. Vergleichbar iSd. § 3 Abs. 1 Satz 1 AGG ist die Auswahlsituation nur für Arbeitnehmer, die gleichermaßen die objektive Eignung für die zu besetzende Stelle aufweisen. Die objektive Eignung ist Kriterium der „vergleichbaren Situation“ iSd. § 3 Abs. 1 AGG.
Der Beklagte hat eine Stelle als Referent/Referentin ausgeschrieben. Entgegen der Behauptung des Beklagten weist bereits das – nach der Rechtsprechung nicht maßgebliche - Anforderungsprofil der Ausschreibung nicht das Erfordernis eines Hochschulabschlusses aus, sondern „ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Rechtswissenschaften oder vergleichbare Qualifikation“ und verweist hinsichtlich der Vergütung auf die Entgeltgruppe 13 TVöD. Dabei mag es sein, dass er Beklagte subjektiv nur andere wissenschaftliche Hochschulabschlüsse als vergleichbar angesehen haben mag. Objektiv ist dies jedenfalls nicht der Fall und die Ausschreibung lässt dies auch nicht erkennen.
Zunächst enthält der TVöD selbst nur aktuelle Entgelttabellen, die für den die Entgeltgruppe 13 beim Bund ein Grundgehalt in der Stufe 1 von 3.262,89 € ausweist. Die Eingruppierung selbst bestimmt der Tarifvertrag derzeit nicht, sondern greift noch auf die Vergütungsordnung des BAT zurück. Nach den Überführungsregeln im öffentlichen Dienst entspricht die Entgeltgruppe 13 des TVöD der Vergütungsgruppe IIa BAT (ohne Ib). Dieser sieht in der ersten Fallgruppe zwar das Merkmal einer abgeschlossenen wissenschaftlichen Hochschulausbildung und eine entsprechende Tätigkeit vor, alternativ jedoch auch gleichwertige Fähigkeiten und Erfahrungen bei entsprechender Tätigkeit. Die Fallgruppe 3 der Vergütungsgruppe IIa BAT erfordert nicht einmal ein Hochschulstudium, sondern lässt bei Tätigkeiten im kommunalen Bereich eine Eingruppierung auch ohne Nachweis einer speziellen Qualifikation eine Einstufung in diese Vergütungsgruppe zu, wenn schwierige Aufgaben zu erledigen sind und die Größe der Verantwortung dies erfordern. Insoweit ist bereits die Grundannahme des Beklagten, Entgeltgruppe 13 erfordere einen Hochschulabschluss, fehlerhaft.
Als „Referent“ wird im öffentlichen Dienst ein Mitarbeiter im höheren Dienst, in der Regel als Referatsleiter, und in der Privatwirtschaft häufig ein höherer Sachbearbeiter verstanden, dessen Tätigkeit in der Regel ein absolviertes Studium voraussetzt, aber auch allgemein als Vortragender oder Berichterstatter (vgl. u.a. Duden, Stichwort: Referent). Angesichts der wahrzunehmenden Aufgaben der Berichterstattung zur Umsetzung der UN-Antirassismuskonvention kann vorliegend eher von letzterer Begriffsbedeutung und der dazu bestehenden herrschenden Verkehrsauffassung ausgegangen werden. Für eine solche Tätigkeit ist – je nach Art der Berichterstattung – ein wissenschaftliches Hochschulstudium sicherlich nützlich, aber nicht zwingend erforderlich. Bei vorhandenen gleichwertigen Fähigkeiten, Erfahrungen und Kenntnissen kann den Anforderungen an eine derartige
- 14 -
Referententätigkeit ohne weiteres entsprochen werden. Der Beklagte stellt im Rahmen der Vergleichbarkeit der Situation indes allein auf den wissenschaftlichen Charakter der vergleichbaren Qualifikation ab, den die weder die Stellenausschreibung selbst, noch die Referententätigkeit als solche nach herrschender Verkehrsauffassung erfordert.
Die Klägerin hat im Rahmen ihrer Bewerbung auf unstreitig vorhandene langjährige einschlägige Erfahrungen und Kenntnisse in der Antirassismusarbeit, Projektarbeit, Geschäftsführung von Organisationen, in der Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Organisationen und als Referentin des DGB-Bundesvorstands und des Informations- und Dokumentationszentrums in der Antirassismusarbeit (IDA) verwiesen. Die Klägerin hat damit ihre objektive Eignung für die zu besetzende Stelle ohne weiteres nachgewiesen.
Beide Bewerber erfüllen unstreitig nicht die Anforderung aus der Ausschreibung „wissenschaftliche Hochschulstudium der Rechtswissenschaft“. Die Klägerin hat in Bezug auf die alternativ geforderte „vergleichbare Qualifikation“ die Voraussetzungen für die zu besetzende Referentenstelle ebenso erfüllt wie der bevorzugte Bewerber auf anderem Wege.
5.
Die unmittelbare Benachteiligung der Klägerin erfolgte wegen der fehlenden Religionszugehörigkeit der Klägerin und war nicht durch § 9 AGG gerechtfertigt und damit nicht zulässig.
a) Bei dem Beklagten handelt es sich um eine einer Religionsgemeinschaft zugeordneten Einrichtung im Sinne von § 9 Abs. 1 AGG. Die Evangelische Kirche in Deutschland ist fraglos eine Religionsgemeinschaft. Sie hat den Beklagten gebildet, um nach den kirchlichen Auftrag allen Menschen durch Wort und Tat zu bezeugen, mit dem Beklagten wahrzunehmen und die Zusammengehörigkeit des Entwicklungsdienstes mit der Diakonie als Wesens- und Lebensäußerung der Kirche zu bekräftigen (vgl. Präambel der Satzung Bl. 140 d.A.). Damit entspricht er den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen (vgl. u.a. BVerfG v. 04.06.1985, 2 BvR 1718/83, NJW 1986, 367). Auf die Rechtsform kommt es nicht an, so dass auch religiöse Vereine, wie der Beklagte, darunter fallen können.
b) Das Selbstverständnis des Beklagten und das Selbstbestimmungsrecht der Evangelischen Kirche in Deutschland rechtfertigen die Benachteiligung der Klägerin nicht.
aa) Die Fragen des Selbstverständnisses der Kirche und ihre juristische Reichwerte wurden im Wesentlichen durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aus den sechziger bis achtziger Jahren beantwortet und geprägt, die durch den Beklagten teilweise
- 15 -
zitiert wurde (vgl. u.a. BVerfG v. 16.10.1968, 1 BvR 241/66, NJW 1969, 31; v. 04.06.1985, 2 BvR 1703/83; 2 BvR 1718/83; 2 BvR 856/84, NJW 1986, 367-372). So hat das Bundesverfassungsgericht zum Selbstverständnis der Katholischen und Evangelischen Kirche festgestellt, dass die Religionsausübung nicht nur den Bereich des Glaubens und des Gottesdienstes umfasst, sondern auch die Freiheit zur Entfaltung und Wirksamkeit in der Welt, wie es ihrer religiösen und diakonischen Aufgabe entspricht. Die tätige Nächstenliebe ist nach dem Neuen Testament eine wesentliche Aufgabe für den Christen und wird von der Katholischen wie der Evangelischen Kirche als kirchliche Grundfunktion verstanden (BVerfG v. 16.10.1968, 1 BvR 241/66, Rn. 26, NJW 1969, 31). Wollte man indes ausgehend davon allen in der Kirche und ihren Einrichtungen zu besetzenden Stellen, unabhängig von der Art der Tätigkeit und ihrer Nähe oder Entfernung zu Aufgaben der Verkündigung, Seelsorge, Unterweisung oder Leitung, von der Mitgliedschaft in der Kirche abhängig machen, würde dies zwingend zu entsprechenden Diskriminierungen bei der Stellenbesetzung führen, ohne dass dies eine gerechtfertigte berufliche Anforderung im Sinne von § 9 Abs. 1 AGG darstellen würde (vgl. dazu näher unter Abschnitt I.5.c) der Entscheidungsgründe). Demgemäß differenziert § 5 der Richtlinie des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland auch dahingehend, dass die Zugehörigkeit zu einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland oder einer mit ihr verbundenen Kirchengemeinschaft in bestimmten Fällen verzichtbar ist, wenn die zu übertragenden Aufgaben nicht der Verkündigung, Seelsorge, Unterweisung oder Leitung dienen. Tatsächlich ist nach den vorliegenden Statistiken der Diakonie auch ein nicht unbeträchtlicher Anteil von Mitarbeitern der Diakonie, in Berlin immerhin fast die Hälfte nicht konfessionell gebunden. Der Beklagte räumt zudem ein, dass auch bei ihm zumindest keine 100 %ige konfessionelle Bindung der Mitarbeiter gegeben ist.
Angesichts der sich aus dem Europäischen Recht, hier insbesondere Art 4 Abs. 1 der EG.-Richtlinie 2000/78/EG, und dem in der Folge aus dem Allgemeinen Gelichbehandlungsgesetz ergebenden neueren Anforderungen, bedarf die bisherige Bewertung des kirchlichen Selbstverständnisses daher einer Neuinterpretation dahingehend, dass das Selbstverständnis bei konkreten Beschäftigungsverhältnissen nur dann eine entscheidende Rolle spielt, wenn dieses in einer direkten Beziehung zum Selbstverständnis der Kirche oder ihrer Einrichtungen steht (vgl. Däubler/Bertzbach-Wedde § 9 Rn. 35). Anderenfalls liefe dies darauf hinaus, dass die Kirche und somit auch der Beklagte gänzlich frei über seine Einstellungspraxis und damit über Differenzierungskriterien entscheiden könnte.
Zudem gibt die Satzung des Beklagten und die darin erklärten Ziele einen Hinweis darauf, dass sein Selbstverständnis schwerpunktmäßig eher in der Verfolgung allgemeiner
- 16 -
humanistischer Ziele liegt, wie allen Menschen unterschiedslos Beistand zu leisten, Ursachen ihrer Nöte aufzudecken, zu benennen und zu beseitigen, bei der Überwindung von Armut, Hunger und Not in der Welt beizutragen, für eine gerechtere Gesellschaft und ein nachhaltige Entwicklung einzutreten (vgl. Präambel Bl. 140 d.A.)
bb) Dies widerspräche indes dem Charakter des § 9 AGG als Ausnahmevorschrift zu § 7 AGG. Dabei wird durch § 9 AGG nicht generell jegliches Handeln der Kirche und ihrer Einrichtungen in Bezug auf die Behandlung ihrer Mitarbeiter wegen der Religion ausgenommen, sondern nur, „soweit dies nach Art der Tätigkeit eine gerechtfertigte berufliche Anforderung darstellt“ (§ 9 Abs. 1 letzter Halbsatz AGG). Das bedeutet, dass auch innerhalb der Kirchen der Regelfall gerade ein anderer ist und nach der gesetzlichen Vorgabe sein muss. Das folgt auch aus dem Erwägungsgrund 23 der Richtlinie 2000/78/EG (ABL EG Nr. L 303/16 v. 02.12.2000), wonach nur „unter sehr begrenzten Bedingungen … eine unterschiedliche Behandlung gerechtfertigt sein (kann), wenn ein Merkmal, das mit der Religion … zusammenhängt, eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung darstellt, sofern es sich um einen rechtmäßigen Zweck und eine angemessene Anforderung handelt.“
cc) Das Selbstbestimmungsrecht der Kirche oder ihrer Einrichtungen hat für die konkrete Ausschreibung und Stellenbesetzung auch nur mittelbare Bedeutung. Gestützt auf das Selbstbestimmungsrecht kann jedenfalls nicht die konkrete Einstellungsentscheidung begründet werden, denn auch dies liefe wiederum auf eine gänzlich freie Entscheidung des Beklagten hinaus, ohne an Grundsätze Europäischen und innerstaatlichen Rechts gebunden zu sein. Das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen nach Art. 137 Abs. 3 WRV bezieht sich ausdrücklich auf das „Ordnen“ und „Verwalten“ ihrer Angelegenheiten innerhalb der Grenzen geltenden Rechts. Damit sind die Kirchen berechtigt, eigenständiges Recht zu schaffen, wie es vorliegend z.B. im Rahmen der Richtlinie des Rates der Evangelischen Kirchen in Deutschland und der DVO.EKD erfolgt ist. In diesem Rahmen kann die Kirche grundsätzlich auch selbst festlegen, dass bestimmte Positionen nur mit Mitgliedern der Kirche besetzt werden, soweit sich die unterschiedliche Behandlung in objektiver Weise unmittelbar aus den Glaubenszielen der Religionsgemeinschaft ableitet (vgl. Däubler/Bertzbach-Wedde § 9 Rn. 49). Dies kann bei der hier zu besetzenden Position nicht angenommen werden. Die Erstellung eines Berichts an die Vereinten Nationen zur Umsetzung der Antirassismuskonvention hat zwar auch einen Bezug zu den Glaubenszielen der Evangelischen Kirche, der sich vermutlich auch in der Art der Berichterstattung teilweise niederschlagen wird, leitet sich indes nicht unmittelbar und zwingend daraus ab.
c) Im Hinblick auf die Art der mit der Ausschreibung zu besetzenden Stelle und der daraus erwachsenden Tätigkeit stellt auch unter Berücksichtigung der obigen Ausführungen zum
- 17 -
Selbstverständnis und Selbstbestimmungsrecht der Kirchen keine gerechtfertigte berufliche Anforderung dar.
aa) Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz stellt einen Teil der Umsetzung europäischer Antidiskriminierungsrichtlinien, unter anderem der Richtlinie 2000/78/EG, dar (BGBl. 2006, I, S. 1897). Dessen Regelungen und damit auch § 9 AGG sind damit richtlinienkonform auszulegen. Nach der Rechtsprechung des EUGH ist das innerstaatliche Recht „soweit wie möglich“ anhand des Wortlauts und des Zwecks der einschlägigen Richtlinie zu interpretieren (vgl. u.a. EUGH v. 24.01.2012, C-282/10, NZA 2012, 139-142).
Erwägungsgrund 23 der Richtlinie 2000/78/EG (ABL EG Nr. L 303/16 v. 02.12.2000), bestimmt, dass nur „unter sehr begrenzten Bedingungen … eine unterschiedliche Behandlung gerechtfertigt sein (kann), wenn ein Merkmal, das mit der Religion … zusammenhängt, eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung darstellt, sofern es sich um einen rechtmäßigen Zweck und eine angemessene Anforderung handelt.“ Im Hinblick auf den Status der Kirchen wird im Erwägungsgrund Nr. 24 die Möglichkeit eröffnet, spezifische Bestimmungen über die wesentlichen, rechtmäßigen und gerechtfertigten beruflichen Anforderungen beizubehalten oder vorzusehen, die Voraussetzung für die Ausübung einer diesbezüglichen beruflichen Tätigkeit sein können.
Im Unterschied zum Wortlaut des § 9 AGG, der lediglich von „gerechtfertigten“ beruflichen Anforderungen spricht, stellt die Europäische Richtlinie auf die „wesentlichen, rechtmäßigen und gerechtfertigten beruflichen Anforderungen“ ab. Auf diese Erwägungen der Rahmenrichtlinie wird in der offiziellen Gesetzesbegründung auch ausdrücklich hingewiesen und zu § 9 Abs. 1 des Entwurfs zum AGG wörtlich der Erwägungsgrund 24 als Begründung für die gesetzliche Regelung zitiert und in den letzten beiden Sätze der Begründung zu § 9 Abs. 1 die Formulierungen des Gesetzes mit denen der Rahmenrichtlinie faktisch gleichgesetzt, ohne indes den Wortlaut entgegen ursprünglicher Absicht auch so in das Gesetz aufzunehmen. So heißt es unter Hinweis auf den Erwägungsgrund 24, dass die Mitgliedstaaten in dieser Hinsicht spezifische Bestimmungen über die wesentlichen, rechtmäßigen und gerechtfertigten beruflichen Anforderungen beibehalten oder vorsehen können, die Voraussetzung für die Ausübung einer diesbezüglichen beruflichen Tätigkeit sein können. Entsprechend erlaube § 9 Abs. 1 es Religionsgemeinschaften und den übrigen dort genannten Vereinigungen, bei der Beschäftigung wegen der Religion oder der Weltanschauung zu differenzieren, wenn eine bestimmte Religion oder Weltanschauung im Hinblick auf ihr Selbstbestimmungsrecht oder nach der Art der Tätigkeit eine gerechtfertigte berufliche Anforderung darstellt (BT-Drs. 16/1780 v. 08.06.2006). Ferner hat sich die Bundesregierung im Zusammenhang mit einem gegen die Bundesrepublik Deutschland
- 18 -
geführten Vertragsverletzungsverfahren bei der Umsetzung der Richtlinie 2000/78/EG (Verfahren Nr. 2007/2362) mit ihrer Mitteilung vom 30.05.2008 auch dahingehend geäußert, dass „eine berufliche Anforderung nur dann nach § 9 Absatz 1 AGG gerechtfertigt (sei), wenn sie im konkreten Fall auch wesentlich, rechtmäßig und gerechtfertigt im Sinne von Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie ist“ (Bl. 328 d.A.).
Wenn also angesichts dessen nicht ohnehin davon auszugehen ist, dass § 9 Abs. 1 AGG im Ausnahmefall eine Differenzierung wegen der Religion zulässt, wenn diese eine die „wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche Anforderung“ darstellt, so ist die Regelung im Lichte der Rahmenrichtlinie 2000/76/EG jedenfalls in dieser Weise auszulegen. Damit ist die gesetzliche Bestimmung deutlich enger zu fassen, als es deren Wortlaut zunächst annehmen lässt.
bb) Der Beklagte hat keine Gründe vorgetragen, die die Annahme rechtfertigen, für die zu besetzende Stelle sei die Kirchenmitgliedschaft eine wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche Anforderung.
Nach den allgemeinen Regeln der Darlegungs- und Beweislast ist derjenige darlegungspflichtig, der sich auf die für ihn günstige Rechtsfolge beruft. Da es sich bei der Regelung um eine Ausnahmevorschrift handelt, die im Interesse des Beklagten auch die ungünstigere Behandlung der Klägerin im Vergleich zu ihren Mitbewerbern begründen soll, hat dieser darzulegen, dass ausnahmsweise für die zu besetzende Stelle diese engen Anforderungen erfüllt sind.
Ein solcher Vortrag ist dem Beklagten nicht gelungen. Die ausgeschriebene Referententätigkeit bezieht sich auf eine Angelegenheit, die nicht unmittelbar auf die Vermittlung, Verkündung und praktischen Umsetzung der Religion abzielen. Die Position stellt auch keine Leitungsfunktion innerhalb der Kirche dar. Vielmehr handelt es sich um eine Referentenstelle, die sich zwar mit dem Thema „Antirassismus“ befasst, das auch nach religiösen und diakonischen Wertmaßstäben und dem entsprechenden Menschenbild von nicht unerheblicher Bedeutung ist. Insofern ist die Übereinstimmung mit dem evangelischen Weltbild nützlich. Dies begründet indes noch bei weitem nicht, warum die Religionszugehörigkeit für die Tätigkeit wesentlich und erforderlich ist. Dabei ist ergänzend zu berücksichtigen, dass der Bericht nicht durch die Evangelische Kirche allein verantwortet wird, sondern schon nach der Stellenausschreibung „in Beratung mit Menschenrechtsorganisationen und weiteren Interessenträgern“ zu erstellen ist.
Die Ausführungen des Beklagten zu den wesentlichen Stellenanforderungen erschöpfen sich – losgelöst von der zu erbringenden Tätigkeit – in allgemeinen Programmsätzen und
- 19 -
schlagwortartigen Darstellungen hinsichtlich der Öffentlichkeitswirksamkeit der zu besetzenden Stelle, ohne dies näher auszuführen. Dabei ist nicht ohne Belang, dass sich die Öffentlichkeitsarbeit jedenfalls nicht auf den unmittelbaren sogenannten verkündigungsnahen Bereich. Orientiert man diese Aufgaben an dessen in der Satzung des Beklagten zusammengefassten Zielen, stellt man fest, dass es sich fast ausnahmslos und vorrangig um allgemeingültige humanistische Ziele handelt. Spezielle vorrangig vom Glauben und der Religion geprägte Ziele sind darin ebenso wenig festzustellen wie in der Tätigkeit der ausgeschriebenen Stelle.
6.
Die Klägerin hat daher Anspruch auf eine Entschädigung gem. § 15 Abs. 2 AGG als Ersatz für den immateriellen Schaden, der ihr infolge der Benachteiligung aus Gründen der Religion entstanden ist. Durch die erlittene Diskriminierung der Klägerin wurden ihre allgemeinen Persönlichkeitsrechte verletzt.
a) Tatbestandliche Voraussetzung für den Entschädigungsanspruch ist eine unzulässige Benachteiligung der Klägerin (vgl. BAG v. 07.07.2011, 2 AZR 396/10. NZA 2012, 34, 36), , die hier gegeben ist. Das Vorliegen von Pflichtverletzungen des Beklagten ist für den Anspruch ebenso wenig erforderlich wie ein Verschulden oder eine Kausalität.
b) Bei der Bemessung der Höhe der Entschädigung ist festzustellen, dass § 15 Abs. 2 AGG eine Obergrenze von drei Monatsgehältern statuiert, die nicht überschritten werden darf. Es handelt sich insoweit nicht um eine Regelentschädigung. Vielmehr ist im jeweiligen Einzelfall zu prüfen, wie die erlittene Persönlichkeitsverletzung zu bewerten ist.
An dieser Stelle sei zunächst darauf hingewiesen, dass der Antrag der Klägerin zwar die Festsetzung der Entschädigungshöhe in das richterliche Ermessen stellt, gleichwohl durch Angabe des aus ihrer Sicht mindestens zu beanspruchenden Entschädigungsbetrages in Höhe von genau drei Monatsvergütungen eines vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer mit einer Entgeltgruppe 13 nach dem TVöD in Höhe von derzeit 3.262,89 € dieses Ermessen bereits auf null zu reduzieren gedenkt.
Zudem geht die Kammer davon aus, dass der Entschädigungszahlung auf drei Monatsgehälter der in Aussicht genommenen Stelle zu begrenzen ist, denn § 15 Abs. 2 S. 2 AGG stellt ausdrücklich einen Bezug zu dieser Stelle durch den Hinweis auf die Nichteinstellung her. Es kann nur diese Vergütung gemeint sein, denn der Bezug zu irgendeinem anderen Monatsgehalt fehlt. Anderenfalls wäre es der Fantasie des Stellenbewerbers überlassen, was er als Maßstab für die Entschädigungshöhe heranziehen möchte. Insoweit geht auch der Hinweis der Klägerin fehl, eine auf die Teilzeitvergütung
- 20 -
abgestellte Entschädigungszahlung stelle bereits eine mittelbare Benachteiligung dar, weil die Persönlichkeitsverletzung Teilzeitbeschäftigter nicht weniger Wert sei, als die Vollzeitbeschäftigter. Die Bemessung der Entschädigungshöhe kann als einzig sinnvollen Anknüpfungspunkt nur die in Aussicht genommene Stelle haben, denn anderenfalls müsste man argumentieren, dass auch die Persönlichkeitsverletzung eines Bewerbers auf einer gering dotierten Stelle weniger wert wäre als diejenigen Bewerbers auf eine hochdotierte Stelle. Diesem Dilemma könnte man allenfalls durch einen Festbetrag ausgleichen, dem wiederum eine Reihe anderer Bedenken entgegenstehen werden. Es kann somit nur auf die Monatsvergütung einer mit 60 % Arbeitszeit ausgestalteten Stelle der Entgeltgruppe 13 TVöD abgestellt werden, also einen Betrag in Höhe von 1.957,73 €.
c) Für die Entschädigungsbemessung sind Art, Schwere und Dauer des Verstoßes sowie die Folgen für den Arbeitnehmer (BAG v. 18.03.201, 8 AZR 1044/08, aaO) und das Ausmaß des Verschuldens zu berücksichtigen (BAG v. 22.01.2009, 8 AZR 906/07, NZA 2009, 945-954).
Die Klägerin hat insoweit nicht vorgetragen, insbesondere zu den Folgen des Verstoßes für sie selbst. Geht man indes davon aus, dass der gesetzliche Höchstbetrag in besonders schweren Fällen, etwa einer Diskriminierung aus mehreren Gründen oder wiederholte Diskriminierungen auszusprechen wäre, muss sich die Entschädigung für die Klägerin deutlich darunter einreihen. Hinzu kommt, dass auf Seiten des Beklagten das Ausmaß des Verschuldens eher als gering einzustufen ist. Der Beklagte hat sich bei seiner Ausschreibungspraxis an seine seit Jahrzehnten bestehenden und im Grunde beanstandungsfrei praktizierten Regeln gehalten und ist von einer aus seiner Sicht gesicherten Rechtslage ausgegangen. Die Kammer hält unter Berücksichtigung der gesamtumstände des Einzelfalls die Zahlung einer Entschädigung in Höhe einer Monatsvergütung für geboten aber auch für angemessen.
III.
Die Kostenentscheidung basiert auf §§ 12a Abs. 1, 46 Abs. 2 ArbGG, 91, 92 ZPO. Der Beklagte hat als Unterliegender die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. Zwar ist die Klägerin in der Festsetzung der Höhe der Entschädigung teilweise unterlegen. Da sie jedoch die Bemessung der Höhe in das richterliche Ermessen gestellt hat, ist es gerechtfertigt, Dem Beklagten gem. § 92 Abs. 2 Ziff. 2 ZPO gleichwohl die gesamten Verfahrenskosten aufzuerlegen
Der Streitwert wird gem. §§ 39, 40 GKG, 61 Abs. 1, 46 Abs. 2 ArbGG, §§ 2 ff. ZPO festgesetzt. Er entspricht der Höhe der mindestens geltend gemachten Klageforderung.
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gern:
 |
Dr. Martin Hensche Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hensche@hensche.de |
 |
Christoph Hildebrandt Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hildebrandt@hensche.de |
 |
Nina Wesemann Rechtsanwältin Fachanwältin für Arbeitsrecht Kontakt: 040 / 69 20 68 04 wesemann@hensche.de |