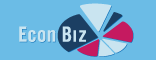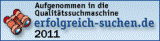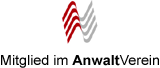- -> zur Mobil-Ansicht
- Arbeitsrecht aktuell
- Tipps und Tricks
- Handbuch Arbeitsrecht
- Gesetze zum Arbeitsrecht
- Urteile zum Arbeitsrecht
- Urteile 2023
- Urteile 2021
- Urteile 2020
- Urteile 2019
- Urteile 2018
- Urteile 2017
- Urteile 2016
- Urteile 2015
- Urteile 2014
- Urteile 2013
- Urteile 2012
- Urteile 2011
- Urteile 2010
- Urteile 2009
- Urteile 2008
- Urteile 2007
- Urteile 2006
- Urteile 2005
- Urteile 2004
- Urteile 2003
- Urteile 2002
- Urteile 2001
- Urteile 2000
- Urteile 1999
- Urteile 1998
- Urteile 1997
- Urteile 1996
- Urteile 1995
- Urteile 1994
- Urteile 1993
- Urteile 1992
- Urteile 1991
- Urteile bis 1990
- Arbeitsrecht Muster
- Videos
- Impressum-Generator
- Webinare zum Arbeitsrecht
-
Kanzlei Berlin
 030 - 26 39 62 0
030 - 26 39 62 0
 berlin@hensche.de
berlin@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Frankfurt
 069 - 71 03 30 04
069 - 71 03 30 04
 frankfurt@hensche.de
frankfurt@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hamburg
 040 - 69 20 68 04
040 - 69 20 68 04
 hamburg@hensche.de
hamburg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hannover
 0511 - 89 97 701
0511 - 89 97 701
 hannover@hensche.de
hannover@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Köln
 0221 - 70 90 718
0221 - 70 90 718
 koeln@hensche.de
koeln@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei München
 089 - 21 56 88 63
089 - 21 56 88 63
 muenchen@hensche.de
muenchen@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Nürnberg
 0911 - 95 33 207
0911 - 95 33 207
 nuernberg@hensche.de
nuernberg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Stuttgart
 0711 - 47 09 710
0711 - 47 09 710
 stuttgart@hensche.de
stuttgart@hensche.de
AnfahrtDetails
LAG Hamm, Urteil vom 27.05.2011, 18 Sa 1587/09
| Schlagworte: | Betriebsübergang | |
| Gericht: | Landesarbeitsgericht Hamm | |
| Aktenzeichen: | 18 Sa 1587/09 | |
| Typ: | Urteil | |
| Entscheidungsdatum: | 27.05.2011 | |
| Leitsätze: | ||
| Vorinstanzen: | Arbeitsgericht Herford, Urteil vom 30.10.2009, 1 Ca 1355/08 | |
18 Sa 1587/09
1 Ca 1355/08 ArbG Herford
Verkündet am 27.05.2011
Hofmann Regierungsbeschäftigte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
Landesarbeitsgericht Hamm
Im Namen des Volkes
Urteil
In Sachen
hat die 18. Kammer des Landesarbeitsgerichts Hamm
auf die mündliche Verhandlung vom 27.05.2011
durch den Vorsitzenden Richter am Landesarbeitsgericht Dr. Jansen
sowie die ehrenamtliche Richterin Jungebloth-König
und den ehrenamtlichen Richter Schumann
für Recht erkannt:
Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Arbeitsgerichts Herford vom 30.10.2009 (1 Ca 1355/09) abgeändert.
Die Klage wird abgewiesen.
Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin.
Die Revision wird zugelassen.
- 2 -
Tatbestand
Die Parteien streiten über Entgeltansprüche aus übergegangenem Recht und über den Zeitpunkt eines Betriebsübergangs.
Im Jahr 1976 wurde die U1 + V1 Metallbaugesellschaft mbH gegründet. Das Unternehmen war mit der Herstellung und dem Vertrieb von Draht- und Metallwaren befasst. Die Firma wurde später geändert in U2 Metallbau GmbH. Über das Vermögen dieser Gesellschaft wurde im September 2007 das Insolvenzverfahren eröffnet. Die klagende Bundesagentur zahlte an 29 Arbeitnehmer dieser Gesellschaft Insolvenzgeld und macht die insoweit übergegangenen Entgeltansprüche gegen die Beklagte geltend; die Klägerin beruft sich auf einen Betriebsübergang und eine Firmenübernahme.
Bis März 2007 waren Gesellschafter der U1 + V1 Metallbaugesellschaft mbH Frau H1 W1, Herr P1 W1 sowie Herr H2 V1; Geschäftsführer der Gesellschaft waren die Herren P1 W1 und H2 V1. Die Gesellschaft war Mieterin eines Grundstücks in B1. Vermieter und Eigentümer des Grundstücks waren die Gesellschafter. Mit Kaufvertrag vom 28.12.2006 veräußerte die U1 + V1 Metallbaugesellschaft mbH ihr bewegliches Sachanlagevermögen zusammen mit den immateriellen Vermögensgegenständen an die Grundstücksgemeinschaft bestehend aus den Gesellschaftern und mietete diese Gegenstände ab Januar 2007 an.
Durch notarielle Gesellschaftsverträge vom 26.01.2007 gründeten die Gesellschafter der U1 + V1 Metallbaugesellschaft mbH die U3 Immobilien GmbH & Co. KG und die Beklagte. Als Notar war der Prozessbevollmächtigte der Beklagten tätig. Geschäftsführer der Beklagten sind Herr P1 W1 und Herr H2 V1.
Ende Januar 2007 brachten die Gesellschafter das Betriebsgrundstück in B1 in die U3 Immobilien GmbH & Co. KG ein. Der Mietvertrag, der zwischen der U3
- 3 -
Immobilien GmbH & Co. KG und der U1 + V1 Metallbaugesellschaft mbH abgeschlossen wurde, ist im Laufe des Jahres 2007 mit der Beklagten fortgesetzt worden.
Durch notarielle Verträge vom 15.03.2007 übertrugen die Gesellschafter der U1 + V1 Metallbaugesellschaft mbH die von ihnen gehaltenen Geschäftsanteile an die C1-T1 C2 GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Herrn S2 S3. Als Notar war wiederum der Prozessbevollmächtigte der Beklagten tätig. Die Herren V1 und W1 wurden als Geschäftsführer abberufen; zum alleinigen neuen Geschäftsführer wurde Herr S3 bestellt. Im Zuge der Übertragung der Geschäftsanteile wurde die Firma der Gesellschaft geändert in U2 Metallbau GmbH.
Unter dem 19.03.2007 schloss die U2 Metallbau GmbH einen Alleinvertriebs- und Kooperationsvertrag mit der Beklagten (Ablichtung Blatt 246 ff. der Akten). In diesem Vertrag war unter anderem geregelt, dass die U2 Metallbau GmbH den Vertrieb von ihr hergestellter oder vertriebener Vertragsprodukte für Gesamteuropa an die Beklagte überträgt und sich verpflichtet, in das Vertragsgebiet keine direkte Lieferungen an Abnehmer und Kunden vorzunehmen.
Ab März 2007 zahlte die U2 Metallbau GmbH keine Löhne und Gehälter an ihre Arbeitnehmer mehr. Der Geschäftsführer stellte am 29.05.2007 den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Mit amtsgerichtlichem Beschluss vom 30.05.2007 wurden vorläufige Sicherungsmaßnahmen angeordnet.
Am 31.05.2007 fand eine Versammlung der Arbeitnehmer statt, die bei der U2 Metallbau GmbH beschäftigt waren. An dieser Versammlung nahm auch der Prozessbevollmächtigte der Beklagten als damaliger Rechtsberater der U2 Metallbau GmbH teil. Der Geschäftsführer, Herr S3, und der Prozessbevollmächtigte der Beklagten erläuterten die arbeits- und insolvenzrechtliche Situation. Im Schreiben des Prozessbevollmächtigten des Beklagten vom 31.05.2007 (Ablichtung Blatt 242 f. der Akten), das den Arbeitnehmern überreicht wurde, heißt es unter anderem:
"...
- 4 -
Sehr geehrte Damen und Herren,
unter Bezugnahme auf die durchgeführte Belegschaftsversammlung möchte der Unterzeichner Ihnen nochmals zusammengefasst die Sach- und Rechtslage des Arbeitnehmers im Insolvenzverfahren zusammenfassen:
1. Das Arbeitsverhältnis bleibt in seinem Bestand grundsätzlich durch einen Insolvenzantrag zunächst unberührt. Der Arbeitnehmer bleibt weiterhin im bestehenden Arbeitsverhältnis. Insbesondere ist der Arbeitgeber wegen Insolvenz nicht berechtigt, das Arbeitsverhältnis fristlos zu kündigen.
( . . . )
4. Der Arbeitnehmer ist im Insolvenzfall, wenn mehr als ein Monatslohn rückständig ist, berechtigt, das Arbeitsverhältnis von sich aus fristlos zu kündigen. Zuvor hat er den Arbeitgeber wegen des Lohnrückstandes unter Fristsetzung abzumahnen. Die fristlose Kündigung führt in diesem Fall nicht zur Verhängung einer Sperrfrist beim Arbeitslosengeld, da es keinem Arbeitnehmer zumutbar ist, ohne Lohn seine Arbeitskraft weiter zur Verfügung zu stellen. Zweckmäßigerweise ist die fristlose Kündigung schriftlich zu erklären unter Hinweis auf vorgenannte Voraussetzungen.
5. Jeder Arbeitnehmer ist in seiner Entscheidung frei, ob er sich vom Arbeitgeber freistellen bzw. kündigen lässt oder selbst kündigt. Eine Pflicht zur Eigenkündigung besteht nicht. Nachteilige Rechtsfolge der Eigenkündigung ist, dass Ansprüche aus Betriebsübergang gemäß § 613a BGB verlustig gehen.
6. Vom Insolvenzstichtag (Tag der Insolvenzeröffnung oder Beschlusstag des Gerichtes über die Nichteröffnung mangels Masse) bis zu drei Monaten rückwärts ist der volle Arbeitsentgeltanspruch des Arbeitnehmers über Insolvenzgeld abgesichert. Als Insolvenzgeld wird von der zuständigen Stelle des Arbeitsamtes der Betriebsstätte gezahlt. Notwendig ist die Stellung eines Antrages durch den Arbeitnehmer innerhalb von zwei Monaten nach Insolvenzstichtag. Bei Fristversäumung ist der Anspruch ausgeschlossen und kann nur bei begründeter Verhinderung oder Unkenntnis vom Insolvenzverfahren nachgeholt werden.
7. Der vorgenannte Dreimonatslohnabsicherungszeitraum läuft bei einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses vor Insolvenzstichtag (Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerkündigung) von diesem Tag an bis zu drei Monate rückwärts. Insoweit ist der Arbeitnehmer in der Lage, über seine Eigenkündigung vorgenannten Lohnabsicherungszeitraum auf drei Monate zu fixieren, wenn innerhalb der Dreimonatsfrist der Insolvenzstichtag nicht vorliegt.
( . . . )"
- 5 -
Die Arbeitnehmer der U2 Metallbau GmbH unterzeichneten am 31.05.2007 fristlose Kündigungserklärungen, die vom Prozessbevollmächtigten der Beklagten vorformuliert waren.
Die Beklagte beschäftigte 18 Arbeitnehmer der U2 Metallbau GmbH weiter. Drei dieser Arbeitnehmer wurden am 04.06.2007 bei der BEK D2 neu angemeldet; weitere Arbeitnehmer wurden bis zum 18.06.2007 bei der AOK H3 neu angemeldet. Im Laufe des Monats Juni 2007 nahm die Beklagte die Produktion von Draht- und Metallwaren in der Produktionsstätte der U2 Metallbau GmbH auf.
Durch gerichtlichen Beschluss vom 17.09.2007 wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen der U2 Metallbau GmbH (nachfolgend: Insolvenzschuldnerin) eröffnet. Die Klägerin zahlte an 29 Arbeitnehmer im Zeitraum vom 01.03.2007 bis zum 31.05.2007 Insolvenzgeld in Höhe von insgesamt 75.944,45 €. Insoweit wird auf die Aufstellung Bezug genommen, die die Klägerin als Anlage K2 mit der Klageschrift zu den Gerichtsakten gereicht hat (Blatt 30 der Akten). Mit Schreiben vom 21.10.2008 forderte die Klägerin die Beklagte zur Zahlung dieses Betrages unter Fristsetzung zum 10.11.2008 auf. Mit anwaltlichem Schreiben vom 04.11.2008 wies die Beklagte die Forderung zurück. Mit der Klage verfolgt die Klägerin ihre Ansprüche weiter.
Der Prozessbevollmächtigte der Beklagten war auch in anderen Fällen als Berater beteiligt, in denen in ähnlicher Weise verfahren wurde (Übertragung der Vermögensaktiva der notleidenden Gesellschaft, Abschluss eines Vertriebs- und Kooperationsvertrages, Erklärung fristloser Eigenkündigungen aller Mitarbeiter nach Ablauf des Insolvenzgeldzeitraums, spätere Neueinstellung von Mitarbeitern und Fortführung des Betriebes). Die Versuche der Klägerin, in diesen Fällen Ansprüche auf Entgeltzahlung aus übergegangenem Recht gerichtlich einzufordern, sind bislang vor dem Berufungsgericht erfolglos geblieben.
Die Klägerin hat die Auffassung vertreten, die Entgeltansprüche der Arbeitnehmer, denen Insolvenzgeld gewährt wurde, seien in Höhe der Insolvenzgeldzahlung auf die Klägerin übergegangen. Die Beklagte sei aufgrund eines Betriebsübergangs in die Rechte und Pflichten aus den Arbeitsverhältnissen eingetreten und hafte für die
- 6 -
übergegangenen Entgeltansprüche, da sie sämtliche materiellen Betriebsmittel der Insolvenzschuldnerin übernommen habe und in den gleichen Vertriebsräumen die gleichen Tätigkeiten verrichte; sie habe zudem die Kundschaft und die Mitarbeiter der Insolvenzschuldnerin übernommen. Die Klägerin hat behauptet, die Arbeitnehmer seien bereits ab dem 19.03.2007, also bereits vor Ausspruch der Eigenkündigungen, für die Beklagte tätig geworden. Die Klägerin hat überdies die Ansicht vertreten, die Eigenkündigungen seien als Umgehungsgeschäfte nichtig. Die Beklagte habe von vornherein eine nahtlose Fortsetzung der Geschäftstätigkeit der Insolvenzschuldnerin geplant, daher habe festgestanden, dass die Arbeitnehmer von ihr übernommen werden würden. Die Tatsache, dass es zu dieser Übernahme der Arbeitsverhältnisse auch tatsächlich gekommen sei, lasse keinen anderen Schluss zu, als dass die Arbeitnehmer bereits Wiedereinstellungszusagen hatten. Die Kündigungen seien nicht zur Sicherung der Insolvenzgeldansprüche erklärt worden. Die Buchhalterin M2 S4 sowie die Bürokräfte B2 V1 und U4 W1 hätten eine Kündigung ausgesprochen, obgleich kein Lohnrückstand bestanden habe.
Die Klägerin hat beantragt,
die Beklagte zu verurteilen, 75.944,45 € nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 08.11.2008 an die Klägerin zu zahlen.
Die Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen.
Die Beklagte hat die Auffassung vertreten, ein Betriebsübergang hinsichtlich der Produktion der Insolvenzschuldnerin habe vor dem Zeitpunkt des Ausspruchs der Eigenkündigungen nicht vorgelegen. Hierzu hat die Beklagte vorgetragen, zwischen der Beklagten und der Insolvenzschuldnerin hätten lediglich liefervertragliche Vereinbarungen bestanden. Die Beklagte habe bis Ende Mai 2007 keine eigene Produktion von Metallwaren betrieben, sondern ihre Geschäftstätigkeit ausschließlich als Handelsunternehmen ausgeübt. Erst im Verlauf des Juni 2007, nachdem die Insolvenzschuldnerin wegen Kündigung der Arbeitnehmer als Lieferantin nicht mehr
- 7 -
zur Verfügung gestanden habe, habe sich die Beklagte entschlossen, eine Produktion aufzunehmen, um gegenüber ihren Kunden und Auftraggebern nicht in Verzug zu geraten. Zu diesem Zeitpunkt seien die Arbeitsverhältnisse der bei der Insolvenzschuldnerin beschäftigten Arbeitnehmer aufgrund der Eigenkündigungen allerdings bereits beendet gewesen. Die Eigenkündigungen seien auch nicht als Umgehungsgeschäfte anzusehen. Die Beklagte habe keine Zusagen auf einen neuen Arbeitsplatz unterbreitet. Auf die Arbeitnehmer sei kein Druck ausgeübt worden. Der Geschäftsführer der Insolvenzschuldnerin habe sie ausdrücklich darüber informiert, dass eine Verpflichtung zur Eigenkündigung nicht bestehe und ein neuer Arbeitsplatz bei der Beklagten nicht zugesichert werden könne. Die Arbeitnehmer hätten die Eigenkündigungen zur Absicherung des Anspruchs auf Insolvenzgeld ausgesprochen.
Mit dem Urteil vom 30.10.2009 hat das Arbeitsgericht der Klage stattgegeben und zur Begründung im Wesentlichen ausgeführt, es liege ein Betriebsübergang vor. Die Beklagte habe die Leitung der Produktion schon vor dem 29.05.2007 von der Insolvenzschuldnerin übernommen. Zunächst sei vor dem Hintergrund des Kooperationsvertrages der Vertrieb der Insolvenzschuldnerin als wirtschaftliches und finanzielles Herzstück des Betriebes übertragen worden; auch hinsichtlich der Produktion habe die Beklagte in Erwartung der Insolvenz nach und nach die Leitung übernommen. Aufgrund einer abgestuften Darlegungs- und Beweislast reiche es nicht aus, wenn die Beklagte dazu lediglich vortrage, die Entscheidung zur Übernahme der Produktion sei erst ab Juni 2007 getroffen worden, ohne genaue Zeitpunkte entsprechender Entscheidungen zu nennen und zu dokumentieren. Im Übrigen wird auf den Tatbestand und die Entscheidungsgründe des erstinstanzlichen Urteils Bezug genommen.
Das Urteil erster Instanz ist der Beklagten am 25.11.2009 zugestellt worden. Mit einem Schriftsatz, der am 17.12.2009 beim Landesarbeitsgericht eingegangen ist, hat die Beklagte Berufung eingelegt und die Berufung mit einem am 24.02.2010 beim Landesarbeitsgericht eingegangenem Schriftsatz begründet, nachdem die Berufungsbegründungsfrist durch gerichtlichen Beschluss bis zum 25.02.2010 verlängert worden war.
- 8 -
Die Beklagte meint, es liege keine Übernahme eines Betriebes unter Wahrung der Identität der wirtschaftlichen Einheit vor. Bei der Insolvenzschuldnerin habe es sich um einen Produktionsbetrieb für Metallteile gehandelt, bei der Beklagten hingegen um ein reines Vertriebs- und Handelsunternehmen. Der zwischen den Parteien abgeschlossene Alleinvertriebs- und Kooperationsvertrag vom 19.03.2007 grenze die unterschiedlichen Betriebszwecke ab. Die Beklagte trägt vor, sie habe weder Räumlichkeiten noch das Anlagevermögen der Insolvenzschuldnerin erworben, gemietet oder faktisch genutzt. Die Insolvenzschuldnerin sei bis zum 31.05.2007 Mieterin und Nutzerin der Räumlichkeiten und der Produktionsmittel gewesen. Die Beklagte habe lediglich einen Büroraum in dem Gebäudekomplex genutzt, von wo aus sie ihre Vertriebs- und Handelstätigkeit ausgeübt habe. Die Beklagte habe der Insolvenzschuldnerin Aufträge erteilt, die von der Insolvenzschuldnerin produziert und der Beklagten berechnet worden seien. Die Insolvenzschuldnerin sei von Herrn S3 als Geschäftsführer verantwortlich geführt worden, die Beklagte vom Geschäftsführer P1 W1. Eine Übernahme und Fortführung der Produktion habe erst im Verlauf des Juni 2007 stattfinden können, da per Ende Mai 2007 die Finanzierung für eine Aufnahme der Produktion durch die Beklagte in keiner Weise gewährleistet und sichergestellt gewesen sei. Die Beklagte habe im Laufe des Monats Juni 2007 sukzessive 18 von 29 Arbeitnehmern der Insolvenzschuldnerin neu eingestellt. Die Mitarbeiter seien vor Ausspruch der Eigenkündigungen korrekt, objektiv und ausführlich auf die rechtlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen, Folgen und Möglichkeiten der Beschäftigungsverhältnisse in einem insolventen Unternehmen informiert worden; sie hätten keinen Hinweis auf die Möglichkeit erhalten, bei der Beklagten einen neuen Arbeitsplatz zu finden.
Die Beklagte beantragt,
unter Abänderung des Urteils des Arbeitsgerichts Herford vom 30.10.2009 zu Aktenzeichen 1 Ca 1355/08 die Klage abzuweisen.
Die Klägerin beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
- 9 -
Die Klägerin verteidigt das erstinstanzliche Urteil als zutreffend. Das Arbeitsgericht sei zu Recht davon ausgegangen, dass wegen der nahtlosen Fortführung der Produktion nach Insolvenzeröffnung zu vermuten sei, die Beklagte habe nicht nur hinsichtlich des Vertriebs, sondern auch hinsichtlich der Produktion schon in Erwartung der Insolvenz nach und nach die Leitung übernommen. Wegen der größeren Sachnähe der Beklagten bestehe insoweit eine abgestufte und Darlegungs- und Beweislast. Die Klägerin trägt vor, die Insolvenzschuldnerin habe nach Abschluss des Kooperationsvertrages im März 2007 keine eigenen Kunden mehr beliefert. Die Leitungsmacht über die Produktion sei von den Gesellschaftern/Geschäftsführern der Beklagten ausgeübt worden. Herr S3 sei Unternehmensberater und daher branchenfremd; allein die Geschäftsführer der Beklagten verfügten über das für die Produktion notwendige Knowhow. Die Beklagte habe als einziger Kunde der Insolvenzschuldnerin alle Bedingungen der Zusammenarbeit diktieren können und habe de facto das unternehmerische Schicksal der Schuldnerin in der Hand gehabt. Zur Erfüllung der vertrieblichen Tätigkeit habe die Beklagte kein eigenes Personal eingestellt, sondern sich seit dem 19.03.2007 des Personals der Insolvenzschuldnerin bedient, namentlich der Mitarbeiterinnen M2 S4, B2 V1 und U4 W1. Deren Arbeitsverhältnisse seien mit Abschluss des Alleinvertriebs- und Kooperationsvertrages ohne weiteres auf die Beklagte übergegangen. Eine Gesamtschau aller Umstände mache deutlich, dass hier mit allen Mittel versucht worden sei, das Szenario eines Betriebsübergangs zu verschleiern. Die Beklagte habe im Zusammenhang mit den massenhaften Eigenkündigungen aller Mitarbeiter keinen nachvollziehbaren Sachvortrag geliefert und nicht erklärt, warum auch solche Mitarbeiter eine Kündigung aussprachen, deren Entgelt nur zu einem geringen Teil rückständig gewesen sei. Für einen Umgehungstatbestand reiche aus, dass eine Vorgehensweise festgestellt werde, deren objektive Zielsetzung in der Beseitigung der Kontinuität des Arbeitsverhältnisses bei gleichzeitigem Erhalt des Arbeitsplatzes bestehe. Davon sei im Streitfall auszugehen, da die Eigenkündigungen durch die Beklagte initiiert und vorformuliert worden seien. Die Klägerin vertritt zudem die Auffassung, die Beklagte habe die Firma der Schuldnerin weitergeführt. Die Firmierung sei in ihrem prägenden Teil beibehalten worden. Gerade die Buchstabenkombination - zumal die ersten Buchstaben - prägten die Unterscheidungskraft des Unternehmens.
- 10 -
Im Übrigen wird zur näheren Darstellung des Sach- und Streitstandes auf die beiderseitigen Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.
Entscheidungsgründe
I. Die Berufung ist zulässig.
Sie ist insbesondere form- und fristgerecht gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 und 2 ArbGG eingelegt und begründet worden.
II. Die Berufung hat in der Sache Erfolg.
Das arbeitsgerichtliche Urteil war abzuändern. Der Klägerin steht kein Anspruch auf die begehrte Zahlung zu.
1. Der Klägerin steht kein Anspruch auf die begehrte Zahlung aus §§ 611 Abs. 1, 613a Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit §§ 185 Abs. 1, 187 Satz 1 SGB III zu.
Die Beklagte haftet nicht als Betriebsübernehmerin für Ansprüche auf Arbeitsentgelt, die auf die Klägerin gemäß § 187 Satz 1 SGB III übergegangen sind. Die Arbeitsverhältnisse der Arbeitnehmer, die Insolvenzgeld beantragten und erhielten, sind nicht gemäß § 613a Abs. 1 Satz 1 BGB auf die Beklagte übergegangen.
Der Betriebsübernehmer tritt nur in die Rechte und Pflichten aus den Arbeitsverhältnissen ein, die im Zeitpunkt des Übergangs (noch) bestehen. Die Arbeitsverhältnisse der Arbeitnehmer, denen die Klägerin Insolvenzgeldzahlungen gewährte, sind nicht vor dem 31.05.2007 infolge einer Betriebsübernahme auf die Beklagte übergegangen (dazu nachfolgend unter a); die Arbeitsverhältnisse endeten vielmehr aufgrund rechtswirksamer Eigenkündigungen der Arbeitnehmer zum 31.05.2007 (dazu nachfolgend unter b). Ein Betriebsübergang, der später stattfand, löst nicht die Rechtsfolgen des § 613a Abs. 1 Satz 1 BGB aus.
- 11 -
a) Vor dem 31.05.2007 fand kein Betriebsübergang gemäß § 613a Abs. 1 Satz 1 BGB von der Insolvenzschuldnerin auf die Beklagte statt.
aa) Es lässt sich nicht feststellen, dass vor dem 31.05.2007 der gesamte Betrieb der Insolvenzschuldnerin auf die Beklagte überging.
§ 613a Abs. 1 Satz 1 BGB setzt den rechtsgeschäftlichen Übergang eines Betriebs oder Betriebsteiles auf einen anderen Inhaber voraus. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (vgl. jüngst BAG, Urteil vom 28.04.2011 - 8 AZR 709/09; Preis, in: Erfurter Kommentar, 11. Auflage 2011, § 613a BGB Rn. 12 ff. m. w. N.) gelten insoweit folgende Grundsätze: Erforderlich ist die Wahrung der Identität der betreffenden wirtschaftlichen Einheit. Der Begriff wirtschaftliche Einheit bezieht sich auf eine organisatorische Gesamtheit von Personen und/oder Sachen zur auf Dauer angelegten Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit mit eigener Zielsetzung. Bei der Prüfung, ob eine solche Einheit übergegangen ist, müssen sämtliche, den betreffenden Vorgang kennzeichnenden Tatsachen berücksichtigt werden. Dazu gehören als Teilaspekte der Gesamtwürdigung namentlich die Art des betreffenden Unternehmens oder Betriebs, der etwaige Übergang der materiellen Betriebsmittel wie Gebäude oder bewegliche Güter, der Wert der immateriellen Aktiva im Zeitpunkt des Übergangs, die etwaige Übernahme der Hauptbelegschaft, der etwaige Übergang der Kundschaft sowie der Grad der Ähnlichkeit zwischen den vor und nach dem Übergang verrichteten Tätigkeit und die Dauer einer eventuellen Unterbrechung dieser Tätigkeit. Die Identität der Einheit kann sich auch aus anderen Merkmalen ergeben, wie zum Beispiel ihrem Personal, ihren Führungskräften, ihrer Arbeitsorganisation, ihren Betriebsmethoden oder den ihr zur Verfügung stehenden Betriebsmitteln. Den Kriterien, die für das vorliegen eines Übergangs maßgeblich sind, kommt je nach der ausgeübten Tätigkeit und je nach den Produktions- und Betriebsmethoden unterschiedliches Gewicht zu.
Nach diesen Grundsätzen, denen die Berufungskammer folgt, mag ein Betriebsübergang im Juni 2007 - nach Beendigung der Arbeitsverhältnisse zwischen der Insolvenzschuldnerin und ihren Mitarbeitern - stattgefunden haben. Es lässt sich indes nicht feststellen, dass ein Betriebsübergang bis zum 31.05.2007 stattfand.
- 12 -
(1) Der Betriebsübergang tritt mit dem Wechsel in der Person des Inhabers des Betriebs ein.
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG, Urteil vom 30.01.2008 - 8 AZR 2/07; Urteil vom 15.12.2005 - 8 AZR 202/05; Preis, in: Erfurter Kommentar, § 613a BGB Rn. 43, 50 m. w. N.) ist der Wechsel der Rechtspersönlichkeit maßgeblich: der bisherige Inhaber muss seine wirtschaftliche Betätigung in dem Betrieb oder Betriebsteil einstellen; der Übernehmer muss die Geschäftstätigkeit tatsächlich weiterführen oder wieder aufnehmen. Der Wechsel der Inhaberschaft tritt nicht ein, wenn der neue „Inhaber" den Betrieb nicht führt. Maßgeblich ist die Weiterführung der Geschäftstätigkeit durch diejenige Person, die nunmehr für den Betrieb als Inhaber verantwortlich ist. Verantwortlich ist die Person, die den Betrieb im eigenen Namen führt und nach außen als Betriebsinhaber auftritt. Es kommt nicht allein darauf an, wer im Verhältnis zur Belegschaft als Inhaber auftritt, sondern auf die umfassende Nutzung des Betriebs nach außen.
(2) Im Streitfall trat hinsichtlich des Betriebes der Insolvenzschuldnerin vor dem 31.05.2007 kein Wechsel in der Person des Betriebsinhabers ein.
Die Beklagte übte die tatsächliche Leitungsmacht nicht aus. Die Leitungsmacht wurde vielmehr durch die Geschäftsführer der Insolvenzschuldnerin - zuletzt durch den Geschäftsführer S3 - ausgeübt.
Der Betrieb wurde von der Insolvenzschuldnerin bis zum 31.05.2007 im eigenen Namen geführt. Nach außen trat Herr S3 als Geschäftsführer für die Insolvenzschuldnerin auf. Herr S3 unterzeichnete den Kooperationsvertrag vom 19.03.2007 und stellte den Insolvenzantrag für die Schuldnerin. Dass die Insolvenzschuldnerin vor dem 31.05.2007 die wirtschaftliche Betätigung im Betrieb einstellte, lässt sich nicht feststellen. Die Produktion wurde bis dahin fortgeführt. Die Insolvenzschuldnerin kooperierte mit der Beklagten auf Basis des Vertrages vom 19.03.2007.
Aus dem Kooperationsvertrag ergibt sich gerade nicht, dass die Insolvenzschuldnerin ihre wirtschaftliche Tätigkeit einstellen und die Beklagte nach außen hin als
- 13 -
Betriebsinhaberin auftreten soll. Unter § 1 Nr. 4 des Vertrages, dass die Beklagte die Vertragsprodukte erwirbt, sie im eigenen Namen vertreibt und zur rechtsgeschäftlichen Vertretung der Insolvenzschuldnerin nicht berechtigt ist. Die Beklagte besaß bis zum 31.05.2007 auch keine Verfügungsbefugnis über die sächlichen Betriebsmittel der Insolvenzschuldnerin. Vielmehr war die Insolvenzschuldnerin Mieterin der Betriebsräumlichkeiten. Sie hatte einen Mietvertrag mit der U3 Immobilien GmbH & Co. KG geschlossen.
Es kommt demgegenüber nicht darauf an, ob die Insolvenzschuldnerin sich im Zeitraum vor dem 31.05.2007, insbesondere nach Abschluss des Kooperationsvertrages vom 19.03.2007, in wirtschaftlicher Abhängigkeit von der Beklagten befand (worauf die Gewährung des Alleinvertriebsrechts unter § 1 Nr. 1 und das zugunsten der Beklagten bestehende Bestimmungsrecht hinsichtlich der Aufnahme neuer Vertragsprodukte und anderer Vorlieferanten unter § 3 Nr. 1 letzter Satz des Kooperationsvertrages hindeuten mögen). Für das Vorliegen eines Betriebsübergangs ist es unmaßgeblich, wer wirtschaftlich die Geschicke des Betriebes bestimmt (BAG, Urteil vom 15.12.2005 - 8 AZR 202/05). Wirtschaftliche Abhängigkeiten können auch zwischen selbständig geführten Unternehmen bestehen.
Unerheblich ist auch, ob der Geschäftsführer der Insolvenzschuldnerin, Herr S3, den Arbeitnehmern Weisungen erteilte oder ob Weisungen durch die vormaligen Geschäftsführer der Insolvenzschuldnerin und jetzigen Geschäftsführer der Beklagten, die Herren V1 und W1, erteilt worden sind. Ebenso, wie es für die Betriebsinhaberschaft nicht auf wirtschaftliche Leitung des Betriebes ankommt, Für die Frage der Betriebsinhaberschaft ist es nicht von Belang, welche Person den Arbeitnehmern Weisungen erteilt. Das Direktionsrecht gegenüber Arbeitnehmern muss nicht durch den Betriebsinhaber selbst ausgeübt werden (BAG, Urteil vom 15.12.2005 - 8 AZR 202/05; Urteil vom 20.03.2003 - 8 AZR 312/02). In größeren Betrieben wäre dies praktisch gar nicht möglich.
(3) Aus der Gesamtschau der vorliegenden Umstände lässt sich auch nicht eine - gegebenenfalls von der Beklagten zu widerlegende - Vermutung aufstellen, es habe vor dem 31.05.2007 ein Betriebsübergang stattgefunden.
- 14 -
Die Beklagte trägt die Darlegungslast für die Umstände, aus denen sich ein Betriebsübergang ergibt. Nach allgemeinen Grundsätzen muss derjenige, der eine günstige Rechtsfolge für sich in Anspruch nimmt, darlegen und beweisen, dass die Voraussetzungen dieser Rechtsfolge vorliegen; die Darlegungslast trifft also denjenigen, der sich auf den Betriebsübergang beruft (BAG, Urteil vom 20.03.2003 - 8 AZR 312/02; Pfeiffer, in: KR, 9. Auflage 2010, § 613a BGB Rn. 99 bis 100). In Betracht kommt eine Erleichterung durch die Berufung auf Indizien oder nach dem Beweis des ersten Anscheins (Preis, in: Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, § 613a BGB Rn. 177). Es reicht aus, wenn Tatsachen vorgetragen werden, aus deren Gesamtheit geschlossen werden kann, dass der Erwerber den Betrieb mit den übernommenen Mitteln fortsetzt (Pfeiffer in KR, § 613a BGB Rn. 99 bis 100).
Aus dem Vorbringen der Beklagten ergeben sich keine Tatsachen, die diesen Schluss rechtfertigen. Insbesondere lässt sich aus dem Umstand, dass die Beklagte im Juni 2007 den Produktionsbetrieb der Schuldnerin fortführte, nicht der Schluss ziehen, dass ein Betriebsübergang bereits vor dem 31.05.2007 stattfand. Die Abfolge der Ereignisse mag den Schluss darauf zulassen, dass ein Betriebsübergang schon geraume Zeit vor Juni 2007 geplant war. Es fehlt aber an Anhaltspunkten dafür, dass die Betriebsinhaberschaft schon vorher wechselte und die Beklagte nach außen hin als Betriebsinhaberin auftrat.
bb) Es lässt sich auch nicht feststellen, dass der Betriebsteil „Vertrieb" vor dem 31.05.2007 von der Insolvenzschuldnerin auf die Beklagte überging.
(1) Der Übergang eines Betriebsteils steht für dessen Arbeitnehmer dem Betriebsübergang gleich.
Insoweit gilt nach ständiger Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (vgl. BAG, Urteil vom 27.01.2011 - 8 AZR 326/09; Urteil vom 04.05.2006 - 8 AZR 299/05; Urteil vom 08.08.2002 - 8 AZR 583/01; Urteil vom 26.08.1999 - 8 AZR 718/98) Folgendes: Auch bei dem Erwerb eines Betriebsteils ist es erforderlich, dass die wirtschaftliche Einheit ihre Identität bewahrt. Betriebsteile sind Teileinheiten des Betriebes. Es muss sich um eine selbständige, abtrennbare organisatorische Einheit handeln, die
- 15 -
innerhalb des betrieblichen Gesamtzwecks einen Teilzweck erfüllt. Die Teileinheit des Betriebs muss auch beim früheren Betriebsinhaber die Qualität eines Betriebsteils gehabt haben. Ergibt die Gesamtbetrachtung eine identifizierbare wirtschaftliche und organisatorische Teileinheit, so muss diese beim Erwerber im Wesentlichen unverändert fortbestehen.
(2) Nach diesen Grundsätzen, denen sich die Berufungskammer anschließt, ist nicht vom Übergang eines Betriebsteils auszugehen.
Es ist nicht ersichtlich, inwiefern der „Vertrieb" eine selbständig abtrennbare organisatorische Einheit im Rahmen des Betriebs der Insolvenzschuldnerin darstellte. Ebenso wenig ist ersichtlich, inwiefern diese selbständige Einheit bei der Beklagten im Wesentlichen unverändert nach Abschluss des Kooperationsvertrages vom 19.03.2007 fortbestand. Aus dem Vorbringen der Parteien geht nicht hervor, welche Arbeitsorganisation hinsichtlich der zu erledigenden Vertriebsaufgaben bei der Insolvenzschuldnerin und der Beklagten bestand.
Es ist nicht erkennbar, welche Arbeitsverhältnisse infolge eines Übergangs des Betriebsteils „Vertrieb" auf die Beklagte übergegangen sein könnten. Denn im Falle eines Betriebsteilsübergangs gehen nur die Arbeitsverhältnisse der Arbeitnehmer des Betriebsteils auf den Betriebserwerber über (Preis, in: Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, § 613a BGB, Rn. 9 m. w. N.). Erforderlich ist, dass der Arbeitnehmer dem übertragenen Betriebsteils zuzuordnen ist; hierfür reicht es nicht aus, dass der Arbeitnehmer (auch) für den Betriebsteil Tätigkeiten erbrachte (BAG, Urteil vom 08.08.2002 - 8 AZR 583/01 m. w. N.). Entscheidend ist, wo sich der Schwerpunkt des Arbeitsverhältnisses befindet (Pfeiffer, in: KR, § 613a BGB Rn. 105 m. w. N.). Im Streitfall ist nicht ersichtlich, dass Arbeitnehmer schwerpunktmäßig im Vertriebsbereich tätig waren. Im Hinblick auf die drei von der Klägerin genannten Arbeitnehmer fehlt es an Angaben dazu, welche Arbeitsaufgaben sie hauptsächlich versahen. Die Klägerin selbst trägt nicht vor, dass es sich schwerpunktmäßig um Vertriebsaufgaben handelt. Sie behauptet lediglich, dass sich die Beklagte dieser Arbeitnehmerin zur Erfüllung der betrieblichen Tätigkeit bedient habe. Erstinstanzlich hat die Klägerin vorgebracht, diese Arbeitnehmerinnen seien nicht dem
- 16 -
Produktionsbereich zuzuordnen, sondern seien als Bürokräfte (Frau V1 und Frau W1) bzw. als Buchhalterin (Frau S4) eingesetzt gewesen.
b) Die fristlosen Kündigungen, die die Arbeitnehmer der Insolvenzschuldnerin am 31.05.2007 aussprachen, sind wirksam.
aa) Die Kündigungen sind nicht gemäß § 134 BGB wegen Umgehung des § 613a BGB nichtig.
Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG, Urteil vom 21.05.2008 - 8 AZR 481/07; Urteil vom 23.11.2006 - 8 AZR 349/06; Urteil vom 18.08.2005 - 8 AZR 523/04; Urteil vom 10.12.1998 - 8 AZR 324/97; Urteil vom 28.04.1987 - 3 AZR 75/86) sind Rechtsgeschäfte, deren objektive Zielsetzung in der Beseitigung der Kontinuität des Arbeitsverhältnisses bei gleichzeitigem Erhalt des Arbeitsplatzes besteht, wegen Umgehung des § 613a BGB nichtig. Ein Umgehungsgeschäft liegt insbesondere dann vor, wenn zugleich ein Arbeitsverhältnis mit dem Betriebserwerber vereinbart oder verbindlich in Aussicht gestellt wird. Das ist auch dann anzunehmen, wenn die Arbeitnehmer mit dem Hinweis auf eine geplante Betriebsveräußerung und bestehende Arbeitsplatzangebote des Betriebserwerbers veranlasst werden, ihre Arbeitsverhältnisse mit dem Betriebsveräußerer selbst fristlos zu kündigen, um mit dem Betriebserwerber neue Arbeitsverträge abschließen zu können (LAG Brandenburg, Urteil vom 02.02.2006 - 9 Sa 328/05). Ausreichend ist, dass - auch wenn dies nicht ausdrücklich ausgesprochen wird - nach den gesamten Umständen klar ist, dass der Arbeitnehmer vom Erwerber des Betriebs eingestellt wird (LAG Brandenburg, Urteil vom 02.02.2006 - 9 Sa 328/05). Demgegenüber reicht es nicht aus, wenn das Motiv des Rechtsgeschäfts lediglich in der erleichterten Betriebsübernahme liegt (BAG, Urteil vom 18.08.2005 - 8 AZR 523/04; LAG Brandenburg, Urteil vom 02.02.2006 - 9 Sa 328/05).
Danach liegt ein Umgehungsgeschäft nicht vor. Den Arbeitnehmern wurde weder ausdrücklich noch konkludent in Aussicht gestellt, dass die Beklagte sie nach Ausspruch der Eigenkündigungen einstellen wird. Dass es solche Zusagen gab, ist dem Parteivorbringen nicht zu entnehmen. Im Schreiben des Prozessbevollmächtigten der Beklagten 31.05.2007 heißt es unter Nr. 5 Satz 3
- 17 -
vielmehr ausdrücklich, im Falle einer Eigenkündigung trete die nachteilige Rechtsfolge ein, „dass Ansprüche aus Betriebsübergang gemäß § 613a BGB verlustig gehen". Inwiefern mit einzelnen Arbeitnehmern hiervon abweichende Abreden getroffen wurden, ist nicht ersichtlich. Die insoweit darlegungsbelastete Klägerin konnte hierzu nicht Näheres vortragen.
Der Beklagten kann nicht darin gefolgt werden, der Ablauf der Ereignisse, insbesondere die Neueinstellung von Arbeitnehmern durch die Beklagte, lasse keinen anderen Schluss zu als dass die Arbeitnehmer bereits Wiedereinstellungszusagen hatten. Der Ausspruch der Kündigungen lässt sich nicht allein durch eine Wiedereinstellungszusage erklären. Vielmehr ist es plausibel, dass jedenfalls ein Großteil der Arbeitnehmer die Kündigung aus wirtschaftlichen Erwägungen im Hinblick auf den dreimonatigen Insolvenzgeldzeitraum aussprach. Denn wie sich aus der von der Klägerin vorgelegten Aufstellung über die Insolvenzgeldzahlung ergibt, bezogen die Arbeitnehmer in der überwiegenden Mehrzahl Insolvenzgeld für den Zeitraum vom 01.03.2007 bis zum 31.05.2007 und hätten ohne den Ausspruch der Eigenkündigung bei Zahlungsunfähigkeit der Insolvenzschuldnerin wirtschaftliche Einbußen hinnehmen müssen. Soweit der Prozessbevollmächtigte der Beklagten die Arbeitnehmer zum Ausspruch der Eigenkündigungen durch sein Schreiben vom 31.05.2007, die mündlich im Rahmen der Betriebsversammlung gegebenen Erläuterungen und die vorformulierten Kündigungserklärungen veranlasst hat, mag sein Vorgehen in der Tat dadurch motiviert worden sein, dass der spätere Betriebsübergang erleichtert werden sollte. Lässt sich aber nicht feststellen, dass einzelnen Arbeitnehmern gegenüber Wiedereinstellungszusagen gemacht worden sind um die Kontinuität des jeweiligen Arbeitsverhältnisses zu wahren, ist das Motiv, den Betriebsübergang zu erleichtern, nicht ausreichend für die Qualifizierung der Kündigung als Umgehungsgeschäft.
Zwar ist festzustellen, dass bezogen auf die Gesamtheit der Arbeitsverhältnisse jedenfalls mehrheitlich deren Kontinuität gewahrt wurde. Im Streitfall ist davon auszugehen, dass die Beklagte, die ja, als sie sich entschloss, die Produktionstätigkeit der Insolvenzschuldnerin fortzuführen, über keine eigenen Arbeitnehmer verfügte, im Hinblick auf eine möglichst rasche Fortsetzung der Produktionstätigkeit darauf angewiesen war, eine funktionierende Belegschaft von
- 18 -
der Insolvenzschuldnerin zu übernehmen. Es ist auch nicht fern liegend anzunehmen, dass die Möglichkeit für die Beklagte, die Mehrheit der Belegschaft einzustellen, gerade dadurch geschaffen werden sollte, dass die Arbeitnehmer der Insolvenzschuldnerin vom Prozessbevollmächtigten der Beklagten - dem damaligen Berater der Insolvenzschuldnerin - zum Ausspruch von Eigenkündigungen veranlasst wurden.
Nach Ansicht der Berufungskammer lässt sich mit einer solchen kollektiven Betrachtungsweise jedoch eine Umgehung der Vorschrift des § 613a Abs. 1 Satz 1 BGB nicht begründen. Der Schutzzweck des § 613a Abs. 1 Satz 1 BGB besteht darin, zu verhindern, dass der Vertragsinhalt des einzelnen Arbeitsverhältnisses ohne sachlichen Grund geändert wird (BAG, Urteil vom 23.11.2006 - 8 AZR 349/06). Der Gesetzeszweck ist nicht darin zu erblicken, das Interesse an unveränderter Zusammensetzung der Belegschaft zu schützen oder den Betriebserwerber zu zwingen, Arbeitsplätze für die Gesamtbelegschaft einzurichten. Die Rechtsfolge des Betriebsüberganges nach § 613a BGB betrifft nicht die Belegschaft als Kollektiv, sondern besteht im Übergang des einzelnen Arbeitsverhältnisses. Diese Rechtsfolge tritt nur ein, soweit das jeweilige Arbeitsverhältnis vom Betriebsübergang bzw. Betriebsteilübergang erfasst ist. Folgerichtig wird der Schutzzweck des § 613a BGB nur dann umgangen, wenn das Arbeitsverhältnis des einzelnen Arbeitnehmers, dem gegenüber eine Wiedereinstellungszusage gemacht wurde, nur formal durch ein Umgehungsgeschäft beendet werden, aber letztlich aufgrund einer entsprechenden Einstellungszusage kontinuierlich fortgesetzt werden soll.
bb) Weitere Gründe für die Unwirksamkeit der Kündigungen sind nicht ersichtlich.
Es kann offen bleiben, ob ein Kündigungsgrund im Sinne des § 626 Abs. 1 BGB aufgrund der ausstehenden Lohnzahlungen vorlag oder ob zunächst der Ausspruch einer Abmahnung erforderlich gewesen wäre. Die Arbeitnehmer, die die Kündigungen aussprachen, könnten sich auf die Unwirksamkeit der Kündigungen wegen Fehlens eines wichtigen Grundes nicht berufen. Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer schriftlich erklärten fristlosen Eigenkündigung durch den Arbeitnehmer ist regelmäßig treuwidrig (BAG, Urteil vom 12.03.2009 – 2 AZR
- 19 -
894/07). Besondere Umstände, die eine andere Beurteilung rechtfertigen, liegen im Streitfall nicht vor. Der Klägerin, die sich auf übergegangene Ansprüche der Arbeitnehmer beruft, stehen keine weiter gehenden Rechte zu als den Kündigenden.
2. Ein Anspruch auf die begehrte Zahlung folgt für die Klägerin auch nicht aus § 25 HGB.
Der Erwerber eines Handelsgeschäftes haftet gemäß § 25 HGB auch für Vergütungsansprüche der Arbeitnehmer (LAG Schleswig-Holstein, Urteil vom 04.07.2006 - 2 Sa 150/06). Voraussetzung für eine Haftung nach § 25 HGB ist aber der Erwerb des Unternehmens und die Fortführung des Handelsgeschäfts unter derselben Firmenbezeichnung. Diese Voraussetzung liegt im Streitfall nicht vor. Die Beklagte hat die Firma der Insolvenzschuldnerin nicht übernommen.
Für eine Haftung gemäß § 25 Abs. 1 Satz 1 HGB gelten folgende Grundsätze (BGH, Urteil vom 24.09.2008 - VIII ZR 192/06; Urteil vom 15.03.2004 - II ZR 324/01; Urteil vom 10.10.1985 - IX ZR 153/84; Baumbach/Hopt, HGB, 34. Auflage 2010, § 25 Rn. 7 f.): Beim Wechsel des Inhabers ist die Firmenfortführung eine Voraussetzung für die in § 25 Abs. 1 Satz 1 HGB vorgesehene Haftung, weil in ihr die Kontinuität des Unternehmens nach außen in Erscheinung tritt, welche der tragende Grund für die Erstreckung der Haftung für früher im Betrieb des Unternehmens begründete Verbindlichkeiten auf den Nachfolger ist. Dabei kommt es nicht auf eine wort- oder buchstabengetreue Übereinstimmung zwischen alter und neuer Firma, sondern nur darauf an, ob aus der Sicht des Verkehrs trotz vorgenommener Änderungen noch eine Fortführung der Firma vorliegt. Das ist dann der Fall, wenn der prägende Teil der alten Firma in der neuen beibehalten wird. Nach der maßgeblichen Verkehrsauffassung muss sich der Kern der neuen und alten Firma gleichen.
Im Streitfall hat die Beklagte nicht den prägenden Teil der Firma der Insolvenzschuldnerin übernommen. Nach der Verkehrsauffassung gleichen sich der Kern der neuen und der alten Firma nicht. Im Hinblick auf die Buchstabenkombination, die jeweils den ersten Teil der Firma bildet, ist festzustellen, dass der letzte Buchstabe sich geändert hat. Dadurch ist ein anderes Schrift- und Lautbild entstanden. Es ist nicht davon auszugehen, dass allein die ersten beiden
- 20 -
(unverändert gebliebenen) Buchstaben den prägenden Teil der Firma bilden. Beide Firmen enthalten weitere Bestandteile, die die Tätigkeit des Unternehmens wiedergeben und insofern firmenprägend wirken. Im Hinblick auf diese Bestandteile fanden ebenfalls Änderungen statt, die der Firmenkontinuität entgegenstehen. Die Beklagte firmiert im Unterschied zur Insolvenzschuldnerin als „Draht-" und Metallbau „Handels-"Gesellschaft.
III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 ZPO. Die Klägerin unterlag im Rechtsstreit und muss die Kosten tragen.
Die Revision ist gemäß § 72 Abs. 2 Nr. 1 ArbGG zugelassen worden. Im Hinblick darauf, dass es sich bei den Geschehnissen um ein häufiger praktiziertes Modell handelt, kommt der Frage, ob eine Umgehung des § 613a BGB vorliegt, grundsätzliche Bedeutung zu.
RECHTSMITTELBELEHRUNG
Gegen dieses Urteil kann von der klagenden Partie
REVISION
eingelegt werden.
Für die beklagte Partei ist gegen dieses Urteil kein Rechtsmittel gegeben.
Die Revision muss innerhalb einer Notfrist* von einem Monat schriftlich beim
Bundesarbeitsgericht
Hugo-Preuß-Platz 1
99084 Erfurt
Fax: 0361 2636 2000
eingelegt werden.
- 21 -
Die Revisionsschrift muss von einem Bevollmächtigten unterzeichnet sein. Als Bevollmächtigte sind nur zugelassen:
1. Rechtsanwälte,
2. Gewerkschaften und Vereinigungen von Arbeitgebern sowie Zusammenschlüsse solcher Verbände für ihre Mitglieder oder für andere Verbände oder Zusammenschlüsse mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder,
3. Juristische Personen, deren Anteile sämtlich im wirtschaftlichen Eigentum einer der in Nummer 2 bezeichneten Organisationen stehen, wenn die juristische Person ausschließlich die Rechtsberatung und Prozessvertretung dieser Organisation und ihrer Mitglieder oder anderer Verbände oder Zusammenschlüsse mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder entsprechend deren Satzung durchführt und wenn die Organisation für die Tätigkeit der Bevollmächtigten haftet.
In den Fällen der Ziffern 2 und 3 müssen die Personen, die die Revisionsschrift unterzeichnen, die Befähigung zum Richteramt haben.
Eine Partei, die als Bevollmächtigter zugelassen ist, kann sich selbst vertreten.
* eine Notfrist ist unabänderlich und kann nicht verlängert werden.
Dr. Jansen
Jungebloth-König
Schumann
/W.
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gern:
 |
Dr. Martin Hensche Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hensche@hensche.de |
 |
Christoph Hildebrandt Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hildebrandt@hensche.de |
 |
Nina Wesemann Rechtsanwältin Fachanwältin für Arbeitsrecht Kontakt: 040 / 69 20 68 04 wesemann@hensche.de |