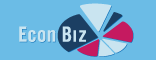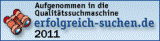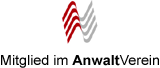- -> zur Mobil-Ansicht
- Arbeitsrecht aktuell
- Tipps und Tricks
- Handbuch Arbeitsrecht
- Gesetze zum Arbeitsrecht
- Urteile zum Arbeitsrecht
- Urteile 2023
- Urteile 2021
- Urteile 2020
- Urteile 2019
- Urteile 2018
- Urteile 2017
- Urteile 2016
- Urteile 2015
- Urteile 2014
- Urteile 2013
- Urteile 2012
- Urteile 2011
- Urteile 2010
- Urteile 2009
- Urteile 2008
- Urteile 2007
- Urteile 2006
- Urteile 2005
- Urteile 2004
- Urteile 2003
- Urteile 2002
- Urteile 2001
- Urteile 2000
- Urteile 1999
- Urteile 1998
- Urteile 1997
- Urteile 1996
- Urteile 1995
- Urteile 1994
- Urteile 1993
- Urteile 1992
- Urteile 1991
- Urteile bis 1990
- Arbeitsrecht Muster
- Videos
- Impressum-Generator
- Webinare zum Arbeitsrecht
-
Kanzlei Berlin
 030 - 26 39 62 0
030 - 26 39 62 0
 berlin@hensche.de
berlin@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Frankfurt
 069 - 71 03 30 04
069 - 71 03 30 04
 frankfurt@hensche.de
frankfurt@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hamburg
 040 - 69 20 68 04
040 - 69 20 68 04
 hamburg@hensche.de
hamburg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hannover
 0511 - 89 97 701
0511 - 89 97 701
 hannover@hensche.de
hannover@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Köln
 0221 - 70 90 718
0221 - 70 90 718
 koeln@hensche.de
koeln@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei München
 089 - 21 56 88 63
089 - 21 56 88 63
 muenchen@hensche.de
muenchen@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Nürnberg
 0911 - 95 33 207
0911 - 95 33 207
 nuernberg@hensche.de
nuernberg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Stuttgart
 0711 - 47 09 710
0711 - 47 09 710
 stuttgart@hensche.de
stuttgart@hensche.de
AnfahrtDetails
LAG Düsseldorf, Urteil vom 18.12.2008, 11 Sa 299/08
| Schlagworte: | Elternzeit: Teilzeit, Elternzeit | |
| Gericht: | Landesarbeitsgericht Düsseldorf | |
| Aktenzeichen: | 11 Sa 299/08 | |
| Typ: | Urteil | |
| Entscheidungsdatum: | 18.12.2008 | |
| Leitsätze: | Im Hinblick darauf, dass der/die Arbeitnehmer/in die Möglichkeit hat, die Inanspruchnahme von Elternzeit nach § 16 Abs. 1 Satz 1 BEEG unter die Bedingung der gleichzeitigen Zustimmung des Arbeitgebers zur beantragten Elternzeit zu stellen (BAG 15.04.2008 - 9 AZR 380/07 - Rz. 35 juris), kann er/sie im Falle der Ablehnung des Elternteilzeitwunsches nicht die Anpassung des dem Arbeitgeber mitgeteilten Elternzeitraums analog § 313 Abs. 1 BGB verlangen. | |
| Vorinstanzen: | Arbeitsgericht Essen, 26.09.2007 - 6 Ca 1828/07, nachgehend: Bundesarbeitsgericht, 15.12.2009 - 9 AZR 72/09 |
|
Landesarbeitsgericht Düsseldorf, 11 Sa 299/08
| Tenor: | Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Arbeitsgerichts Essen om 26.09.2007 - 6 Ca 1828/07 - teilweise abgeändert:
Die Klage wird insgesamt abgewiesen. Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Arbeitsgerichts Essen vom 26.09.2007 - 6 Ca 1828/07 - wird zurückgewiesen. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin. Die Revision wird für die Klägerin zugelassen. |
| TATBESTAND: | 1 |
|
Die Parteien streiten über die Dauer der Elternzeit der Klägerin und über deren Teilzeitbeschäftigung während der Elternzeit. |
2 |
|
Die am 05.04.1966 geborene, verheiratete Klägerin ist bei der Beklagten bzw. ihren Rechtsvorgängern seit dem 01.05.1992 beschäftigt. Mit Wirkung vom 01.01.2002 übernahm sie aufgrund Arbeitsvertrages vom 21.01.2002 die Position der Leiterin Controlling mit Prokura. |
3 |
|
Die Klägerin teilte der Beklagten im Jahre 2006 mit, dass sie ein Kind erwarte. Wegen der weiteren Planung des Arbeitsverhältnisses fanden zwischen ihr und den Geschäftsführern der Beklagten zwei Besprechungen statt. Der Inhalt der Gespräche, die nach Angaben der Klägerin am 04.09.2006 und 22.09.2006 erfolgten, ist zwischen den Parteien streitig. Nach Behauptung der Klägerin hat man vereinbart, dass sie zwei Jahre in Elternzeit gehe und etwa 6 Monate nach dem Ende der Mutterschutzfrist in ihrer bisherigen Position in Teilzeit mit 20 Wochenstunden die Arbeit wieder aufnehmen werde. Nach Angaben der Beklagten ließ die Klägerin sie in dem Glauben, dass sie - die Klägerin - nach der Mutterschutzzeit wieder vollzeitig an ihren Arbeitsplatz zurückkehren werde. |
4 |
|
Am 20.10.2006 wurde die Klägerin mit einem von ihr für die Mitarbeiter des Standortes F. organisiertem Frühstück durch den Geschäftsführer der Beklagten, Herrn E., in den Mutterschutz verabschiedet. Er wies darauf hin, dass die Klägerin ja bald zurückkehren werde. Weitere Einzelheiten sind hinsichtlich der am 20.10.2006 abgegebenen Erklärungen zwischen den Parteien streitig. |
5 |
|
Am 21.12.2006 gebar die Klägerin ihren Sohn, M. U. X.. Am 30.01.2007 begab sie sich in den Betrieb der Beklagten in F.. Am 31.01.2007 ging ein auf den 05.01.2007 datiertes Schreiben der Klägerin bei der Beklagten ein mit folgendem Wortlaut ein: |
6 |
| "Anmeldung Elternzeit | 7 |
| Sehr geehrter Herr K., sehr geehrte Damen und Herren, | 8 |
|
Am 21. Dezember wurde mein Sohn M. U. X. geboren. Damit einhergehend beantrage ich wie mit Herrn C. E. und Ihnen im Vorfeld besprochen eine zweijährige Elternzeit. |
9 |
|
Gleichzeitig möchte ich während dieser Zeit in Teilzeit innerhalb des gesetzlich möglichen Umfangs von maximal 30 Wochen-Stunden für 20 Wochen-Stunden arbeiten. Diese Teilzeit soll nach bisheriger Vereinbarung ab dem 23. August , also nach rund 6 Monaten nach Ablauf der Mutterschutzfrist beginnen und für die Dauer meiner Elternzeit gelten. Für die Dauer von einem Jahr hat auch mein Mann, Herr G. X., bei seinem Arbeitgeber Elternzeit beantragt, so dass von August 2007 bis August 2008 eine gemeinsame Elternzeit gilt. Für meine Teilzeit würde ich den Mittwoch, den Freitag und stundenweise Heimarbeit vorsehen bzw. vorschlagen. |
10 |
|
Ich bitte um Bestätigung dieser Vorgehensweise. Gerne komme ich zu einem weiteren Gespräch bezüglich der Teilzeit im Büro vorbei." |
11 |
|
Die Beklagte antwortete mit Schreiben vom 20.02.2007. Hierin bestätigte sie der Klägerin deren Elternzeit vom 15.02.2007 bis zum 21.12.2008. Die gewünschte Teilzeittätigkeit lehnte die Beklagte ab und verwies insoweit auf näher erläuterte entgegenstehende dringende betriebliche Gründe. In der Abteilung der Klägerin hatte die Beklagte zuvor einem Teilzeitwunsch des Arbeitnehmers J.-D. entsprochen. |
12 |
|
Mit einem an die Beklagte gerichteten Schreiben vom 08.03.2007 begründete die Klägerin ihr Teilzeitbegehren näher. Zusätzlich fragte sie die Beklagte, ob eine anderweitige Teilzeitbeschäftigung angeboten werden könne. Unter dem 13.03.2007 antwortete die Beklagte, dass auch keine anderweitige Teilzeitbeschäftigung bei ihr oder ihren Vertragspartnern möglich sei. Unter Hinweis auf das Ruhen des Arbeitsverhältnisses wurde der Klägerin zugleich Prokura entzogen und ihr zu Ende März 2007 das zur Verfügung gestellte Handy und der ihr überlassene PKW zurückgefordert. Mit weiterem Schreiben vom 05.04.2007 nahm die Beklagte nochmals zu dem Schreiben der Klägerin vom 08.03.2007 ablehnend Stellung. |
13 |
|
Am 17.04.2007 fand zwischen der Klägerin und dem Geschäftsführer E. ein 40-minütiges Gespräch statt. Die Unterredung endete hinsichtlich der von der Klägerin gewünschten Teilzeitbeschäftigung ohne ein Ergebnis. Weitere Erklärungen des Geschäftsführers E. während dieses Gespräches werden von den Parteien unterschiedlich dargestellt. |
14 |
|
Mit Schreiben vom 30.04.2007 wandten sich die Prozessbevollmächtigten der Klägerin mit dem Ziel einer außergerichtlichen Klärung der von dieser gewünschten Teilzeitbeschäftigung an die Beklagte. Diese lehnte durch ihre Prozessbevollmächtigten unter dem 10.05.2007 weitere Gespräche ab. |
15 |
|
Am 23.05.2007 erklärten die Prozessbevollmächtigten der Klägerin die Anfechtung des Antrags ihrer Mandantin vom 05.01.2007. Zur Begründung wiesen sie darauf hin, dass sich die Klägerin von der Beklagten getäuscht fühle und im Übrigen die Geschäftsgrundlage für die beantragte Elternzeit entfallen sei. Zugleich beantragte die Klägerin durch ihre Prozessbevollmächtigten zunächst laufend bis zum 22.08.2007 Elternzeit und für ein weiteres Jahr vom 23.08.2008 bis zum 22.09.2009 unter gleichzeitiger Teilzeitbeschäftigung vom 23.08.2008 bis zum 22.09.2009 mit 20 Wochenstunden. |
16 |
|
Mit ihrer am 24.05.2007 bei dem Arbeitsgericht Essen eingegangenen Schriftsatz macht die Klägerin hauptsächlich ihre neuen Elternzeitanträge einschließlich der Teilzeitbeschäftigung geltend. |
17 |
| Die Klägerin hat im Wesentlichen behauptet: | 18 |
|
Sie habe in einem Gespräch mit dem Geschäftsführer E. am 04.09.2006 darauf hingewiesen, dass sie nach der Geburt ihres Sohnes nach Ablauf der Mutterschutzfrist ein halbes Jahr zu Hause bleiben wolle, um dann in Teilzeit mit einem Umfang von 20 Stunden zu arbeiten. Herr E. habe geantwortet, dass er mit einer solchen Teilzeittätigkeit ausdrücklich einverstanden sei. Hinsichtlich der Vertretungsfrage habe sie sich mit dem Geschäftsführer E. darauf geeinigt, dass der Mitarbeiter N. zum Vertreter bestellt werden solle. In einem weiteren Gespräch mit den beiden Geschäftsführern der Beklagten E. und C. am 22.09.2006 habe sie dem letzteren ihre Planung dargelegt. Auch Herr C. habe ausdrücklich die Zustimmung signalisiert. In der Folgezeit seien sowohl von ihr als auch von der Geschäftsleitung die Mitarbeiter der Personalabteilung G. und K. informiert worden. Beide hätten ihr erklärt, mit einem förmlichen Antrag könne sie bis nach der Niederkunft warten. Herr E. habe den Mitarbeiter N. über die Vereinbarung mit ihr informiert. Er sei dann als kommissarischer Leiter Controlling bis zu ihrer Rückkehr eingesetzt worden. In der Besprechung vom 17.04.2007 habe Herr E. darauf hingewiesen, dass das Problem darin bestehe, dass sein Mitgeschäftsführer C. ihre sachlich kritische Art nicht schätze. Es sei richtig, dass er früher bereit gewesen sei, die von ihr angestrebte Teilzeittätigkeit zu ermöglichen. Seine Meinung habe er aber geändert. |
19 |
| Die Klägerin hat beantragt, | 20 |
|
1. die Beklagte zu verurteilen, der von ihr beantragten Gewährung von Elternzeit für den Zeitraum vom 21.12.2006 bis zum 22.08.2007 und vom 23.08.2008 bis zum 22.08.2009 zuzustimmen, und zwar mit einer Beschäftigung während des Zeitraums vom 23.08.2008 bis zum 22.08.2009 in der bisherigen Funktion (Leiterin Controlling mit Prokura) in Teilzeit (20 Wochenstunden), und zwar montags und freitags jeweils an 8 Stunden und für weitere 4 Stunden unter der Woche in Form von Home-Office; |
21 |
|
2. die Beklagte zu verurteilen, sie vorbehaltlich der sich aus der Erfüllung des Antrags zu 1 ergebenden Rechtsfolgen (Teilzeittätigkeit während der beantragten Elternzeit) zu den bisherigen Bedingungen (Leiterin Controlling mit Prokura) zu beschäftigen; |
22 |
|
3. hilfsweise die Beklagte zu verurteilen, sie zu den bisherigen Bedingungen (Leiterin Controlling mit Prokura) während der für den Zeitraum vom 21.12.2006 bis zum 20.12.2008 vereinbarten Elternzeit in Teilzeit (20 Wochenstunden) zu beschäftigen und dem Antrag zuzustimmen, die Beschäftigung vorzunehmen mittwochs und freitags an jeweils 8 Stunden und im Umfang von weiteren 4 Wochenstunden zu Hause (Home-Office); |
23 |
|
4. äußerst hilfsweise die Beklagte zu verurteilen, der von ihr beantragten Gewährung von Elternzeit für den Zeitraum vom 21.12.2006 bis zum 21.12.2008 zuzustimmen, und zwar mit einer Beschäftigung in der bisherigen Funktion in Teilzeit (20 Wochenstunden), und zwar mittwochs und freitags jeweils 8 Stunden und für weitere 4 Stunden unter der Woche ab dem 23.08.2007. |
24 |
| Die Beklagte hat beantragt, | 25 |
| die Klage abzuweisen. | 26 |
| Die Beklagte hat im Wesentlichen ausgeführt: | 27 |
|
Ihre Geschäftsführer hätten nie die Zusage einer Teilzeitbeschäftigung während der Elternzeit erteilt. Die Klägerin habe bis zum Eingang ihres Schreibens vom 05.01.2007 sie - die Beklagte - und auch ihre Kollegen in dem Glauben gelassen, sie werde nach der Mutterschutzfrist wieder an ihren Arbeitsplatz in Vollzeit zurückkehren. Das Hilfsbegehren der Klägerin könne keinen Erfolg haben, da dem dringende betriebliche Gründe entgegenstehen würden. Als Leiterin Controlling habe die Klägerin eine Schlüsselposition inne. Dies gelte insbesondere für die zwingend erforderliche Teilnahme an den regelmäßigen, täglichen und kurzfristig im voraus nicht planbaren Besprechungen mit den Geschäftsführern, Niederlassungsleitern, Abteilungsleitern, Projektverantwortlichen, den Gesellschaftern und Bereichsleitern der Konzernmutter, den Mitarbeitern der Klägerin und den externen Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern. Die Notwendigkeit einer Vollzeittätigkeit werde darüber hinaus durch eine Umstrukturierung und Neuausrichtung, die eine Betriebsänderung zur Folge habe, verschärft. Zudem erfolge in den Jahren 2006 bis 2008 eine konzernweite Umstellung/Anpassung der EDV-Systeme von SAP auf das von der Konzernmutter, der P. Germany Gruppe, vorgegebene Axapta-System. Um den Systemübergang reibungslos zu begleiten und sicherzustellen, sei es zwingend erforderlich, dass die Leitung des Bereiches Controlling den internen und externen Ansprechpartnern jederzeit zur Verfügung stehe. Die Klägerin habe im Zusammenhang mit der Umstellung eine Schlüsselposition inne. Die Klägerin müsse Dienstreisen im gesamten Bundesgebiet und in das angrenzende europäische Ausland durchführen. Die Termine für die Reisen und für die zusätzlich stattfindenden Video- und Telefonkonferenzen seien in den seltensten Fällen über mehrere Tage im voraus planbar. Auch gehöre es zu der tagtäglichen Arbeitsaufgabe der Leiterin Controlling mit den Mitarbeitern und verantwortlichen Personen der Niederlassungen der P. Group und ihr zu kommunizieren und für Rückfragen zur Verfügung zu stehen. |
28 |
| Die Klägerin hat dem entgegengehalten: | 29 |
|
Meetings, Besprechungen und ähnliches könnten so abgestimmt werden, dass ihre Anwesenheit sichergestellt sei. In der Vergangenheit habe sie sich lediglich zu 15 % ihrer Arbeitszeit auf Dienstreisen befunden. 85 % ihrer Tätigkeit wickele sie am PC oder Telefon ab. Viele organisatorische Dinge könnten auch über eine ET-Anbindung zu Hause oder per E-Mail und Datenbankanschluss erledigt werden. Die Möglichkeit der Teilzeitarbeit sei schon dadurch nachgewiesen, dass während ihrer Abwesenheit in der Elternzeit der Leiter des Rechnungswesens von November 2006 bis August 2007 kommissarisch zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben ihre Position wahrgenommen habe. |
30 |
|
Mit seinem am 26.09.2007 verkündeten Urteil hat das Arbeitsgericht der Klage bezüglich des Hilfsantrags zu 4. stattgegeben und sie im Übrigen abgewiesen. Zur Begründung hat das Gericht im Wesentlichen ausgeführt: |
31 |
|
Die Klägerin habe mit Schreiben vom 05.01.2007 die Elternzeit verbindlich für den Zeitraum vom 15.02.2007 bis zum 21.12.2008 festgelegt, so dass sie diese nicht vorzeitig zum 22.02.2007 hätte beenden und vom 23.08.2008 bis zum 22.08.2009 neu festlegen können. Sie habe keinen der in § 16 Abs. 3 Satz 2 BEEG genannten Ausnahmefälle, die eine vorzeitige Beendigung der Elternzeit ermöglichen würden, vorgetragen. Sie könne von der Beklagten auch nicht gemäß § 16 Abs. 2 Satz 1 BEEG die Zustimmung zu der vorzeitigen Beendigung der Elternzeit verlangen. Eine Veränderung des Elternzeitwunsches könne die Klägerin auch nicht durch ihre Anfechtung des Elternzeitantrages vom 05.01.2007 erreichen. Von diesem könne sie sich ebenso wenig nach den Regeln über den Wegfall der Geschäftsgrundlage lösen. Mit dem Scheitern des Klageantrags zu 1. müsse gleichzeitig der Klageantrag zu 2. abgewiesen werden. Auch der Klageantrag zu 3. könne keinen Erfolg haben. Zum einen könne die Klägerin mit ihrem Teilzeitverlangen nicht den Arbeitsvertrag dahingehend ändern, dass sie einen Teil ihrer Arbeit zu Hause im Home-Office leiste. Zum anderen könne sie mit ihrem Klageantrag zu 3. nicht die von ihr begehrte Verurteilung der Beklagten zu der gewünschten Beschäftigung erreichen, da es hierfür an der erforderlichen Vertragsänderung fehle. Soweit der Klageantrag zu 4. zulässig sei, sei er begründet. Die Beklagte müsse gemäß § 15 Abs. 7 BEEG der von der Klägerin begehrten Teilzeitbeschäftigung zustimmen. Die von ihr gegen die Elternteilzeit vorgetragenen Gesichtspunkte würden nicht ausreichen, um von dringenden betrieblichen Gründen i. S. des § 15 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 BEEG ausgehen zu können. |
32 |
|
Gegen das ihnen am 30.01.2008 zugestellte Urteil haben die Parteien mit einem bei Gericht am 13.02.2008 (Beklagte) bzw. am 14.02.2008 (Klägerin) eingereichten Schriftsatz Berufung eingelegt und diese mit einem am 25.02.2008 (Klägerin) bzw. - nach Verlängerung der Berufungsbegründungsfrist bis zum 28.04.2008 - mit einem am 28.04.2008 (Beklagte) eingereichten Schriftsatz begründet. |
33 |
|
Die Klägerin macht unter teilweiser Wiederholung ihres erstinstanzlichen Vorbringens im Wesentlichen geltend: |
34 |
|
Ihrem schriftlichen Antrag vom 05.01.2007 sei jede Grundlage entzogen worden. Vor allem sei ihre Anfechtung begründet. Sie sei in mehrfacher Hinsicht getäuscht worden. Zum einen habe man sie davon abgehalten, einen schriftlichen Antrag zu stellen. Zum anderen habe man dann genau diesen Punkt aufgegriffen und sie veranlasst, das mündlich Vereinbarte schriftlich zu beantragen, um dann einen Teil anzunehmen und einen Teil nicht. Im Übrigen sei Geschäftsgrundlage für ihr Elternzeitbegehren gewesen, dass sie nach einer kurzen Elternzeit wieder in den Betrieb zurückkehren könne. |
35 |
| Die Klägerin beantragt, | 36 |
| die angegriffene Entscheidung abzuändern, soweit die Klage abgewie- | 37 |
| sen worden ist. | 38 |
| Die Beklagte beantragt, | 39 |
| 1. die Berufung der Klägerin zurückzuweisen; | 40 |
| 2. unter Abänderung des am 26.09.2007 verkündeten Urteils des Arbeitsgerichts Essen - 6 Ca 1828/07 - die Klage insgesamt abzuweisen. | 41 |
|
Die Beklagte macht unter teilweiser Wiederholung ihres erstinstanzlichen Vorbringens im Wesentlichen geltend: |
42 |
|
Das Arbeitsgericht habe übersehen, dass der Klage bereits das Rechtsschutzbedürfnis fehle. Erkennbares, beantragtes und primäres Ziel der Kläger sei es vom Zeitpunkt der Klageeinreichung bis zum Kammertermin am 26.09.2007 gewesen, ab dem 23.08.2007 in Vollzeit zu arbeiten. Lediglich mit dem Hilfsantrag habe sie eine Teilzeittätigkeit ab dem 23.08.2007 begehrt. Damit habe sich die Klägerin selbst gegen ihren ursprünglichen Antrag vom 05.01.2007 gestellt. Die wechselnden Ziele der Klägerin im Hinblick auf Lage und Ausgestaltung der Elternzeit sowie der Wechsel zwischen Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung zwischen bzw. während der Elternzeit habe dazu geführt, dass ihr eine nicht mehr hinzunehmende Ungewissheit über die Inanspruchnahme der Elternzeit zugemutet worden sei. Sie habe bereits erstinstanzlich dargelegt, dass die entstehenden Organisationsschwierigkeiten so erheblich seien, dass sie den Anforderungen der dringenden betrieblichen Gründe i. S. von § 15 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 BEEG genügen würden. Der Arbeitsplatz der Klägerin würde spätestens mit Wirkung zum 01.04.2008 bzw. 30.06.2008 durch die Verlagerung des gesamten Controlling von F. nach C. gemäß dem Gesellschafterbeschluss vom 24.10.2007 entfallen. Nicht nur zuvor, sondern auch nach diesem Beschluss sei die Position des Leiters Controlling aus den erstinstanzlich dargelegten Gründen nicht teilbar. |
43 |
| Die Klägerin beantragt noch, | 44 |
| die gegnerische Berufung zurückzuweisen. | 45 |
| Die Klägerin macht insofern im Wesentlichen geltend: | 46 |
|
Unverständlich sei es, wenn die Beklagte erkläre, es habe keine Planungssicherheit gegeben. Sie habe den angestrebten Umfang ihrer Tätigkeit mit der Beklagten besprochen. Bis heute habe diese die ihrem Teilzeitwunsch entgegenstehenden betrieblichen Gründe nicht schlüssig dargelegt. Soweit für den Umzug und den Aufbau des Unternehmens Controlling in C. eine vollzeitige Anwesenheit erforderlich gewesen wäre, habe sie dies für das Übergangsjahr 2007/2008 angeboten, was die Beklagte aber abgelehnt habe. Der Beklagten sei es möglich gewesen, mit ihr, da sie grundsätzlich zu flexiblen Lösungen bereit gewesen sei, auch eine Vereinbarung zu treffen, die Tätigkeiten an verschiedenen Standorten vorgesehen hätte. |
47 |
|
Wegen des sonstigen Vorbringens der Parteien im Einzelnen wird auf den mündlich vorgetragenen Inhalt der Akte ergänzend Bezug genommen. |
48 |
| ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: | 49 |
| A. | 50 |
|
Die Berufung der Klägerin, gegen deren Zulässigkeit keinerlei Bedenken bestehen, ist unbegründet. |
51 |
|
I. Zu Recht hat die Vorinstanz angenommen, dass durch das Schreiben der Klägerin vom 05.01.2007 die dort verlangte Elternzeit verbindlich für den Zeitraum vom 15.02.2007 bis zum 21.12.2008 festgelegt worden ist, sich hieran in der Folgezeit nichts geändert hat und damit der Klageantrag zu 1) unbegründet ist. |
52 |
|
1. Die wirksame Inanspruchnahme der Elternzeit der Klägerin richtet sich vorliegend nach § 16 Abs. 1 Satz 1 BEEG. Die Klägerin hat erst nach Inkrafttreten des BEEG am 01.01.2007 Elternzeit für ihren am 21.12.2006 geborenen Sohn beansprucht. Da keiner der in der Übergangsvorschrift des § 27 BEEG geregelten Tatbestände im Streitfall vorliegt, scheidet eine Anwendung des BErzGG aus (vgl. auch BAG 05.06.2007 - 9 AZR 82/07 - NZA 2007, 1352, 1354; BAG 15.04.2008 - 9 AZR 380/07 - Rz. 19, EzA § 15 BErzGG Nr. 17). Im Übrigen besteht für den Streitfall kein inhaltlicher Unterschied hinsichtlich der Anwendung von §§ 15, 16 BErzGG oder §§ 15, 16 BEEG. |
53 |
| a) Die Voraussetzungen des von der Klägerin geltend gemachten Anspruchs auf Elternzeit sind, wie die Vorinstanz richtig erkannt hat, gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a, Abs. 2 Satz 1 BEEG gegeben. Die Klägerin hat außerdem gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 BEEG in ihrem Schreiben vom 05.01.2007 erklärt, für welchen Zeitraum sie innerhalb von zwei Jahren Elternzeit nehmen will. Auch wenn die Klägerin ihre Elternzeit ab dem 15.02.2007 (vgl. § 15 Abs. 2 Satz 2 BEEG) nicht innerhalb der siebenwöchigen Ankündigungsfrist des § 16 Abs. 1 Satz 1 BEEG verlangt hat - ihr Schreiben vom 05.01.2007 ist bei der Beklagten erst am 31.01.2007 eingegangen -, hat dies auf die Wirksamkeit ihres Elternzeitbegehrens keinen Einfluss. Denn der Arbeitgeber kann auf die Einhaltung der ausschließlich seinen Interessen dienenden Ankündigungsfrist des § 16 Abs. 1 Satz 1 BEEG verzichten (vgl. nur Buchner/Becker, BEEG, 8. Aufl. 2008, § 16 Rz. 9). Vorliegend hat die Beklagte konkludent auf die Fristeinhaltung verzichtet, da sie sich mit Schreiben vom 20.02.2007 auf die von der Klägerin begehrte Elternzeit eingelassen und diese ausdrücklich bestätigt hat. | 54 |
| b) Die Klägerin hat erstmals mit ihrem Schreiben vom 05.01.2007 ihr Elternzeitbegehren in rechtserheblicher Form geltend gemacht. Das in § 16 Abs. 1 Satz 1 BEEG normierte Schriftformerfordernis ist eine Wirksamkeitsvoraussetzung für die Inanspruchnahme der Elternzeit (BAG 26.06.2008 - 2 AZR 23/07 - Rz. 24, EzA § 18 BErzGG Nr. 9 m. w. N.). Das Schriftformerfordernis dient der Rechtsklarheit. Denn am Beginn einer Elternzeit sind mehrere Fallgestaltungen denkbar, in denen - bei fehlender schriftlicher Beantragung - offenbleibt, ob Elternzeit in Anspruch genommen oder eine andere Form der Arbeitsbefreiung geltend gemacht wird. Daher kommt dem schriftlichen Verlangen nach Elternzeit eine vor allem klarstellende Funktion für die Parteien zu (BAG 26.06.2008 - 2 AZR 23/07 - Rz. 25, a. a. 0.). | 55 |
|
2. Die für den 15.02.2007 bis zum 21.12.2008 verbindlich festgelegte Elternzeit der Klägerin ist in der Folgezeit nicht entfallen. |
56 |
| a) Zunächst hat die Vorinstanz zutreffend erkannt, dass diese Elternzeit zu keinem Zeitpunkt vorzeitig beendet worden ist. Insofern fehlt die hierfür nach § 16 Abs. 3 Satz 1 BEEG vorgeschriebene Zustimmung der Beklagten. Für die Annahme einer rechtsmissbräuchlichen Zustimmungsverweigerung (vgl. § 242 BGB) liegen, wie die Vorinstanz richtig ausgeführt hat, keinerlei Anhaltspunkte vor. Gegen diese Feststellung hat sich die Klägerin auch nicht in ihrer Berufungsbegründung gewandt. | 57 |
| b) Die in ihrem Schreiben vom 05.01.2007 seitens der Klägerin erklärte Inanspruchnahme von Elternzeit ist nicht durch ihre Anfechtungserklärung vom 23.05.2007 (vgl. § 143 Abs. 1 BGB analog) nach § 142 Abs. 1 BGB nichtig geworden. Zwar ist das Verlangen nach Elternzeit gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 BEEG als rechtsgeschäftsähnliche Handlung zu qualifizieren und deshalb anfechtbar nach §§ 119 ff. BGB analog (vgl. Buchner/Becker, a. a. 0., § 16 Rz. 4). Es fehlt jedoch an dem von der Klägerin geltend gemachten Anfechtungsgrund der arglistigen Täuschung (vgl. § 123 Abs. 1 BGB analog). | 58 |
|
aa) Der Tatbestand der arglistigen Täuschung setzt in objektiver Hinsicht voraus, dass der Täuschende durch Vorspiegelung oder Entstellung von Tatsachen beim Erklärungsgegner einen Irrtum erregt und ihn zur Abgabe einer Willenserklärung veranlasst. Die Täuschung muss sich auf objektiv nachprüfbare Umstände beziehen, während subjektive Werturteile nicht genügen. Die Täuschung kann durch positives Tun, also insbesondere durch Behaupten, Unterdrücken oder Entstellen von Tatsachen erfolgen. Sie kann aber auch in dem Verschweigen von Tatsachen bestehen, sofern der Erklärende zur Offenbarung der fraglichen Tatsache verpflichtet ist (z. B. BAG 29.01.1997 - 2 AZR 472/96 - NZA 1997, 485, 486). In subjektiver Hinsicht muss der Täuschende arglistig handeln. Das ist der Fall, wenn der Täuschende die Unrichtigkeit seiner Angaben kennt und zumindest billigend in Kauf nimmt, der Erklärungsempfänger könnte durch die Täuschung beeinflusst werden (BAG 28.05.1998 - 2 AZR 549/97 - EzA § 123 BGB Nr. 49; BAG 20.05.1999 - 2 AZR 320/98 - EzA § 123 BGB Nr. 52; vgl. auch BAG 23.11.2006 - 8 AZR 349/06 - EzA § 613 a BGB 2002 Nr. 61). |
59 |
|
bb) Zumindest im Ergebnis hat die Vorinstanz richtig erkannt, dass der Beklagten keine arglistige Täuschung i. S. von § 123 Abs. 1 BGB vorzuwerfen ist. Denn von einer der Beklagten seitens der Klägerin vorgehaltenen, von vornherein nicht bestehenden Absicht, die angeblich mit ihr - der Klägerin - für die Zeit vom 23.08.2008 bis zum 22.08.2009 vereinbarte Teilzeit während der Elternzeit nicht zu realisieren, kann schon deshalb keine Rede sein, weil die Klägerin, worauf bereits hingewiesen worden ist, mit ihrem Schreiben vom 05.01.2007 überhaupt erstmals Elternzeit wirksam für die Zeit vom 15.02.2007 bis zum 21.12.2008 in Anspruch genommen hat und damit auch gleichzeitig erstmals die gewünschte Teilzeit in dieser Elternzeit begehrt werden konnte. |
60 |
| c) Die Klägerin kann von der Beklagten auch nicht die Anpassung des durch ihr Schreiben vom 05.01.2007 festgelegten Zeitraums ihrer Elternzeit nach den Regeln über den Wegfall der Geschäftsgrundlage gemäß § 313 Abs. 1 BGB im Hinblick auf die in ihrem Klageantrag zu 1) genannten Zeiträumen verlangen. | 61 |
|
aa) Nach § 313 Abs. 1 BGB kann die Anpassung eines zwischen den Parteien zustande gekommenen Vertrages verlangt werden, sofern sich die Umstände, die zur Grundlage des Vertrages geworden sind, nach Vertragsschluss schwerwiegend verändert haben, die Parteien den Vertrag nicht oder mit anderem Inhalt geschlossen hätten und einem Vertragsteil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung, das Festhalten am unveränderten Vertrag nicht zugemutet werden kann. |
62 |
|
bb) Es bestehen bereits Bedenken dagegen, diese Vorschrift auf das Elternzeitverlangen der Klägerin vom 05.01.2007 anzuwenden. Denn durch dieses Verlangen und die Bestätigung der von der Klägerin gewünschten Elternzeit durch die Beklagte mit ihrem Schreiben vom 20.02.2007 ist nicht etwa ein Vertrag zwischen den Parteien zustande gekommen. Durch die Inanspruchnahme von Elternzeit werden vielmehr lediglich die Hauptpflichten des Arbeitsverhältnisses (vgl. § 611 Abs. 1 BGB) zum Ruhen gebracht (BAG 15.04.2008 - 9 AZR 380/07 - Rz. 35, EzA § 15 BErzGG Nr. 17). |
63 |
|
cc)Aber selbst wenn man § 313 Abs. 1 BGB auf das Elternzeitverlangen nach § 16 Abs. 1 Satz 1 BEEG zu Gunsten der Klägerin analog anwenden würde, verhilft ihr das nicht zu einer Abänderung des festgelegten Zeitraums. |
64 |
| (1) Wie § 313 Abs. 1 BGB ausdrücklich bestimmt, ist für eine Berücksichtigung von Störungen der Geschäftsgrundlage grundsätzlich dann kein Raum, wenn es um Erwartungen und Umstände geht, die nach der vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung in den Risikobereich einer der Parteien fallen sollen. Eine solche vertragliche oder gesetzliche Risikoverteilung bzw. Risikoübernahme schließt für den Betroffenen regelmäßig die Möglichkeit aus, sich bei Verwirklichung des Risikos auf den Wegfall der Geschäftsgrundlage zu berufen (vgl. z. B. BGH 21.09.2005 - XII - ZR 66/03 - NJW 2006, 899, 901). | 65 |
| (2) Wie dem Elternzeitverlangen der Klägerin vom 05.01.2007 zu entnehmen ist, war der gewünschte Zeitraum durch die gleichzeitig begehrte Elternteilzeit beeinflusst. Allerdings unterliegen Elternzeit und Elternteilzeit unterschiedlichen Anspruchsvoraussetzungen. Dies führt zu Problemen, wenn der Arbeitnehmer Elternzeit in Anspruch nimmt, um aus wirtschaftlichen Gründen während der Elternzeit mit verringerter Arbeitszeit arbeiten zu wollen. Durch die Inanspruchnahme von Elternzeit werden die Hauptpflichten des Arbeitsverhältnisses (vgl. § 611 Abs. 1 BGB), wie bereits erwähnt, zum Ruhen gebracht. Verweigert der Arbeitgeber zu Recht die begehrte Elternteilzeit wegen dringender betrieblicher Gründe (vgl. § 15 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 BEEG), kann der Arbeitnehmer seine wirtschaftlichen Überlegungen nicht verwirklichen. Er bleibt in Elternzeit ohne die beantragte Elternteilzeit. Diesem Risiko ist er jedoch nicht schutzlos ausgeliefert. Er hat die Möglichkeit, die Inanspruchnahme von Elternzeit unter die Bedingung zu stellen, dass der Arbeitgeber der gleichzeitig beantragten Elternteilzeit zustimmt. Die grundsätzliche Bedingungsfeindlichkeit von Gestaltungsrechten steht dem nicht entgegen. Der Arbeitgeber als Erklärungsempfänger hat den Eintritt der Bedingung selbst in der Hand. Die Ausübung eines Gestaltungsrechts unter einer solchen Potestativbedingung ist zulässig, da beim Erklärungsempfänger keine Unklarheit über den Bedingungseintritt vorliegt (BAG 15.04.2008 - 9 AZR 380/07 - Rz. 35, EzA § 15 BErzGG Nr. 17; vgl. auch BAG 05.06.2007 - 9 AZR 82/07 - Rz. 40, EzA § 15 BErzGG Nr. 16). Die Klägerin hätte es deshalb selbst in der Hand gehabt, ihr in ihrem Schreiben vom 05.01.2007 geäußertes Elternzeitverlangen von der gleichzeitig gewünschten Elternteilzeit abhängig zu machen. Damit aber liegt die Festlegung der Elternzeit ohne Erfüllung der in diesem Zeitraum gewünschten Teilzeitbeschäftigung in der Risikosphäre der Klägerin. | 66 |
|
II. Aus der Unbegründetheit des Klageantrags zu 1 folgt, wie die Vorinstanz zu Recht festgestellt hat, ohne weiteres, dass auch der Klageantrag zu 2 unbegründet ist. Denn mit ihm begehrt die Klägerin die tatsächliche Beschäftigung während der ihr nicht zustehenden Elternzeit in Teilzeit. |
67 |
|
III. Richtigerweise hat die Vorinstanz auch den Klageantrag zu 3 für unbegründet gehalten. Zur Begründung der Abweisung des im ersten Teil dieses Antrags geltend gemachten Teilzeitbeschäftigungsverlangens ist darauf hinzuweisen, dass, wie noch zum Klageantrag zu 4 darzustellen sein wird, die Klägerin gar keinen Anspruch auf eine auf 20 Stunden in der Woche reduzierte Arbeitszeit hat. Was die Abweisung des zweiten Teils des Klageantrags zu 3 betrifft, ist mit der Vorinstanz darauf hinzuweisen, dass mit dem Teilzeitverlangen nach § 16 Abs. 1 Satz 1 BEEG kein Ortswechsel (zeitweises Arbeiten zu Hause) verknüpft werden kann. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass sich die Berufungsbegründung der Klägerin überhaupt nicht mit der Argumentation der Vorinstanz hinsichtlich der Abweisung des Klageantrags zu 3 auseinander gesetzt hat. |
68 |
| B. | 69 |
|
Die Berufung der Beklagten, gegen deren Zulässigkeit keinerlei Bedenken bestehen, ist begründet. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz ist auch der Klageantrag zu 4 unbegründet. Denn das Teilzeitverlangen der Klägerin, wie sie es im Klageantrag zu 4 geäußert hat, ist wegen entgegenstehender Auffassung dringender betrieblicher Gründe i.S. von § 15 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 BEEG ausgeschlossen. |
70 |
|
(.Nach § 15 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 BEEG setzt der Anspruch auf Verringerung der Arbeitszeit während der Elternzeit das Fehlen entgegenstehender dringender betrieblicher Gründe voraus. An das objektive Gewicht der Ablehnungsgründe sind erhebliche Anforderungen zu stellen, wie der Begriff "dringend" verdeutlicht. Mit ihm wird ausgedrückt, dass eine Angelegenheit notwendig, erforderlich oder auch sehr wichtig ist. Die entgegenstehenden betrieblichen Interessen müssen mithin von erheblichen Gewicht sein. Sie müssen sich gleichsam als zwingende Hindernisse für die beantragte Verkürzung der Arbeitszeit darstellen (BAG 05.06.2007 - 9 AZR 82/07 - Rz. 48, EzA § 15 BErzGG Nr. 16; vgl. auch BAG 15.04.2008 - 9 AZR 380/07 - Rz. 29, EzA § 15 BErzGG Nr. 17). |
71 |
| II. Trotz der Aufnahme in den Katalog der Anspruchsvoraussetzungen obliegt die Darlegung der Tatsachen, aus denen sich die entgegenstehenden dringenden betrieblichen Gründe ergeben sollen, und deren Beweis dem Arbeitgeber. Es handelt sich um eine sog. negative Anspruchsvoraussetzung. Der Arbeitnehmer genügt seiner Darlegungslast bereits dann, wenn er behauptet, derartige entgegenstehende Gründe würden nicht bestehen (BAG 05.06.2007 - 9 AZR 82/07 - Rz. 49, a. a. 0.). | 72 |
| III. Der Vorinstanz kann nicht darin gefolgt werden, dass das Fehlen entgegenstehender dringender betrieblicher Gründe i. S. von § 15 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 BEEG daraus hergeleitet werden kann, dass während der Elternzeit der Klägerin ohne irgendeine Arbeitsleistung ihre Aufgaben durch andere Mitarbeiter mit erledigt worden sind. Aus dem Umstand, dass dem Anspruch auf Verringerung der Arbeitszeit keine dringenden betrieblichen Gründe entgegenstehen dürfen, kann nicht hergeleitet werden, die dringenden betrieblichen Gründe müssten der (vertraglichen) Arbeitszeitverringerung entgegenstehen. Entscheidend sind vielmehr die Folgen der Vereinbarung. Die Elternteilzeit lässt die Beschäftigungspflicht des Arbeitgebers während der Elternzeit mit der verringerten Arbeitszeit wieder aufleben. Nur dem können betriebliche Gründe entgegenstehen (BAG 15.04.2008 - 9 AZR 380/07 - Rz. 34, EzA § 15 BErzGG Nr. 17). | 73 |
|
IV.Entgegen der Auffassung der Vorinstanz ist vorliegend von einem unteilbaren Arbeitsplatz der Klägerin und damit von einem anerkannten entgegenstehenden betrieblichen Grund i. S. von § 15 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 BEEG (vgl. hierzu BAG 05.06.2007 - 9 AZR 82/07 - NZA 2007, 1352, 1356) auszugehen. |
74 |
|
1. Geht es um die sog. Unteilbarkeit des Arbeitsplatzes oder die Vereinbarkeit der gewünschten Teilzeitarbeit mit den betrieblichen Arbeitszeitmodellen, sind, wie die Vorinstanz zu Recht erkannt hat, die Tatsachen vorzutragen, die dem vom Bundesarbeitsgericht für die betrieblichen Ablehnungsgründe i. S. des § 8 TzBfG entwickelten Prüfungsmaßstab entsprechen. Dies folgt nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts aus der vergleichbaren Interessenlage beider Bestimmungen (vgl. BAG 05.06.2007 - 9 AZR 82/07 - a. a. 0.). Danach ist zunächst festzustellen, welches betriebliche Organisationskonzept der vom Arbeitgeber als erforderlich angesehenen Arbeitszeitregelung zugrunde liegt. Auf einer zweiten Stufe ist dann zu prüfen, inwieweit diese Arbeitszeitregelung dem Arbeitszeitverlangen des Arbeitnehmers tatsächlich entgegensteht. Dabei ist auch der Frage nachzugehen, ob durch eine dem Arbeitgeber zumutbare Änderung von betrieblichen Abläufen oder des Personaleisatzes die betrieblich erforderliche Arbeitszeitregelung und Wahrung des Organisationskonzepts mit dem individuellen Arbeitszeitwunsch des Arbeitnehmers zur Deckung gebracht werden kann. Können die beiderseitigen Interessen nicht in Einklang gebracht werden, ist zuletzt das objektive Gewicht der vom Arbeitgeber vorgetragenen Beeinträchtigung zu prüfen (vgl. nur BAG 08.05.2007 - 9 AZR 1112/06 - EzA § 8 TzBfG Nr. 18). Dringende betriebliche Belange i. S. von § 15 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 BEEG liegen nur vor, wenn sie der Verkürzung der Arbeitszeit als zwingende Hindernisse entgegenstehen (vgl. BAG 19.04.2005 - 9 AZR 233/04 - EzA § 15 BErzGG Nr. 15). |
75 |
|
2. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz ist im Streitfall vom Vorliegen eines Organisationskonzeptes der Beklagten auszugehen, das die Verringerung der von der Klägerin gewünschten Arbeitszeit auf 20 Wochenstunden, und zwar verteilt auf mittwochs und freitags jeweils acht Stunden und weitere vier Stunden unter der Woche ausschließt. |
76 |
| a) Nach dem Vorbringen der Beklagten setzt die Position der "Leiterin Controlling", die die Klägerin bekleidet, eine vollzeitige Anwesenheit der/des Arbeitnehmerin/-nehmers von Montag bis Freitag und gegebenenfalls darüber hinaus voraus. Dies gelte insbesondere für die zwingend erforderliche Teilnahme an regelmäßigen, täglichen und kurzfristigen im Voraus nicht planbaren Besprechungen mit den Geschäftsführern, Niederlassungsleitern, Abteilungsleitern, Projektverantwortlichen, den Gesellschaftern und Bereichsleiterin von P. Germany und P. Luxemburg, den Mitarbeitern der Klägerin u. a., sowie den durchzuführenden Dienstreisen im gesamten Bundesgebiet und das angrenzende europäische Ausland. Darüber hinaus erfordert nach Angaben der Beklagten die stufenweise Verlegung des Controlling von F. nach C. aufgrund des mit Wirkung vom 24.10.2007 gefassten Entschlusses der Beklagten, die Hauptverwaltung inF. bis spätestens zum 30.06.2008 zu schließen, aus den in ihrer Berufungsbegründung genannten Gründen (Seite 6 und 7) die tägliche Anwesenheit der Klägerin in Vollzeit. | 77 |
| b) Die Klägerin, die dieses Vorbringen zu Unrecht als unsubstantiiert bezeichnet, räumt selbst die Notwendigkeit ihrer Anwesenheit im Betrieb der Beklagten über 20 Wochenstunden hinaus und damit zugleich die Unteilbarkeit ihres Arbeitsplatzes zumindest indirekt ein. Sie meint nämlich "selbstverständlich" könnten Besprechungen, Meetings etc. so abgestimmt werden, dass ihre Anwesenheit, soweit erforderlich, auch außerhalb der von ihr gewünschten zwei Anwesenheitstage sichergestellt sei. Für diesen Fall würde sie eine Kinderbetreuung für ihren Sohn organisieren. Auch sei sie bereit, über die Anzahl von 20 Stunden hinaus ihre Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen, wenn z. B. eine Projektarbeit am Stück dies erforderlich mache oder nicht aufschiebbare Aufgabenstellungen anstehen würden. | 78 |
| c) Dies alles steht aber einem Teilzeitverlangen, das zu keiner unzumutbaren Einschränkung der Planungssicherheit des Arbeitgebers führen darf (vgl. BAG 19.04.2005 - 9 AZR 233/04 - a. a. 0.), entgegen. Die Beklagte müsste nämlich, wenn sie die Klägerin außerhalb der von ihr begehrten Anwesenheitszeiten benötigt, zunächst fragen, ob sie für diesen Einsatz tatsächlich eine Kinderbetreuung organisiert bekommt. Auch hat die Klägerin ihre Anwesenheit außerhalb der von ihr gewünschten Teilzeit unter den Vorbehalt der Erforderlichkeit gestellt. Es ist nicht auszuschließen, dass hierüber Streit zwischen den Parteien entsteht und die Beklagte, insbesondere wenn sie die Klägerin kurzfristig benötigt, kaum die zu erledigende Arbeit anderweitig verteilen kann. | 79 |
| d) Soweit die Klägerin bezüglich der stufenweisen Verlegung des Controlling von F. nach C. darauf hinweist, es sei der Beklagten möglich gewesen, mit ihr, da sie grundsätzlich zu flexiblen Lösungen bereit sei, auch eine Vereinbarung zu treffen, die Tätigkeiten an verschiedenen Standorten vorgesehen hätte, ist ihr entgegenzuhalten, dass es vorliegend, wie auch schon die Vorinstanz in anderem Zusammenhang ausgeführt hat, nicht um die Änderung ihres Einsatzortes, sondern ausschließlich um die Reduzierung von Arbeitszeit geht. Aus diesem Grund ist auch ihre Bereitschaft, die Tätigkeiten von Herrn D. auszuführen, unerheblich. | 80 |
| C. | 81 |
| Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO i. V. m. § 64 Abs. 6 Satz 1 ArbGG. | 82 |
|
Die Kammer hat der Rechtssache grundsätzliche Bedeutung zugemessen und deshalb für die Klägerin die Revision an das Bundesarbeitsgericht gemäß § 72 Abs. 1 Nr. 1 ArbGG zugelassen. |
83 |
| […] | |
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gern:
 |
Dr. Martin Hensche Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hensche@hensche.de |
 |
Christoph Hildebrandt Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hildebrandt@hensche.de |
 |
Nina Wesemann Rechtsanwältin Fachanwältin für Arbeitsrecht Kontakt: 040 / 69 20 68 04 wesemann@hensche.de |