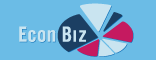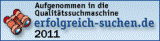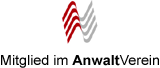- -> zur Mobil-Ansicht
- Arbeitsrecht aktuell
- Tipps und Tricks
- Handbuch Arbeitsrecht
- Gesetze zum Arbeitsrecht
- Urteile zum Arbeitsrecht
- Urteile 2023
- Urteile 2021
- Urteile 2020
- Urteile 2019
- Urteile 2018
- Urteile 2017
- Urteile 2016
- Urteile 2015
- Urteile 2014
- Urteile 2013
- Urteile 2012
- Urteile 2011
- Urteile 2010
- Urteile 2009
- Urteile 2008
- Urteile 2007
- Urteile 2006
- Urteile 2005
- Urteile 2004
- Urteile 2003
- Urteile 2002
- Urteile 2001
- Urteile 2000
- Urteile 1999
- Urteile 1998
- Urteile 1997
- Urteile 1996
- Urteile 1995
- Urteile 1994
- Urteile 1993
- Urteile 1992
- Urteile 1991
- Urteile bis 1990
- Arbeitsrecht Muster
- Videos
- Impressum-Generator
- Webinare zum Arbeitsrecht
-
Kanzlei Berlin
 030 - 26 39 62 0
030 - 26 39 62 0
 berlin@hensche.de
berlin@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Frankfurt
 069 - 71 03 30 04
069 - 71 03 30 04
 frankfurt@hensche.de
frankfurt@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hamburg
 040 - 69 20 68 04
040 - 69 20 68 04
 hamburg@hensche.de
hamburg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hannover
 0511 - 89 97 701
0511 - 89 97 701
 hannover@hensche.de
hannover@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Köln
 0221 - 70 90 718
0221 - 70 90 718
 koeln@hensche.de
koeln@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei München
 089 - 21 56 88 63
089 - 21 56 88 63
 muenchen@hensche.de
muenchen@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Nürnberg
 0911 - 95 33 207
0911 - 95 33 207
 nuernberg@hensche.de
nuernberg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Stuttgart
 0711 - 47 09 710
0711 - 47 09 710
 stuttgart@hensche.de
stuttgart@hensche.de
AnfahrtDetails
LAG Baden-Württemberg, Urteil vom 02.12.2010, 22 Sa 59/10
| Schlagworte: | Urlaub: Krankheit, Krankheit: Urlaub, Urlaubsabgeltung | |
| Gericht: | Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg | |
| Aktenzeichen: | 22 Sa 59/10 | |
| Typ: | Urteil | |
| Entscheidungsdatum: | 02.12.2010 | |
| Leitsätze: | ||
| Vorinstanzen: | Arbeitsgericht Freiburg, Urteil vom 22.06.2010, 7 Ca 63/10 | |
Landesarbeitsgericht
Baden-Württemberg -
Kammern Freiburg
Verkündet
am 02.12.2010
Aktenzeichen:
22 Sa 59/10
7 Ca 63/10 (ArbG Freiburg
- Kn. Villingen-Schwenningen) (Bitte bei allen Schreiben angeben!)
Göde
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
Im Namen des Volkes
Urteil
In dem Rechtsstreit
- Beklagte/Berufungsklägerin -
Proz.-Bev.: Rechtsanwälte
gegen
- Klägerin/Berufungsbeklagte -
Proz.-Bev.:
hat das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg
- Kammern Freiburg - 22. Kammer -
durch die Richterin am Arbeitsgericht Dr. Schmiegel,
den ehrenamtlichen Richter Bauer
und den ehrenamtlichen Richter Hilmes
auf die mündliche Verhandlung vom 25.10.2010für Recht erkannt:
1. Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Arbeitsgerichts Freiburg - Kammern Villingen-Schwenningen - vom 22.06.2010, Az. 7 Ca 63/10 abgeändert.
Die Klage wird abgewiesen.
Die Klägerin wird verurteilt, an die Beklagte 5.740,80 € zu bezahlen.
2. Die Klägerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.
3. Die Revision wird zugelassen.
- 2 -
Tatbestand
Die Parteien streiten um die Abgeltung von Urlaubsansprüchen.
Die Klägerin war vom 15.03.1997 bis 31.07.2009 als Fachverkäuferin bei der Beklagten be-schäftigt. Sie erhielt zuletzt einen Stundenlohn von 9,20 € brutto. Die Wochenarbeitszeit betrug 39 Stunden, wobei zwischen den Parteien streitig ist, ob die Klägerin jeweils an sechs Tagen 6,5 Stunden arbeitete oder an fünf Tagen 7,8 Stunden.
Nach dem Arbeitsvertrag der Parteien vom 20.03.1997 (AS 1/26 f) galten im Arbeitsverhältnis der Parteien die jeweils gültigen Bestimmungen des Manteltarifvertrags für das Bäckerhandwerk in Baden-Württemberg. Es wurde ausdrücklich geregelt, dass bei tarifvertragslosem Zustand bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrags die Bestimmungen des alten Tarifvertrags als vereinbart gelten.
In dem hier maßgeblichen Manteltarifvertrag in der Fassung vom 12.12.1991 (im Folgenden MTV) heißt es:
㤠11 Urlaub
1. Jeder Arbeitnehmer hat in jedem Kalenderjahr (= Urlaubsjahr) Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub, soweit ihm nicht für das laufende Kalenderjahr von einem anderen Arbeitgeber Urlaub gewährt wurde.
3. Im Laufe des Kalenderjahres eintretende oder ausscheidende Arbeitnehmer haben Anspruch auf anteiligen Urlaub, soweit sie anspruchsberechtigt sind (vgl. Ziffer 4.). Der Anspruch beträgt für jeden vollen Monat des Arbeitsverhältnisses ein Zwölftel des Jahresurlaubs. Bruchteile von Urlaubstagen, die mindestens einen halben Tag ergeben, sind auf volle Tage aufzurunden. Scheidet ein Arbeitnehmer nach erfüllter Wartezeit in der zweiten Jahreshälfte aus, so hat er Anspruch auf den gesetzlichen Jahresurlaub (Bundesurlaubsgesetz 18 Werktage).
6. Der Urlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen werden. Die Übertragung des Urlaubs auf das nächste Kalenderjahr ist statthaft, wenn dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe dies rechtfertigen. Im Falle der Übertragung ist der Urlaub in den ersten drei Monaten des folgenden Jahres geltend zu machen und zu gewähren. Der Urlaubsanspruch erlischt am 31. März, sofern er nicht vorher erfolglos geltend gemacht worden ist....
12. Das Urlaubsentgelt bemisst sich nach dem durchschnittlichen Arbeitsverdienst, den der Arbeitnehmer in den letzten abgerechneten drei Monaten - bei wöchentlicher Lohnzahlung in den letzten dreizehn Wochen - vor Beginn des Urlaubs erhalten hat. ...
14. Kann der Urlaub wegen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ganz oder teilweise nicht genommen werden, so ist er abzugelten....
18. ... Ab 1.1.2006 erhalten alle Arbeitnehmer 36 Werktage Urlaub.
21. Für die Arbeitnehmer, die regelmäßig an weniger als sechs Werktagen in der Woche beschäftigt werden, ist der Urlaubsanspruch in solchen nach Arbeitstagen umzurechnen.
- 3 -
Die Berechnungsformel lautet: Urlaubsanspruch in Werktagen x Zahl der Arbeitstage je Woche / 6....
§ 21 Ausschlussfristen.
Alle gegenseitigen Ansprüche sind innerhalb einer Frist von 6 Wochen nach Entstehen schriftlich geltend zu machen. Nach Ablauf dieser Frist ist die Geltendmachung dieser Ansprüche ausgeschlossen."
Die Klägerin erhielt ab 10.10.2007 Rente wegen voller Erwerbsminderung. Gemäß dem Bescheid der Deutschen Rentenversicherung vom 11.03.2008 (Anlage K1, AS 1/20) war die Rente befristet und sollte mit dem 28.02.2009 enden. Nach einem weiteren Bescheid der Deutschen Rentenversicherung vom 16.10.2008 wurde die mit Bescheid vom 03.03.2008 gewährte Versichertenrente als Dauerrente weitergewährt (Anlage K2, AS 1/21). Die Klägerin war während des Bezugs der Rente und über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus arbeitsunfähig krank.
Die Klägerin erhielt für die Jahre 2007 bis 2009 keinen Urlaub. Am 19.02.2009 forderte der Klägervertreter die Beklagtenseite auf, die der Klägerin noch zustehende Urlaubsabgeltung für die Kalenderjahre 2007 und 2008 abzurechnen und auszuzahlen (AS 11/43).
Mit der vorliegenden Klage hat die Klägerin die Abgeltung von je 30 Arbeitstagen für die Jahre 2007 bis 2009 (bezogen auf eine Fünf-Tage-Woche) geltend gemacht. Sie hat gemeint, dass nach der für die Parteien geltenden Urlaubsregelung nicht zwischen dem gesetzlichen Mindesturlaubsanspruch und dem zusätzlichen Urlaubsanspruch nach TarifvertragNertrag zu unter-scheiden sei.
Die Klägerin hat beantragt:
Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin € 7.066,97 brutto nebst Zinsen i. H. v. fünf Pro-zentpunkten über den Basiszinssatz der EZB hieraus seit der Rechtshängigkeit der Klage zu bezahlen.
Die Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen.
Die Beklagte hat vorgetragen, in den Zeiten ihrer Erwerbsunfähigkeit habe die Klägerin keinen Urlaubsanspruch erworben; das Arbeitsverhältnis habe wegen des Bezugs von Rente wegen voller Erwerbsminderung geruht. Die Rechtsprechung des EuGH zur Urlaubsabgeltung nach Arbeitsunfähigkeit sei auf die Fälle des Bezugs von unbefristeter Erwerbsunfähigkeitsrente nicht übertragbar. Urlaubsansprüche könnten nicht über mehrere Jahre angesammelt werden. Die Klägerin könne allenfalls die Abgeltung des gesetzlichen Urlaubs verlangen.
- 4 -
Die Klage wurde der Beklagten am 12.02.2010 zugestellt. Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf das Urteil des Arbeitsgerichts Freiburg - Kammern Villingen-Schwenningen - vom 22.06.2010 Bezug genommen.
Durch dieses Urteil hat das Arbeitsgericht der Klage in Höhe von 5.740,80 € nebst Zinsen stattgegeben. Zur Begründung hat es ausgeführt, die Klägerin könne die Abgeltung von 80 Urlaubs-tagen ä 71,76 € brutto verlangen. Auch während des Zeitraums der vollen Erwerbsminderung seien Urlaubsansprüche entstanden. Die Erwerbsunfähigkeit auf Zeit führe nicht per se zum Ruhen des Arbeitsverhältnisses. Da der Urlaubsanspruch nicht im Gegenseitigkeitsverhältnis zur Erbringung der Arbeitsleistung stehe, hätte selbst ein Ruhen keinen Einfluss auf die Entstehung des Anspruchs. Gemäß § 11 Nr. 3 MN stünden der Klägerin für das Jahr 2009 nur 20 Urlaubstage (bezogen auf eine Fünf-Tage-Woche) zu. Der Urlaubsanspruch sei nicht verfallen, da die Klägerin nicht in der Lage gewesen sei, den Urlaub zu nehmen. Mangels Differenzierung gelte dies nicht nur für den gesetzlichen Urlaub, sondern auch für den darüber hinaus gehenden Urlaubsanspruch.
Das Urteil wurde der Beklagten am 01.07.2010 zugestellt. Am 15.07.2010 forderte der Klägervertreter die Beklagtenseite zur Zahlung auf. Daraufhin zahlte die Beklagte den titulierten Betrag an die Klägerin, ohne dass diese zuvor die Zwangsvollstreckung betrieben hatte.
Die Beklagte legte am 15.07.2010 Berufung ein, die sie am 23.08.2010 begründete.
Sie hat in der Berufung vorgetragen, die Entscheidung des EuGH vom 20.01.2009 sei auf den Fall, dass das Arbeitsverhältnis wegen des Bezugs von Erwerbsunfähigkeitsrente geruht hat, nicht anwendbar. Anders als bei einer länger andauernden Erkrankung könne das Arbeitsverhältnis nicht jederzeit wieder aufgenommen werden, sondern würden die Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis von vornherein vollständig ausgesetzt. Ein etwaiger Abgeltungsanspruch setze voraus, dass der Arbeitnehmer grundsätzlich in der Lage wäre, seinen Urlaub tatsächlich in Anspruch zu nehmen. Art. 7 der Richtlinie 2003/88/EG rechtfertige keine Ansammlung von Urlaubsansprüchen über mehrere Jahre hinweg. Die Beklagte beruft sich - in zweiter Instanz erstmals - auf die Ausschlussfrist nach § 21 MN sowie auf Verjährung. Sie meint, die Verfallfrist und die Verjährungsfrist begönnen mit dem Ablauf des Übertragungszeitraums. Die Beklagte behauptet, sie habe die Zahlung auf die titulierte Forderung zur Abwendung der Zwangsvollstreckung geleistet.
- 5 -
Die Beklagte beantragt nunmehr:
1. Das Urteil des Arbeitsgerichts Freiburg 7 Ca 63/2010 vom 22.06.2010 wird aufgehoben und die Klage abgewiesen.
2. Die Klägerin wird verurteilt, an die Beklagte den aus dem Urteil 7 Ca 63/2010 vollstreckten Betrag in Höhe von 5.740,80 € zurückzubezahlen.
Die Klägerin beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Die Klägerin meint, hinsichtlich des Urlaubsanspruchs bestehe kein Unterschied zwischen einer Dauererkrankung und einer durch eine Dauererkrankung bedingte, mit befristeter Wirkung festgestellte Erwerbsunfähigkeit. Die Entscheidung des EuGH vom 20.01.2009 sei auf den vorliegenden Sachverhalt übertragbar. Der Rentenbezug berühre weder den Bestand des Arbeitsverhältnisses noch die Verpflichtung zur Gewährung von Urlaub. Auch wenn ein Arbeitnehmer in einem Kalenderjahr überhaupt nicht arbeitet, stehe ihm ein Urlaubsanspruch zu. Es komme nicht darauf an, ob die Klägerin zum Zeitpunkt ihres Ausscheidens arbeitsfähig war. Der Anwendbarkeit der tarifvertraglichen Verfallklausel stünde Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2003/88 als zwingendes Arbeitnehmerschutzrecht entgegen. Die Berufung auf die Verfallklausel und die Verjährung sei verspätet. Da die Beklagte die Zahlung aus freien Stücken geleistet habe, könne sie keine Rückzahlung verlangen.
Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf den Inhalt der gewechselten Schriftsätze sowie auf die Protokolle über die mündlichen Verhandlungen verwiesen (§ 313 Abs. 2 S. 2 ZPO).
Entscheidungsgründe
I.
Die Berufung der Beklagten ist statthaft, da der Wert des Beschwerdegegenstandes 600,00 € übersteigt, § 64 Abs. 2 lit. b ArbGG. Die Berufung ist auch zulässig. Sie wurde frist- und form-gerecht eingelegt und begründet, §§ 66 Abs. 1 S. 1, 64 Abs. 6 S. 1 ArbGG in Verbindung mit §§ 519, 520 ZPO. Insbesondere setzt sich die Berufung hinreichend mit den Gründen auseinander, aufgrund derer das Arbeitsgericht der Klage teilweise stattgegeben hat.
- 6 -
II.
Die Klage ist zulässig und in vollem Umfang begründet. Die Beklagte ist nicht zur Abgeltung von Urlaubsansprüchen verpflichtet.
Zwar entstanden auch während des Bezugs der Rente wegen voller Erwerbsminderung Ur-laubsansprüche der Klägerin (1.). Sie verfielen während des Bestands des Arbeitsverhältnisses weder zum Ende des Übertragungszeitraums (2.) noch aufgrund Verjährung oder Ausschlussfrist (3.). Trotz fortbestehender Arbeitsunfähigkeit konnte die Klägerin bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses die Abgeltung dieser Urlaubsansprüche verlangen (4.). Jedoch verfielen die Abgeltungsansprüche nach § 21 MTV (5.). Soweit die Beklagte bereits Urlaubsabgeltung für das Jahr 2009 an die Klägerin gezahlt hat, muss die Klägerin dies zurückzahlen (6.).
1. Gemäß § 11 Abs. 1 MW, § 1 BUrIG hatte die Klägerin für jedes Kalenderjahr Anspruch auf bezahlten Urlaub.
a) Der Urlaubsanspruch für das Jahr 2007 entstand am 01.01.2007 in voller Höhe. Die Ar-beitsunfähigkeit der Klägerin und der Bezug von Rente wegen Erwerbsminderung berührten folglich das Entstehen des Anspruchs ohnehin nicht.
b) Aber auch der Urlaubsanspruch für die Jahre 2008 und 2009 entstand ungeachtet des Rentenbezugs. Das Entstehen des Urlaubsanspruchs setzt lediglich das Bestehen des Arbeitsverhältnisses voraus, nicht aber, dass der Arbeitnehmer im laufenden Kalenderjahr arbeitet oder arbeitsfähig ist (BAG 24.03.2010 - 9 AZR 983/07 unter B I). Der Bezug der Rente wegen Erwerbsminderung ändert daran nichts. Der Rentenbezug ist ein sozialversicherungsrechtlicher Sachverhalt (§ 43 SGB VI), der keine Auswirkungen auf den Bestand oder den Inhalt des Arbeitsverhältnisses der Parteien hat.
Insbesondere führte weder die andauernde Arbeitsunfähigkeit noch der Rentenbezug zum Ruhen des Arbeitsverhältnisses. Das Ruhen eines Arbeitsverhältnisses ist nicht Folge der Arbeitsunfähigkeit bzw. Erwerbsminderung, sondern setzt eine entsprechende Vereinbarung der Parteien über die Suspendierung der wechselseitigen Hauptpflichten unter Aufrechterhaltung des Arbeitsverhältnisses voraus (BAG 11.10.1995 - 10 AZR 985/94 unter II 3 a; Personalbuch 2010IReinecke, Stichwort „Erwerbsminderung", Rn. 2). Eine solche Vereinbarung haben die Parteien weder ausdrücklich noch konkludent getroffen. Die Klägerin war durchgehend arbeitsunfähig krank und schon allein deshalb nicht zur Arbeitsleistung verpflichtet. Es gibt keinen Sachverhalt, der als konkludente Vereinbarung ausgelegt werden könnte. Über den Rentenbezug hinaus gibt es keine Umstände, aus denen sich ergeben könnte, dass das rechtlich an sich fortbestehende Arbeitsverhältnis tatsächlich
- 7 -
nur formaler Natur sein und nach dem Willen und den Vorstellungen beider Parteien keine irgendwie gearteten rechtlichen Bindungen im Hinblick auf eine Wiederaufnahme der Arbeit begründen soll (zu dieser Voraussetzung BAG 11.10.1995 - 10 AZR 985/94 unter II 3 c). § 33 Abs. 2 S. 6 TVöD oder eine vergleichbare Vorschrift, die das Ruhen des Arbeitsverhältnisses anordnet, gilt im Arbeitsverhältnis der Parteien nicht.
Da das Arbeitsverhältnis der Parteien nicht ruhte, kann dahinstehen, wie sich ein Ruhen auf die Urlaubsansprüche auswirkt (dazu LAG Baden-Württemberg 29.04.2010 - 11 Sa 64/09 unter 1 b einerseits, LAG Köln 29.04.2010 - 6 Sa 103/10 andererseits).
2. Dass der Urlaubsanspruch gemäß § 11 Abs. 6 S. 2 MW, § 7 Abs. 3 S. 2 BUrIG aus Gründen, die in der Person der Klägerin liegen, übertragen werden konnte, steht zwischen den Parteien außer Streit. Der Urlaubsanspruch ist entgegen § 11 Abs. 6 S. 4 MW auch nicht zum Ende des Übertragungszeitraums (= 31.03. des Folgejahrs) erloschen:
Entsprechend dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 24.03.2009 (9 AZR 983/07 unter B III 3 a gg) ist § 7 Abs. 3 BUrIG richtlinienkonform dahin auszulegen, dass die zeitlichen Beschränkungen des Urlaubsanspruchs im Fall der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit bis zum Ende des Bezugs- und/oder Übertragungszeitraums nicht bestehen. Mit dieser Auslegung lässt sich § 7 Abs. 3 BUrIG mit Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2003/88/EG vereinbaren. Diese Richtlinie steht nämlich einzelstaatlichen Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten entgegen, nach denen der Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub bei Ablauf des Bezugszeitraums und/oder eines im nationalen Recht festgelegten Übertragungszeitraums auch dann erlischt, wenn der Arbeitnehmer während des gesamten Bezugszeitraums oder eines Teils davon krankgeschrieben war und seine Arbeitsunfähigkeit bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses fortbestand, weshalb er seinen Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub nicht ausüben konnte (EuGH 20.01.2009 - C-350/06, C-520/06). Es entspricht Wortlaut, Systematik und Zweck der innerstaatlichen Regelungen, wenn die Ziele des Art. 7 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2003/88/EG und der regelmäßig anzunehmende Wille des nationalen Gesetzgebers zur ordnungsgemäßen Umsetzung von Richtlinien berücksichtigt werden (näher zur richtlinienkonformen Rechtsfortbildung durch teleologische Reduktion BAG 24.03.2009 ¬9 AZR 983/07). Die richtlinienkonforme Auslegung gilt in gleicher Weise für § 11 Abs. 6 MTV.
Ausgehend von dieser Rechtslage sind die Urlaubsansprüche der Klägerin nicht erloschen. Die Klägerin war spätestens ab Herbst 2007 durchgängig arbeitsunfähig krank und deshalb nicht in der Lage, ihre Urlaubsansprüche zu realisieren. Dies ist die Situation, in der die Urlaubsansprüche nicht mit dem Ende des Übertragungszeitraums erlöschen. Der Bezug der
- 8 -
Rente wegen Erwerbsminderung hat auch hier gar keine Auswirkung auf die Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis.
3. Während des Bestands des Arbeitsverhältnisses sind die Ansprüche weder verfallen noch verjährt.
Es kann dahinstehen, ob an der bisherigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (20.01.2009 - 9 AZR 650/07 unter A II 1 b dd; 21.06.2005 - 9 AZR 200/04 unter II 4 d aa) festzuhalten ist, wonach Verjährungs- und Ausschlussfristen auf Urlaubsansprüche im bestehenden Arbeitsverhältnis generell keine Anwendung finden. In der konkreten Situation der Parteien greifen während des Laufs des Arbeitsverhältnisses weder Verjährungs- noch Ausschlussfristen:
a) Nach § 21 MTV sind alle gegenseitigen Ansprüche binnen 6 Wochen nach ihrem Entstehen schriftlich geltend zu machen; nach Ablauf dieser Frist ist die Geltendmachung dieser Ansprüche ausgeschlossen. Diese Ausschlussfrist findet im bestehenden Arbeitsverhältnis auf Urlaubsansprüche keine Anwendung. Sie beginnt weder mit dem Beginn noch mit dem Ende des Urlaubsjahrs bzw. dem Ablauf des Übertragungszeitraums:
- Der Urlaubsanspruch entsteht nach erfüllter Wartezeit jeweils mit Beginn des Urlaubsjahres (BAG 11.07.2006 - 9 AZR 535/05 unter 1 2 b bb). Allerdings sind die Arbeitnehmer nicht gehalten, den Urlaubsanspruch in den ersten sechs Wochen des Kalenderjahres geltend zu machen, sondern ist der Urlaub im gesamten Kalenderjahr zu gewähren (§ 7 Abs. 3 S. 1 BUrIG, § 11 Abs. 6 S. 1 MTV).
- Das Ende des Urlaubsjahrs berührt den Urlaubsanspruch der Klägerin für die Jahre 2007 und 2008 nicht, da der Urlaubsanspruch aus Gründen, die in der Person der Klägerin liegen, auf das gesamte erste Quartal des Folgejahres übertragen wird (§ 7 Abs. 3 S. 2 und 3 BUrIG, § 11 Abs. 6 S. 2 und 3 MTV).
- Schließlich oblag es der Klägerin nicht, den Urlaubsanspruch binnen sechs Wochen nach Ablauf des Übertragungszeitraums geltend zu machen. In diesem Zeitraum konnte der Urlaubsanspruch wegen der Arbeitsunfähigkeit der Klägerin nämlich gar nicht erfüllt werden. Aufgrund der fortdauernden Arbeitsunfähigkeit entfaltet das Ende des Übertragungszeitraums gar keine Wirkung auf den Urlaubsanspruch, an die die Ausschlussfrist anknüpfen könnte. Die Geltendmachung eines Abgeltungsanspruchs schied zum damaligen Zeitpunkt ebenfalls aus, da der Urlaubsanspruch nur bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses, nicht aber im laufenden Arbeitsverhältnis abzugelten ist (§ 7 Abs. 4 BUrIG, § 11 Abs. 14 S. 1 MTV).
- 9 -
Die Frage, ob die Verfallfrist im Zeitpunkt der Wiedergenesung zu laufen beginnt (so Gaul/Josten/Strauf, BB 2009, 497, [499]; Picker, ZTR 2009, 230, 239; Bauer, NJW 2009, 631, 635; Schlachter, RdA Beilage 2009, 36) kann hier offen bleiben, da die Klägerin bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses arbeitsunfähig krank blieb.
b) Aus den gleichen Gründen kommt auch eine Verjährung des Urlaubsanspruchs im bestehenden Arbeitsverhältnis nicht in Betracht.
Selbst wenn man aber der gegenteiligen Auffassung des LAG Düsseldorf (18.08.2010 - 12 Sa 650/10) folgen möchte, wonach die Verjährung des Urlaubsanspruchs mit dem Schluss des Urlaubsjahres beginnt, ist der Anspruch nicht verjährt: Die Verjährung betrüge gemäß § 195 BGB drei Jahre und begänne frühestens mit Schluss des Urlaubsjahres, für den Urlaubsanspruch aus 2007 also am 31.12.2007. Die Erhebung der Klage am 12.02.2010 hemmte eine etwaige Verjährung (§ 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB, § 253 Abs. 1 ZPO) zu einem Zeitpunkt, als die dreijährige Verjährungsfrist noch nicht abgelaufen war.
c) Schließlich ist der Urlaubsanspruch nicht gemäß Art. 9 Abs. 1 des Übereinkommens Nr. 132 der Internationalen Arbeitsorganisation vom 24.06.1970 über den bezahlten Jahresurlaub verfallen. Nach dieser Vorschrift ist der Teil des Jahresurlaubs, der mindestens zwei ununterbrochene Arbeitswochen umfasst, spätestens ein Jahr und der übrige Teil spätestens 18 Monate nach Ablauf des Urlaubsjahres zu gewähren und zu nehmen. Selbst wenn der Verfall des Urlaubsanspruchs aufgrund des IAO-Übereinkommens auch im Fall langandauernder Arbeitsunfähigkeit europarechtlich zulässig sein mag (vgl. dazu den Vorlagebeschluss des LAG Hamm vom 15.04.2010 - 16 Sa 1176/09), fehlt es im nationalen Recht an einer Norm, die den Verfall anordnet. Arta 9 Abs. 1 des IAO-Übereinkommens Nr. 132 ist eine völkerrechtliche Norm, die im nationalen Recht nicht unmittelbar anwendbar ist. Die Bundesrepublik Deutschland hat dem Übereinkommen zwar durch Gesetz vom 30.04.1975 zugestimmt. Hierdurch ist das Übereinkommen aber nicht innerstaatliches Recht in dem Sinne geworden, dass seine Vorschriften normativ auf alle Arbeitsverhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland einwirken. Es gibt kein innerstaatliches Gesetz, das die Vorgaben des Übereinkommens insofern ausführt und subjektive Rechte und Pflichten einzelner begründet (BAG vom 07.12.1993 - 9 AZR 683/92).
4. Gemäß § 7 Abs. 4 BUrIG, § 11 Abs. 14 S. 1 MTV war der Urlaubsanspruch, der der Klägerin bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses zustand und der ihr wegen der Beendigung nicht mehr gewährt werde konnte, bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses abzugelten.
- 10 -
Die Urlaubsabgeltung setzt nicht voraus, dass der Urlaub im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses gewährt werden kann. Der Anspruch auf Urlaubsabgeltung entsteht nämlich mit dem Ende des Arbeitsverhältnisses als reiner Geldanspruch. Diese auf eine finanzielle Vergütung im Sinne von Art. 7 Abs. 2 der sog. Arbeitszeitrichtlinie 2003/88/EG gerichtete Forderung bleibt in ihrem Bestand unberührt, wenn die Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers bis zum Ende des Übertragungszeitraums am 31. März des dem Urlaubsjahr folgenden Jahres fortdauert (BAG 04.05.2010 - 9 AZR 183/09; LAG Baden-Württemberg 29.04.2010 - 11 Sa 64/09 unter 3 a). Das Bundesarbeitsgericht hat die früher vertretene Surrogatstheorie aufgegeben (BAG 24.03.2009 - 9 AZR 983/07). Es kommt deshalb nicht darauf an, dass die Klägerin über den 31.07.2009 hinaus arbeitsunfähig krank war.
5. Der Urlaubsabgeltungsanspruch ist allerdings gemäß § 21 MTV verfallen.
a) Die Aufgabe der Surrogatstheorie führt zugleich dazu, dass der Urlaubsabgeltungsanspruch den Verjährungs- und Ausschlussfristen unterfällt. Der Urlaubsabgeltungsanspruch entsteht als eigenständiger Anspruch mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Er wird von den Fristen, die für den Urlaubsanspruch gelten, nicht berührt. Statt dessen handelt es sich um einen „normalen" Zahlungsanspruch, der den allgemein geltenden Fristen unterfällt (LAG Berlin-Brandenburg 07.10.2010 unter 2.3; LAG München 29.07.2010 - 3 Sa 217/10 unter II 2 a, b; LAG Köln 20.04.2010 - 12 Sa 1448/09 unter 13; Gaul/Josten/Strauf, BB 2009, 497, 499).
b) Die Ausschlussfrist des § 21 MTV ist kraft vertraglicher Bezugnahme im Arbeitsverhältnis der Parteien anwendbar. Da es sich um eine tarifliche Ausschlussfrist handelt und auf den gesamten Tarifvertrag Bezug genommen wird, unterliegt die Ausschlussfrist keiner Inhaltskontrolle gemäß § 307 BGB (§§ 310 Abs. 4 S. 3, 307 Abs. 3 BGB).
c) Die Berücksichtigung der Ausschlussfrist ist nicht deshalb ausgeschlossen, weil die Beklagte sich erst in der Berufungsbegründung darauf berufen hat. Abgesehen davon, dass die Anwendbarkeit des Tarifvertrags bereits erstinstanzlich unstreitig war, konnte die Beklagte in der Berufungsbegründung neuen Vortrag leisten (§ 72 Abs. 4 S. 1 ArbGG). Die Berufung auf die Ausschlussfrist verzögerte den Rechtsstreit nicht.
d) Die Klägerin hat den Anspruch auf Abgeltung des Urlaubs für das Jahr 2009 erstmals mit der Erhebung der Klage am 12.02.2010 geltend gemacht. Zu diesem Zeitpunkt war die Ausschlussfrist von sechs Wochen, berechnet ab Beendigung des Arbeitsverhältnisses (31.07.2009) bereits abgelaufen.
- 11 -
Auch der Anspruch auf Abgeltung des Urlaubs der Jahre 2007 und 2008 ist gemäß § 21 MTV verfallen:
Zwar machte die Klägerin diese Ansprüche durch das Schreiben vom 19.02.2009 geltend. Zu diesem Zeitpunkt war der Urlaubsabgeltungsanspruch noch nicht entstanden. Nach Aufgabe der Surrogatstheorie können der Anspruch auf Urlaubsgewährung im bestehenden Arbeitsverhältnis und der Anspruch auf Urlaubsabgeltung im beendeten Arbeitsverhältnis nicht einheitlich betrachtet werden. Der Urlaubsabgeltungsanspruch entstand erst mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zum 31.07.2009 (vgl. BAG 23.03.2010 - 9 AZR 128/09).
Die Geltendmachung eines Anspruchs vor seinem Entstehen wahrt die Ausschlussfrist nicht (BAG 09.03.2005 - 5 AZR 385/02 unter III 1 a; 16.06.2010 - 4 AZR 924/08 unter II 1 b bb). Eine Geltendmachung vor dem Entstehen des Anspruchs widerspräche dem Zweck der Ausschlussfrist. Sind die rechtserzeugenden Tatsachen nach der Behauptung des Anspruchstellers noch nicht eingetreten, ist ungewiss, ob und ggf. wann und in welchem Umfang Ansprüche überhaupt entstehen. Im Zeitpunkt der Geltendmachung konnte der Urlaubsabgeltungsanspruch nicht erfüllt werden. Es war zum damaligen Zeitpunkt nicht bekannt, wann das Arbeitsverhältnis enden würde und welche Höhe der Urlaubsabgeltungsanspruch im Zeitpunkt der Beendigung haben würde. Beispielsweise hätten sich etwaige Gehaltserhöhungen im Zeitraum zwischen der Geltendmachung und der Beendigung des Arbeitsverhältnisses noch auf die Höhe der Urlaubsabgeltungsansprüche für die abgelaufenen Jahre auswirken können. Der Zweck der Ausschlussfrist, zu einer raschen Klärung von Ansprüchen beizutragen, kann durch eine Geltendmachung vor Entstehen des Anspruchs nicht erfüllt werden.
e) Die Klägerin kann sich nicht auf Vertrauensschutzgesichtspunkte im Hinblick darauf berufen, dass die Ausschlussfristen nach der früheren höchstrichterlichen Rechtsprechung für Urlaubsabgeltungsansprüche nicht galten.
Nach der früheren Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts wären die Urlaubsansprüche der Klägerin für die Jahre 2007 bis 2009 verfallen, weil die Klägerin bis zum Ende des jeweiligen Übertragungszeitraums nicht arbeitsfähig war. Erst aufgrund der Rechtsprechungsänderung stand der Klägerin bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein Urlaubsabgeltungsanspruch zu. In Kenntnis der Rechtsprechungsänderung konnte die Klägerin jedoch nicht darauf vertrauen, dass die Ausschlussfrist weiterhin keine Anwendung finden würde.
- 12 -
6. Da das arbeitsgerichtliche Urteil, das gemäß § 61 Abs. 1 S. 1 ArbGG vorläufig vollstreckbar war, aufgehoben wurde, ist die Klägerin gemäß § 717 Abs. 2 S. 1 BGB zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der der Beklagten durch die zur Abwendung der Zwangsvollstreckung gemachte Leistung entstanden ist. Die Zahlung der Beklagten erfolgte nicht aus freien Stücken zur Erfüllung des Anspruchs, sondern nach Erlass des erstinstanzlichen Urteils und nachfolgender Zahlungsaufforderung. Darin liegt die Leistung zur Abwendung der Zwangsvollstreckung.
Zur Wiederherstellung des früheren Zustands zählt hier die Rückzahlung des geleisteten Betrags.
III.
Die Klägerin muss den Bruttobetrag inklusive Arbeitnehmeranteil zur Sozialversicherung und Lohnsteuer an die Beklagte zurückzahlen. Zwar ist es streitig, ob der Arbeitnehmer bei einer Entgeltrückzahlungsverpflichtung den zu viel erhaltenen Nettobetrag oder den gesamten Bruttobetrag zurückerstatten muss (dazu Personalbuch 2010/Griese, Stichwort Entgeltrückzahlung, Rn. 11 ff). Während es insbesondere bei einer Überzahlung, die der Arbeitnehmer nicht veranlasst hat, für interessengerecht gehalten wird, dem Arbeitgeber den Aufwand und das Risiko der Rückabwicklung in steuerlicher und sozialversicherungsrechtlicher Hinsicht aufzubürden (so Groß, ZIP 1987, 5), hat im Falle des § 717 Abs. 2 ZPO die Klägerin die Risiken und Nachteile, die sich aus der Androhung der vorläufigen Vollstreckung ergeben, zu tragen. Anders als bei einem Bereicherungsanspruch, bei dem darüber gestritten werden kann, was die Klägerin erlangt hat, geht es bei einem Schadensersatzanspruch um die Restitution des früheren Zustands beim Gläubiger.
Die Klägerin hat als unterlegene Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO.
Die Revision wird gemäß § 72 Nr. 1 ArbGG zugelassen. In der Folge der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 23.03.2010 (9 AZR 128/09) über die Aufgabe der Surrogatstheorie hat die Frage der Anwendung von Ausschlussfristen auf Urlaubsabgeltungsansprüche rechts-grundsätzliche Bedeutung.
- 13 -
Rechtsmittelbelehrung
Gegen dieses Urteil kann die Klägerin schriftlich Revision einlegen. Die Revision muss innerhalb einer Frist von einem Monat, die Revisionsbegründung innerhalb einer Frist von zwei Monaten bei dem
Bundesarbeitsgericht
Hugo-Preuß-Platz 1
99084 Erfurt
eingehen.
Beide Fristen beginnen mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung.
Die Revision und die Revisionsbegründung müssen von einem Prozessbevollmächtigten un¬erzeichnet sein. Als Prozessbevollmächtigte sind nur zugelassen:
a. Rechtsanwälte,
b. Gewerkschaften und Vereinigungen von Arbeitgebern sowie Zusammenschlüsse solcher Verbände für ihre Mitglieder oder für andere Verbände oder Zusammenschlüsse mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder,
c. juristische Personen, die die Voraussetzungen des § 11 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 ArbGG erfüllen.
In den Fällen der lit. b und c müssen die handelnden Personen die Befähigung zum Richteramt haben.
Dr. Schmiegel
Bauer
Hilmes
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gern:
 |
Dr. Martin Hensche Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hensche@hensche.de |
 |
Christoph Hildebrandt Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hildebrandt@hensche.de |
 |
Nina Wesemann Rechtsanwältin Fachanwältin für Arbeitsrecht Kontakt: 040 / 69 20 68 04 wesemann@hensche.de |