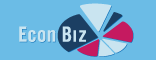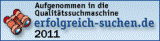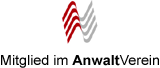- -> zur Mobil-Ansicht
- Arbeitsrecht aktuell
- Tipps und Tricks
- Handbuch Arbeitsrecht
- Gesetze zum Arbeitsrecht
- Urteile zum Arbeitsrecht
- Urteile 2023
- Urteile 2021
- Urteile 2020
- Urteile 2019
- Urteile 2018
- Urteile 2017
- Urteile 2016
- Urteile 2015
- Urteile 2014
- Urteile 2013
- Urteile 2012
- Urteile 2011
- Urteile 2010
- Urteile 2009
- Urteile 2008
- Urteile 2007
- Urteile 2006
- Urteile 2005
- Urteile 2004
- Urteile 2003
- Urteile 2002
- Urteile 2001
- Urteile 2000
- Urteile 1999
- Urteile 1998
- Urteile 1997
- Urteile 1996
- Urteile 1995
- Urteile 1994
- Urteile 1993
- Urteile 1992
- Urteile 1991
- Urteile bis 1990
- Arbeitsrecht Muster
- Videos
- Impressum-Generator
- Webinare zum Arbeitsrecht
-
Kanzlei Berlin
 030 - 26 39 62 0
030 - 26 39 62 0
 berlin@hensche.de
berlin@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Frankfurt
 069 - 71 03 30 04
069 - 71 03 30 04
 frankfurt@hensche.de
frankfurt@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hamburg
 040 - 69 20 68 04
040 - 69 20 68 04
 hamburg@hensche.de
hamburg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hannover
 0511 - 89 97 701
0511 - 89 97 701
 hannover@hensche.de
hannover@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Köln
 0221 - 70 90 718
0221 - 70 90 718
 koeln@hensche.de
koeln@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei München
 089 - 21 56 88 63
089 - 21 56 88 63
 muenchen@hensche.de
muenchen@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Nürnberg
 0911 - 95 33 207
0911 - 95 33 207
 nuernberg@hensche.de
nuernberg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Stuttgart
 0711 - 47 09 710
0711 - 47 09 710
 stuttgart@hensche.de
stuttgart@hensche.de
AnfahrtDetails
LAG Köln, Urteil vom 16.01.2014, 13 Sa 516/13
| Schlagworte: | Krankheit: Alkohol, Entgeltfortzahlung | |
| Gericht: | Landesarbeitsgericht Köln | |
| Aktenzeichen: | 13 Sa 516/13 | |
| Typ: | Urteil | |
| Entscheidungsdatum: | 16.01.2014 | |
| Leitsätze: | Bei einer Arbeitsunfähigkeit aufgrund langjähriger Alkoholabhängigkeit ist regelmäßig davon auszugehen, dass es sich um eine Krankheit handelt, die nicht vom Arbeitnehmer i.S.v. § 3 Abs. 1 S. 1 EFZG verschuldet ist (abweichend von der Rechtsprechung des BAG, vgl. etwa Urteil vom 27.05.1992 – 5 AZR 297/91). | |
| Vorinstanzen: | ||
Tenor:
1. Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Arbeitsgerichts Köln vom 29.05.2013 – 9 Ca 9134/12 – wird kostenpflichtig zurückgewiesen.
2. Die Revision wird zugelassen.
Tatbestand
Die Parteien streiten darüber, ob die Beklagte der Klägerin aus übergegangenem Recht (§ 115 Abs. 1 SGB X) Entgeltfortzahlung schuldet.
Die Klägerin ist eine gesetzliche Krankenkasse. Ihr Mitglied, Herr L war von 2007 bis zum 30.12.2011 bei der Beklagten beschäftigt. Auf das Arbeitsverhältnis findet der allgemeinverbindliche Bundesrahmentarifvertrag für das Baugewerbe (BRTV) Anwendung, der in § 15 eine zweistufige Ausschlussfrist von jeweils zwei Monaten vorsieht.
Ab dem 23.11.2011 war der alkoholabhängige Herr L infolge eines Sturztrunks für über zehn Monate arbeitsunfähig erkrankt. Er wurde am 23.11.2011 mit einer Alkoholvergiftung (4,9 Promille) bei völliger körperlicher und geistiger Bewegungslosigkeit ins S . F H eingeliefert, wo er künstlich beatmet werden musste. Vom 29.11.2011 bis 15.01.2012 war er in stationärer Behandlung. In „sozialmedizinischen Beurteilung“ des
„sozialmedizinischen Gutachtens“ vom 14.05.2013 (Bl. 60 ff. d. A.) heißt es u. a.:
„Bei dem Versicherten besteht aufgrund der vorliegenden medizinischen Unterlagen zweifelsfrei eine langjährige, chronische Alkoholkrankheit mit den typischen Folgeerkrankungen wie z.B. die äthyltoxische Leberzirrhose mit Gallenkomplikationen. Aus den vorliegenden Unterlagen geht hervor, dass der Versicherte bereits zweimal eine stationäre Entzugstherapie durchgeführt hat. Es ist jedoch offensichtlich immer wieder zu Rückfällen gekommen und somit auch zu dem Alkoholexzess am 23.11.2011, der bei dem Versicherten einen, komatösen, beatmungspflichtigen Zustand hervorrief bei respiratorischer Insuffizienz infolge der Alkoholintoxikation. Im Rahmen der notwendigen Langzeitbeatmung kam es dann zu den typischen Komplikationen im Verlauf, wie tubusassoziierte, nosokomiale Pneumonie, Aspirationspneumonie und nosokomialer Sinusitis maxilaris.
Auch die hepato-bilären Komplikationen sind, zumindest zum Teil, Folge der langjährigen, exzessiven Alkoholkonsums (Leberzirrhose).
Es ist hieraus zu folgern, dass der intensive Alkoholkonsum, der am 23.11.2011 zur stationären Behandlungsnotwendigkeit und zur Arbeitsunfähigkeit führte im Rahmen einer langwierigen, chronischen Erkrankung (Alkoholkrankheit) erfolgte und nicht willentlich durch den Versicherten hätte verhindert oder vermieden werden können (--Suchtdruck). Selbstverschulden ist somit medizinisch auszuschließen.“ (Bl. 62, 63 d.A.)
Mit Schreiben vom 28.11.2011 kündigte die Beklagte das Arbeitsverhältnis fristlos. Hiergegen erhob Herr L Kündigungsschutzklage. Die Klägerin leistete an ihn für den Zeitraum 29.11.2011 bis 30.12.2011 Krankengeld i. H. v. 1.303,36 € (32 Tage x 40,73 €). Mit Schreiben vom 05.03. 2012 erklärte die Beklagte gegenüber der Klägerin, dass sie für den Fall, dass das Arbeitsverhältnis durch Urteil oder Vergleich im Arbeitsgerichtsverfahren verlängert würde, auf die Einrede des Lohnverfalls verzichte. Am 21.06.2012 einigten die Beklagte und Herr L im Kündigungsschutzverfahren auf eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses zum 30.12.2011.
Mit Schreiben vom 18.07.2012 verlangte die Beklagte von Herrn L Auskunft über „alle für die Entstehung der behaupteten Alkoholabhängigkeit erheblichen Umstände“. Herr L reagierte darauf nicht. Die Klägerin machte mit Schreiben vom 19.07.2012 ihre Ansprüche auf Entgeltfortzahlung aus übergegangenem Recht in Höhe von 1.306,36 € gegenüber der Beklagten geltend.
Das Arbeitsgericht hat der Klage stattgegeben. Es hat zur Begründung ausgeführt, der Klägerin stehe aus übergegangenem Recht gemäß §§ 3 ff. EFZG, 115 Abs. 1 SGB X der geltend gemachte Entgeltfortzahlungsanspruch zu. Der Anspruch sei nicht nach § 15 BRTV verfallen, da beide Stufen der Ausschlussfrist bereits durch die Kündigungsschutzklage des Herrn L gewahrt seien. Dem Entgeltfortzahlungsanspruch stünde nicht der Einwand des Verschuldens an der Arbeitsunfähigkeit (§ 3 Abs. 1 EFZG) entgegen. Die Arbeitsunfähigkeit des Herrn L vom 23.11.2011 bis 30.12.2011 sei nicht deshalb als selbstverschuldet anzusehen, weil die zu Grunde liegende Alkoholabhängigkeit verschuldet herbeigeführt worden sei. Abweichend von den durch das Bundesarbeitsgericht aufgestellten Grundsätzen vertritt das Arbeitsgericht die Auffassung, dass es auf die Frage des Verschuldens an der der aktuellen Arbeitsunfähigkeit zu Grunde liegenden Alkoholabhängigkeit nicht ankomme. Die Frage des Verschuldens eines alkoholabhängigen Arbeitnehmers an seiner Suchterkrankung sei nur dann im Sinne von § 3 Abs. 1 EFZG relevant, wenn es sich zugleich unmittelbar auf die Ursachen der aktuellen Arbeitsunfähigkeit beziehe. Dies werde regelmäßig nicht der Fall sein und sei es auch vorliegend nicht. Das Verschulden an dieser „Grunderkrankung“ sei zudem regelmäßig nicht justiziabel. Wegen der weiteren Einzelheiten der Begründung wird auf die Entscheidungsgründe des Urteils vom 29.05.2013 (Bl. 95 - 107 d. A.) wird verwiesen.
Gegen diese Entscheidung richtet sich die Berufung der Beklagten, die den vom Bundesarbeitsgericht abweichenden Lösungsansatz des Arbeitsgerichts nicht für überzeugend hält. Der Ansatz des Arbeitsgerichts, dass es im Fall einer Suchterkrankung bei der Frage des Verschuldens nur auf die Ursache der aktuellen Arbeitsunfähigkeit ankomme, führe zu Wertungswidersprüchen, da dann trotz angenommener Alkoholabhängigkeit eine wie auch immer ausgestaltete Steuerungsfähigkeit angenommen werden müsse. Das Arbeitsgericht hätte den Sachverhalt im Hinblick auf die vorausgegangene zweimalige Entzugstherapie weiter aufklären oder die Klage abweisen müssen, da ein Rückfall nach mehrfach stationärem Entzug und der diesbezüglich erfolgten Aufklärung als selbstverschuldet anzusehen sei.
Die Beklagte beantragt,
dass das Urteil abzuändern und die Klage abzuweisen.
Die Klägerin beantragt die Zurückweisung der Berufung.
Sie verteidigt die angefochtene Entscheidung. Im Übrigen stehe das Urteil nicht im Widerspruch zur Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, da die Alkoholabhängigkeit bei Herrn L schon seit vielen Jahren vorgelegen habe. Es gebe kein Anzeichen für ein grob fahrlässiges Verschulden im Sinne von § 3 EFZG an seinem Alkoholmissbrauch am 23.11.2011.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach-Streitstandes wird auf den Tatbestand des angefochtenen Urteils, die Berufungsverfahren gewechselten Schriftsätze, die eingereichten Unterlagen und die Sitzungsprotokolle Bezug genommen.
Entscheidungsgründe
I. Die Berufung ist zulässig, in der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg. Das Arbeitsgericht hat der Klage zu Recht stattgegeben. Die Klägerin hat gegen die Beklagte aus übergegangenem Recht Anspruch auf Entgeltfortzahlung nach §§ 3,4 EFZG, 115 Abs. 1 SGB X für den Zeitraum 23.11. bis 30.12.2011 i. H. v. 1.303,36 €.
1. Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung ist gemäß § 115 Abs. 1 SGB X auf die 19 Klägerin übergegangen, weil diese an Herrn L für den genannten Zeitraum Krankengeld (§§ 44 ff. SGB V) geleistet hat.
2. Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung ist – was zwischen den Parteien in der 20 Berufung außer Streit ist – nicht verfallen, da beide Stufen der tariflichen Ausschlussfrist nach § 15 BRTV bereits durch die Kündigungsschutzklage des Herrn L gewahrt ist, wobei für die 2. Stufe § 15 Nr. 2 S. 2 BRTV gilt.
3. Die Voraussetzungen des Anspruchs auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall nach § 3 Abs. 1 Satz 1 EFZG sind erfüllt. Danach hat ein Arbeitnehmer gegen den Arbeitgeber Anspruch auf Entgeltfortzahlung bis zur Dauer von sechs Wochen, wenn er durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an seiner Arbeitsleistung verhindert ist, ohne dass ihnen ein Verschulden trifft. Der langjährig alkoholabhängige Arbeitnehmer der
Beklagten Herr L war vom 29.11.2011 bis 30.12.2011 arbeitsunfähig erkrankt. Er war in dieser Zeit wegen eines Sturztrunkes am 23.11.2011, der zu einer Alkoholvergiftung (4,9 Promille) führte in stationärer Behandlung. Alkoholabhängigkeit ist eine Krankheit im medizinischen und damit auch im entgeltfortzahlungsrechtlichen Sinne (ständige Rspr., vgl. etwa BAG 27.05.1992 – 5 AZR 297/91; 01.06.1983 – 5 AZR 536/80 – jeweils noch zu § 1 Abs.1 LFZG). Zwischen den Parteien ist lediglich in Streit, ob den Arbeitnehmer an seiner Alkoholerkrankung ein Verschulden im Sinne des § 3 Abs. 1 S. 1 EFZG trifft.
4. Schuldhaft im Sinne des Entgeltfortzahlungsrechts im Krankheitsfall handelt der Arbeitnehmer, der gröblich gegen das von einem verständigen Menschen im eigenen Interesse zu erwartende Verhalten verstößt. Der Sache nach handelt es sich um ein „Verschulden gegen sich selbst“. Das Gesetz schließt den Anspruch bei eigenem Verschulden des Arbeitnehmers aus, weil es unbillig wäre, den Arbeitgeber mit der Lohnfortzahlungsverpflichtung zu belasten, wenn der Arbeitnehmer zumutbare Sorgfalt sich selbst gegenüber außer Acht gelassen hat und dadurch die Arbeitsunfähigkeit verursacht hat (ständige Rspr. vgl. etwa BAG 01.06.1983 – 5 AZR 536/80 – m. w. N.; 27.05.1992 – 5 AZR 297/91).
a. Das Bundesarbeitsgericht geht für das Verschulden bei einer Krankheit wegen Alkoholabhängigkeit in seiner grundlegenden Entscheidung vom 01.06.1983 (5 AZR 536/80 – zu § 1 Abs.1 S. 1 LohnFG) von folgenden Grundsätzen aus:
1) Nach Eintritt der Erkrankung kann ein Arbeitnehmer im Sinne dieser Entgeltfortzahlungsbestimmungen nicht mehr schuldhaft handeln. Die körperliche und psychische Abhängigkeit vom Alkohol, die es dem Patienten nicht mehr erlaubt, mit eigener Willensanstrengung vom Alkohol loszukommen, schließt in diesem Zeitpunkt ein Verschulden des Erkrankten aus. Schuldhaft im Sinne der Entgeltfortzahlungsbestimmungen kann ein Arbeitnehmer deshalb nur vor Eintritt der Erkrankung handeln. Maßgebend für die Beurteilung der Verschuldensfrage in Fällen der Alkoholabhängigkeit ist also nur das Verhalten des Arbeitnehmers, dass vor dem Zeitpunkt liegt, in dem die als Krankheit zu wertende Alkoholabhängigkeit eingetreten ist. Dies gilt, obwohl gerade bei der Alkoholabhängigkeit der Zeitpunkt der Erkrankung – der Eintritt des Kontrollverlustes und der Unfähigkeit zur Abstinenz – häufig längere Zeit zurückliegt und nicht so exakt bestimmt werden kann, wie in anderen Fällen der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit. Im Interesse der Gleichbehandlung dieser Krankheit mit anderen Krankheiten muss dies hingenommen werden. Alkoholabhängigkeit ist eine Krankheit wie jede andere Krankheit auch. Deshalb scheidet für diese Erkrankung der Beginn der Arbeitsunfähigkeit als Anknüpfungszeitraum für die Prüfung der Verschuldensfrage aus.
2) Es gibt keinen Erfahrungssatz, wonach der Arbeitnehmer eine krankhafte Alkoholabhängigkeit in der Regel selbst verschuldet hat. Maßgebend ist vielmehr die Beurteilung im Einzelfall. Dabei geht das Bundesarbeitsgericht davon aus, dass in der Praxis die Aufklärung der Ursachen einer krankhaften Alkoholabhängigkeit und des möglichen Verschuldens eines Arbeitnehmers erhebliche Schwierigkeiten bereiten. Im Ausgangspunkt hat der Arbeitgeber – wie bei allen anderen Krankheiten auch - das Verschulden des Arbeitnehmers an der Entstehung seiner krankhaften Alkoholabhängigkeit darzulegen und zu beweisen. Der Arbeitnehmer, der Entgeltfortzahlung fordert, kann jedoch eine Pflicht zur Mitwirkung an der Aufklärung aller für die Entstehung des Anspruchs erheblichen Umstände treffen. Dem Arbeitgeber ist es kaum möglich, die für die Entstehung der Krankheit erheblichen Umstände, die aus dem Lebensbereich des Arbeitnehmers herrühren im Einzelnen darzulegen. Diese muss deshalb der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber auf Verlangen offenbaren. Erst danach kann sich der Arbeitgeber darüber schlüssig werden, ob er zur Lohnfortzahlung verpflichtet ist. Verletzt der Arbeitnehmer seine Mitwirkungspflichten, geht das zu seinen Lasten. Soweit die Entstehung der Krankheit nicht aufgeklärt werden kann oder noch medizinische Wertungen erforderlich sind, wird das Gericht in der Regel einen medizinischen Sachverständigen hinzuziehen müssen. Dabei kommt in erster Linie aus Sach- und Kostengründen der Arzt in Betracht, der den Arbeitnehmer bisher behandelt hat. Der Arbeitnehmer, der den Entgeltfortzahlungsanspruch geltend macht, muss sich einer solchen Begutachtung unterziehen. Steht nicht fest, ob den Arbeitnehmer ein Verschulden im Sinne von § 3 Abs. 1 S. 1 EFZG trifft, muss der Arbeitgeber den Lohn fortzahlen.
b. Diese Rechtsprechung hat das Bundesarbeitsgericht in den darauf folgenden Entscheidungen (11.11.1987 – 5 AZR 497/86; 11.11.1987– 5 AZR 306/86; 11.11.1987- 5 AZR 478/86; 30.03.1988 – 5 AZR 42/87; 11.05.1988 – 5 AZR 445/87; 11.05.1988 – 5 AZR 446/87; 07.09.1991– 5 AZR 410/90; 27.05.1992 – 5 AZR 297/91) bestätigt und insbesondere hinsichtlich des Rückfalls, der Anforderungen an die Mitwirkungspflicht des Arbeitnehmers und des Verschuldens bei einem im Zustand der Trunkenheit verursachten Verkehrsunfall fortgeführt. Zu der hier streitigen Frage des Verschuldens bei Alkoholabhängigkeit im Rahmen der Entgeltfortzahlung sind seitdem – soweit ersichtlich - keine weiteren Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts ergangen.
c. Das Bundesarbeitsgericht hat in seiner Entscheidung vom 11.11.1987(5 AZR 27 497/86) für den Rückfall des Arbeitnehmers nach stationärer Entziehungskur folgende Grundsätzen aufgestellt:
1) Auch bei einem durch Rückfall in den Alkoholmissbrauch arbeitsunfähig 28 erkrankten Arbeitnehmer trägt der Arbeitgeber die Darlegungs-und Beweislast für ein Verschulden des Arbeitnehmers an der Krankheit. In diesem Falle geht es aber nicht mehr allein darum, ob der Arbeitnehmer die Entstehung seiner Alkoholabhängigkeit verschuldet hat oder nicht, sondern nunmehr vor allem darum, ob er sich ein Verschulden an der wiederholten Erkrankung entgegenhalten lassen muss.
Der Arbeitnehmer, der eine Entziehungskur durchgemacht hat, kennt die Gefahren des Alkohols für sich sehr genau. Er ist bei der Behandlung eingehend darauf hingewiesen und weiter dringend ermahnt worden, in Zukunft jeden Alkoholgenuss zu vermeiden. Wird der Arbeitnehmer nach erfolgreicher Beendigung einer Entwöhnungskur und weiter nach einer längeren Zeit der Abstinenz dennoch wieder rückfällig, so spricht die Lebenserfahrung dafür, dass er die ihm erteilten dringenden Ratschläge missachtet und sich wieder dem Alkohol zugewandt hat. Dieses Verhalten wird im Allgemeinen den Vorwurf eines „Verschuldens gegen sich selbst“ begründen. Es ist dann Sache des Arbeitnehmers, die Beweisführung des Arbeitgebers zu widerlegen und zunächst im Einzelnen darzulegen, aus welchen Gründen sein Verhalten als nicht schuldhaft anzusehen ist.
2) Das Bundesarbeitsgericht hat im Streitfall ein Verschulden des Arbeitnehmers mit der Begründung angenommen, er habe die Gefahren des Alkohols für sich und seine Gesundheit gekannt, da er bereits eine Entgiftung-und Entwöhnungsbehandlung durchlaufen hatte. Es wäre ihm gelungen, fünf Monate lang vom Alkoholgenuss abzustehen. Wenn er nunmehr bei Einsichtsfähigkeit Monate lang vom Alkoholgenuss und bewiesener längerer Abstinenz wieder rückfällig geworden sei, spreche dies für ein schuldhaftes Verhalten seinerseits. In dieser Richtung habe sich auch der vom Arbeitsgericht zugezogene Sachverständige geäußert, wenngleich er nur allgemeine Erwägungen habe anstellen können, da sich der Versicherte geweigert hätte, an der näheren Klärung der Verschuldensfrage mitzuwirken. Damit sei nicht der Arbeitgeber beweisfällig geblieben, vielmehr hätte die Krankenversicherung als Klägerin nunmehr Tatsachen vortragen müssen, die ein Verschulden die ein Verschulden des versicherten Arbeitnehmers ausräumten. Das sei nicht geschehen. Ihr Vorbringen, familiäre und berufliche Probleme des Versicherten hätten sich auch nach den Entziehungskuren nicht geändert, reiche dafür nicht aus.
d. In seiner Entscheidung vom 30. 03.1988 (5AZR 42/87) hat das Bundesarbeitsgericht den Grundsatz aufgestellt, dass ein seit längerer Zeit an Alkoholabhängigkeit erkrankter Arbeitnehmer schuldhaft im Sinne der lohnfortzahlungsrechtlichen Bestimmungen handeln kann, wenn er – in noch steuerungsfähigem Zustand – sein Kraftfahrzeug für den Weg zur Arbeitsstelle benutzt, während der Arbeitszeit in erheblichem Maße dem Alkohol zuspricht und alsbald nach Dienstende im Zustande der Trunkenheit einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem er verletzt wird.
e. 1) Das Bundesarbeitsgericht hat in seiner Entscheidung vom 11. 05. 1988 (5 AZR 445/87) festgestellt, dass auch bei einem durch Rückfall in den Alkoholmissbrauch arbeitsunfähig erkrankten Arbeitnehmer der Arbeitgeber die Darlegungslast und Beweislast für ein Verschulden des Arbeitnehmers an der Krankheit trägt. Dann geht es aber nicht mehr darum, ob der Arbeitnehmer die Entstehung seiner Alkoholabhängigkeit verschuldet hat oder nicht, sondern darum, ob er sich ein Verschulden an der wiederholten Erkrankung entgegenhalten lassen muss.
2) Das Bundesarbeitsgericht kam in diesem Streitfall zu dem Ergebnis, dass der Arbeitnehmer aufgrund seines Verschuldens wieder rückfällig geworden sei. Dem Arbeitnehmer wäre es gelungen, nach erfolgreicher Durchführung einer Entwöhnungskur längere Zeit abstinent zu bleiben. Es entspreche der Lebenserfahrung, dass bei fachklinisch durchgeführten Alkoholentwöhnungskuren von mehrmonatiger Dauer großer Wert auf die psychische Festigung des Patienten gelegt werde. Dazu gehöre auch, dass sie über die Gefahren des Alkohols eingehend unterrichtet würden. Wenn er dann doch wieder rückfällig geworden sei, spräche dies für ein schuldhaftes Verhalten seinerseits. Für das Gegenteil habe er bzw. die Versicherung keine Tatsachen schlüssig vorgetragen. Sein Vorbringen, er habe Streit mit seiner damaligen Lebensgefährtin gehabt und sei wegen seiner partnerschaftlichen Probleme wieder in den Alkoholmissbrauch zurückgeglitten, reiche in dieser allgemeinen Form dafür nicht aus. Sein Rückfall sei daher als schuldhaft im Sinne des Lohnfortzahlungsrechts.
f. Das Bundesarbeitsgericht hat in seiner Entscheidung vom 07.08.1991 (5 AZR 34 410/90) ausgehend von den o.g. Grundsätzen festgestellt:
1) Ein gesetzlicher Forderungsübergang im Falle der Lohnfortzahlung bei 35 krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit an den Fragen der Darlegungs- und Beweislast nichts ändert. Eine durch verschuldete Alkoholabhängigkeit herbeigeführte Krankheit bedeutet gegenüber dem Lohnfortzahlungsanspruch Entgeltfortzahlungsanspruch des Arbeitnehmers eine anspruchshindernde Einwendung, die dem neuen Gläubiger gegenüber geltend gemacht werden kann. Allerdings muss der Arbeitgeber dafür zunächst einmal die zu fordernden Tatsachen in schlüssiger Weise vortragen. Dieser Darlegungspflicht kann er nicht in der Weise genügen, dass er sich gegenüber dem neuen Gläubiger auf eine einfache Behauptung beschränkt, der Arbeitnehmer habe seine Alkoholabhängigkeit selbst verschuldet, und weiter von dem neuen Gläubiger – der Versicherung - die Darlegung der einzelnen Umstände verlangt, die zur schuldhaften Abhängigkeit des Arbeitnehmers geführt haben. Vielmehr muss der Arbeitgeber alles vortragen, was dem Anspruch des Arbeitnehmers auf Lohnfortzahlung entgegensteht. Ist ihm dies aufgrund eigener Kenntnis der Lebensumstände des Arbeitnehmers nicht möglich, muss er sich an den Arbeitnehmer wenden und Mitwirkung bei der Aufklärung verlangen.
2) Das Bundesarbeitsgericht ist in diesem Streitfall davon ausgegangen, dass 36 der Arbeitgeber seiner obliegenden Darlegungspflicht nicht nachgekommen ist, denn er habe nichts dazu vorgetragen, wie es zu dem Alkoholismus des Arbeitnehmers gekommen ist. Er habe nicht einmal dargelegt, ob und in welcher Weise er sich durch Befragen seines Arbeitnehmers bemüht habe, die Umstände aufzuhellen, die zur Alkoholabhängigkeit geführt hätten.
g. Das Bundesarbeitsgericht hat schließlich in seiner Entscheidung vom 27.05.1992 (5 AZR 297/91) an der bisherigen Rechtsprechung festgehalten, ist allerdings in dem Streitfall zu dem Ergebnis gekommen, dass trotz Rückfalls nach einer Entziehungskur kein Verschulden anzunehmen ist.
1) Das Bundesarbeitsgericht ging dabei von folgendem Grundsatz aus: Wenn 38 sich ein alkoholkranker Arbeitnehmer weiterhin in einem Zustand befindet, in dem er auf sein Verhalten wegen mangelnder Steuerungsfähigkeit willentlich keinen Einfluss nehmen kann, so kann ihm ein Rückfall in den Alkoholmissbrauch nicht im Sinne eines Verschuldens gegen sich selbst vorgeworfen werden.
2) Das vom Landesarbeitsrecht eingeholte Sachverständigengutachten war zu 39 der Feststellung gelangt, dass der schwere Alkoholismus des Versicherten auf einer psychischen Fehlentwicklung, insbesondere aufgrund belastender Kindheitserlebnisse während des Zweiten Weltkrieges und der Nachkriegswirren beruht und dass Rückfälle seiner freien Willensbestimmung nicht zugänglich, krankheitsimmanent und daher nicht selbst verschuldet sind. Nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts kam es nicht darauf an, dass der Versicherte entgegen einer dem Arbeitgeber gegenüber eingegangenen Verpflichtung nach Abschluss der ersten Entziehungskur nicht regelmäßig eine Selbsthilfegruppe aufgesucht habe. Das Aufsuchen einer Selbsthilfegruppe sei ihm zwar vom Kurheim empfohlen worden, hätte aber keine Fortsetzung der eigentlichen Heilbehandlung dargestellt. Entscheidend sei, dass die Entziehungskur nach den Feststellungen des Landesarbeitsgerichts den Versicherten noch nicht so weit von der Alkoholsucht befreit hatte, dass er aufgrund eigener Willensanstrengung in einer Konfliktsituation in der Lage gewesen wäre, einen Rückfall zu vermeiden. Zwar sei in den erstellten Gutachten allgemein die Ansicht vertreten worden, Rückfälle lägen regelmäßig außerhalb der freien Willensbestimmung des Alkoholabhängigen. Ausschlaggebend sei aber, dass dies individuell für den Versicherten nach eingehender Untersuchung und Befragung und Auswertung und Zugrundelegung seiner gesamten Lebensumstände festgestellt worden sei.
h. Die Instanzgerichte (vgl. etwa LAG Baden-Württemberg 30.03.2000– 4 Sa 108/99) und das Schrifttum (vgl. etwa ErfK/Reinhard 14.Aufl. 2014 § 3 EFZG Rn 27 m.w.N.; siehe auch weitere Literaturnachweise im angefochtenen Urteil (S.11)) sind dieser höchstrichterlichen Rechtsprechung – soweit ersichtlich – bis heute im Wesentlichen gefolgt.
5. Folgt man der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, käme in Betracht, die Klage ohne jede weitere Sachaufklärung wegen fehlender Mitwirkung abzuweisen, weil der Arbeitnehmer Herr L das Schreiben der Beklagten vom 18.07.2012, womit sie von ihm Auskunft über „alle für die Entstehung der behaupteten Alkoholabhängigkeit erheblichen Umstände“ verlangt hat, nicht beantwortet hat oder weil Herr L keine ausreichenden Tatsachen vorgetragen hat, aus denen sich ergeben könnte, dass seine „Rückfälle“ nach zwei durchgeführten Entziehungskuren nicht selbst verschuldet waren. Sehr viel mehr würde allerdings dafür sprechen, den Sachverhalt, im Hinblick auf die Entstehung der Alkoholabhängigkeit bzw. die Gründe der Rückfälle nach zwei Entziehungskuren durch Einholung eines medizinischen Sachverständigengutachtens weiter aufzuklären.
6. Das Berufungsgericht folgt indes nicht dieser Rechtsprechung, sondern 42 vertritt – teilweise im Anschluss an das Arbeitsgericht - die Auffassung, dass bei einer Arbeitsunfähigkeit jedenfalls bei langjähriger Alkoholabhängigkeit regelmäßig davon auszugehen ist, dass es sich dabei um eine Krankheit handelt, die nicht vom Arbeitnehmer i.S.v.§ 3 Abs.1 S.1 EFZG verschuldet ist. Etwas anderes gilt nur dann – was hier nicht im Streit steht -, wenn der alkoholabhängige Arbeitnehmer seine Arbeitsunfähigkeit durch ein steuerbares Verhalten, etwa eine Verletzung durch einen Verkehrsunfall bei Führen eines KFZ im Zustand der Trunkenheit oder eine Verletzung durch Beteiligung an einer Schlägerei im Zustand der Trunkenheit, herbeigeführt hat.
a. Das Berufungsgericht teilt die Auffassung des Arbeitsgerichts hinsichtlich der Nichtjustiziabilität des Verschuldens des Arbeitnehmers i.S.v. § 3 Abs. 1 S. 1 EFZG an der Entstehung seiner Alkoholabhängigkeit bzw. den Gründen für einen Rückfall. Dazu hat das Arbeitsgericht ausgeführt:
„Die Kammer geht zudem davon aus, dass die Ursachen einer Alkoholabhängigkeit vielfältig, regelmäßig aus der Privat- oder Intimsphäre des Arbeitnehmers herrührend und nach Verursachungsbeiträgen oftmals kaum zu bestimmen sind (vgl. insoweit die Darstellung zu den vielen möglichen Ursachen von Rückfällen bei Alkoholerkrankten: Fleck/Körkel, BB 1995, 722 (724 f.); zweifelnd hinsichtlich der Möglichkeit eines Verschuldens: Künzl, NZA 1998,12 (126)). Entsprechend scheint der Kammer die auf diese Ursachen zielende Verschuldensfrage nicht mit einer für die objektive Rechtsfindung notwendigen Eindeutigkeit zu beantworten zu sein, was Zweifel in Hinblick auf die Vereinbarkeit der von der herrschenden Meinung vertretenen Auslegung von § 3 Abs. 1 EFZG mit dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) aufwirft. Aus Sicht der Kammer ist zudem die bei Zugrundelegung dieser Rechtsansicht ggf. erforderlich werdende umfängliche Sachverhaltsaufklärung einem seiner Entgeltfortzahlungspflicht überprüfenden Arbeitgeber ebenso wenig zumutbar (vgl. Gottwald, NZA 1997,635(637): „kaum darzulegen“) wie sie im Wege des förmlichen Gerichtsverfahrens aufklärbar wäre. Dies gilt insbesondere für zeitlich lang zurückliegende Sachverhaltsmomente. Eine entsprechende Aufklärung dürfte nicht zuletzt regelmäßig im Widerspruch zu dem für das arbeitsgerichtliche Verfahren in § 9 Abs. 1 ArbGG (auch für Nicht Bestandsschutzstreitigkeiten) gesetzlich festgelegte Gebot der Verfahrensbeschleunigung stehen.“ (Seite 13)
b. Der vorliegende Fall zeigt wie berechtigt die Auffassung des Arbeitsgerichts ist. Bei dem Arbeitnehmer besteht nach den Feststellungen des sozialmedizinischen Gutachtens vom 14.05.2013 eine langjährige, chronische Alkoholkrankheit mit den üblichen Folgeerkrankungen einer Leberzirrhose mit Gallenkomplikationen. Bereits zweimal hat sich der Arbeitnehmer einer stationären Entzugstherapie unterzogen. Es ist jedoch danach wieder zu Rückfällen gekommen. Zuletzt dem Alkoholexzess am 23.11.2011, der zu einer Alkoholvergiftung (4,9 Promille) und der hier streitigen Arbeitsunfähigkeit vom 29.11.2011 bis 30.12.2011 geführt hat. Welche Ursachen hat seine Alkoholabhängigkeit? Trifft ihn daran ein Verschulden im Sinne von § 3 Abs. 1 S. 1 EFZG? Es kann unterstellt werden, dass die Ursachen für die Frage der Entstehung der Alkoholsucht sowie die Gründe eines oder erst recht mehrerer Rückfälle sehr komplex und jedenfalls bei langjähriger Alkoholabhängigkeit weit – bis in die Kindheit –zurückliegen. Die Frage des „Verschuldens gegen sich selbst“ lässt sich - nach Auffassung des Berufungsgerichts- regelmäßig nicht oder nur zugunsten eines langjährig Alkoholabhängigen feststellen. Das nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts bei langjähriger Alkoholabhängigkeit zur Klärung des Verschuldens iSv § 3 Abs.1 S.1 EFZG regelmäßig einzuholende, aufwändige medizinische Sachverständigengutachten wird in den meisten Fällen zu dem Ergebnis kommen, dass ein Verschulden des Arbeitnehmers nicht feststellbar ist. Damit verliert der beweispflichtige Arbeitgeber den Prozess und hat zudem die nicht geringen Kosten des Gutachtens zu tragen.
c. Die Lösung kann allerdings nach Auffassung des Berufungsgerichts nicht, wie vom Arbeitsgericht vertreten, darin bestehen, über die bereits (unter Ziffer 6.) genannten besonderen Fallkonstellationen hinaus, nunmehr generell ein Verschulden des Arbeitnehmers an der „mittelbar“ aus der Alkoholabhängigkeit „resultierenden akuten Erkrankung oder Behandlungsbedürftigkeit“ (Seite 11) zu überprüfen. Zu Recht weist die Beklagte darauf hin, dass eine derartige „Aufsplittung“ im Widerspruch zu dem Grundsatz steht, dass die Alkoholabhängigkeit eine medizinische Krankheit ist. Konsequenter ist es daher, im Fall der Arbeitsunfähigkeit aufgrund langjähriger Alkoholabhängigkeit – wie hier - regelmäßig davon auszugehen, dass dem Arbeitnehmer kein Verschulden im Sinne des Entgeltfortzahlungsrechts vorzuwerfen ist.
7. Die Klägerin hat daher gegen die Beklagte Anspruch auf den geltend gemachten Entgeltfortzahlungsanspruch. Die Höhe der Entgeltfortzahlung für den Zeitraum 23.11. bis 30.12.2011 von 1.303,36 € - die zwischen den Parteien außer Streit ist - folgt aus §§ 4 EFZG, 611 BGB iVm dem Arbeitsvertrag des Herrn L mit der Beklagten.
II. Die Beklagte hat die Kosten der erfolglosen Berufung zu tragen ( § 97 Abs.1 ZPO)
III. Die Revision war gemäß § 72 ArbGG wegen Divergenz zu der im Einzelnen benannten Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zuzulassen.
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gern:
 |
Dr. Martin Hensche Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hensche@hensche.de |
 |
Christoph Hildebrandt Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hildebrandt@hensche.de |
 |
Nina Wesemann Rechtsanwältin Fachanwältin für Arbeitsrecht Kontakt: 040 / 69 20 68 04 wesemann@hensche.de |