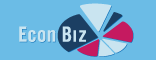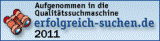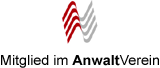- -> zur Mobil-Ansicht
- Arbeitsrecht aktuell
- Tipps und Tricks
- Handbuch Arbeitsrecht
- Gesetze zum Arbeitsrecht
- Urteile zum Arbeitsrecht
- Urteile 2023
- Urteile 2021
- Urteile 2020
- Urteile 2019
- Urteile 2018
- Urteile 2017
- Urteile 2016
- Urteile 2015
- Urteile 2014
- Urteile 2013
- Urteile 2012
- Urteile 2011
- Urteile 2010
- Urteile 2009
- Urteile 2008
- Urteile 2007
- Urteile 2006
- Urteile 2005
- Urteile 2004
- Urteile 2003
- Urteile 2002
- Urteile 2001
- Urteile 2000
- Urteile 1999
- Urteile 1998
- Urteile 1997
- Urteile 1996
- Urteile 1995
- Urteile 1994
- Urteile 1993
- Urteile 1992
- Urteile 1991
- Urteile bis 1990
- Arbeitsrecht Muster
- Videos
- Impressum-Generator
- Webinare zum Arbeitsrecht
-
Kanzlei Berlin
 030 - 26 39 62 0
030 - 26 39 62 0
 berlin@hensche.de
berlin@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Frankfurt
 069 - 71 03 30 04
069 - 71 03 30 04
 frankfurt@hensche.de
frankfurt@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hamburg
 040 - 69 20 68 04
040 - 69 20 68 04
 hamburg@hensche.de
hamburg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hannover
 0511 - 89 97 701
0511 - 89 97 701
 hannover@hensche.de
hannover@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Köln
 0221 - 70 90 718
0221 - 70 90 718
 koeln@hensche.de
koeln@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei München
 089 - 21 56 88 63
089 - 21 56 88 63
 muenchen@hensche.de
muenchen@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Nürnberg
 0911 - 95 33 207
0911 - 95 33 207
 nuernberg@hensche.de
nuernberg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Stuttgart
 0711 - 47 09 710
0711 - 47 09 710
 stuttgart@hensche.de
stuttgart@hensche.de
AnfahrtDetails
Reform des Mindestarbeitsbedingungengesetzes (MiArbG) in Kraft
 Reform des MiArbG: Alter Wein in neuen Schläuchen
Reform des MiArbG: Alter Wein in neuen Schläuchen
03.06.2009. Nachdem die Reform des Gesetzes über die Festsetzung von Mindestarbeitsbedingungen (Mindestarbeitsbedingungengesetz – MiArbG) am 22.01.2009 vom Bundestag beschlossen wurde und damit die parlamentarischen Hürden genommen hat, wurde sie am 27.04.2009 im Bundesgesetzblatt verkündet (BGBl I, 818 ff.) und ist daher seit dem 28.04.2009 in Kraft.
Das reformierte MiArbG behält seine bisherige Bezeichnung, obwohl Gegenstand der staatlichen Regulierung nicht mehr sämtliche Arbeitsbedingungen, sondern nur noch ein (allerdings wichtiger) Teilbereich der Arbeitsbedingungen ist, nämlich die Mindestlöhne bzw. Mindestarbeitsentgelte. Von daher hätte eine Umbenennung des Gesetzes in „Mindestarbeitsentgeltgesetz“ oder „Mindestlohngesetz“ nahegelegen.
Um Mindestlöhne festzusetzen, muss der beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) zu bildende „Hauptausschuss für Mindestarbeitsentgelte“ zunächst durch Beschluss feststellen, dass in einem Wirtschaftszweig soziale Verwerfungen vorliegen und Mindestlöhne festgesetzt, geändert oder aufgehoben werden sollen (§ 3 MiArbG). Die sechs einfachen Mitglieder des Hauptausschusses und sein Vorsitzender werden von der Regierung ernannt, wobei jeweils zwei einfache Mitglieder aufgrund eines Vorschlags der Gewerkschafts- und Arbeitgeberseite von der Regierung ernannt werden.
Auf der Grundlage eines solchen Beschlusses wird sodann ein sog. Fachausschuss tätig. Er besteht aus einem Vorsitzenden und je drei Beisitzern aus Kreisen der beteiligten Arbeitnehmer und Arbeitgeber und setzt die Mindestarbeitsentgelte durch Beschluss fest (§ 4 MiArbG). Der Hauptausschuss kann dazu Stellung nehmen. Außerdem muss das BMAS vor der Entgeltfestsetzung den obersten Arbeitsbehörden der beteiligten Länder, den betroffenen Arbeitnehmern und Arbeitgebern sowie den zuständigen Gewerkschaften und Arbeitgebervereinigungen Gelegenheit zur Stellungnahme bzw. Äußerung in einer öffentlichen Verhandlung vor dem Fachausschuss geben.
In einem dritten Schritt entscheidet das BMAS, ob es sich die Festsetzungen des Fachausschusses zu eigen macht oder nicht. Ein inhaltliches Änderungsrecht steht dem Ministerium nicht zu.
Schließlich kann die Bundesregierung, falls sich das BMAS hinter die Festsetzungen des Fachausschusses gestellt hat, auf Vorschlag des BMAS die vom Fachausschuss festgesetzten Mindestarbeitsentgelte als Rechtsverordnung erlassen (§ 4 MiArbG). Die Rechtsverordnung kann befristet werden. Sie bedarf nicht der Zustimmung des Bundesrates.
Sind Mindestlöhne einmal festgesetzt, wirken sie auf von ihnen erfassten Arbeitsverhältnisse im Prinzip wie Tariflöhne eines allgemeinverbindlichen Tarifvertrags ein, d.h. sie sind eine zwingende, auch abweichende Tariflöhne verdrängende absolute Untergrenze. Ein Verzicht auf ein Mindestarbeitsentgelt ist nur durch gerichtlichen Vergleich zulässig. Die Verwirkung des Anspruchs auf ein Mindestarbeitsentgelt ist ebenso ausgeschlossen wie der Untergang des Anspruchs infolge von Ausschlussfristen.
Die materiellen Voraussetzungen für die Festsetzung von Mindestarbeitsentgelten sind im Vergleich zu den eher komplizierten Verfahrensregeln gering. Vorausgesetzt ist nur, dass in einem Wirtschaftszweig bundesweit die an Tarifverträge gebundenen Arbeitgeber weniger als 50 Prozent der unter den Geltungsbereich dieser Tarifverträge fallenden Arbeitnehmer beschäftigen (§ 1 Abs. 2 MiArbG).
Trotzdem ist nicht anzunehmen, dass die derzeitige oder künftige Bundesregierungen nun beherzt „loslegen“ und einer Branche nach der anderen Mindestarbeitsentgelte auferlegen.
Dagegen sprechen zunächst die bisherigen Erfahrungen mit dem MiArbG 1952, das den Jahrzehnten seiner Geltung stets „toter Buchstabe“ geblieben ist. Und das lag nicht etwa daran, dass die gesetzlichen Voraussetzungen für die Festlegung von Mindestlöhnen bis zur jetzigen Reform höher gewesen wären. Die Reform des MiArbG erleichtert die staatliche Mindestlohnfestsetzung entgegen anderslautenden, v.a. regierungsamtlichen politischen Einschätzungen in Wahrheit kaum (wir berichteten hierüber in: Arbeitsrecht aktuell 08/090).
Gegen eine Ingebrauchnahme des reformierten MiArbG spricht auch eine bezeichnende Übergangsregelung, die in § 8 Abs. 2 MiArbG enthalten ist. Danach gehen Tariflöhne, die in einem vor dem 16.07.2008 abgeschlossenen Tarifvertrag enthalten sind, den staatlich festgesetzten Mindestlöhnen vor, d.h. sie gelten auch dann, wenn sie geringer sind. Dies gilt gemäß § 8 Abs. 2 Satz 2 MiArbG auch für einen Tarifvertrag, mit dem die Tarifvertragsparteien einen solchen Tarifvertrag ablösen oder diesen nach seinem Ablauf durch einen Folgetarifvertrag, der mit diesem in einem zeitlichen und sachlichen Zusammenhang steht, ersetzen.
Das heißt im Ergebnis: Werden Tarifverträge mit „Hungerlöhnen“ von den Tarifparteien kontinuierlich weiter gehegt und gepflegt, sind sie eine dauerhafte rechtliche Sperre für staatliche Lohnfestsetzungen nach dem MiArbG.
Nähere Informationen finden Sie hier:
- Erstes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Festsetzung von Mindestarbeitsbedingungen, vom 22.04.2009, BGBl I, S.818 ff.
- Gesetz über die Festsetzung von Mindestarbeitsbedingungen (Mindestarbeitsbedingungen - MiArbG), Reformfassung
- Handbuch Arbeitsrecht: Mindestlohn
- Arbeitsrecht aktuell: 18/074 Reform der Entsenderichtlinie
- Arbeitsrecht aktuell: 08/090 Der Berg kreißt und gebiert eine Maus.
Letzte Überarbeitung: 4. Juni 2018
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gern:
 |
Dr. Martin Hensche Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hensche@hensche.de |
 |
Christoph Hildebrandt Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hildebrandt@hensche.de |
 |
Nina Wesemann Rechtsanwältin Fachanwältin für Arbeitsrecht Kontakt: 040 / 69 20 68 04 wesemann@hensche.de |
Bewertung:
HINWEIS: Sämtliche Texte dieser Internetpräsenz mit Ausnahme der Gesetzestexte und Gerichtsentscheidungen sind urheberrechtlich geschützt. Urheber im Sinne des Gesetzes über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (UrhG) ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht Dr. Martin Hensche, Lützowstraße 32, 10785 Berlin.
Wörtliche oder sinngemäße Zitate sind nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des Urhebers bzw.
bei ausdrücklichem Hinweis auf die fremde Urheberschaft (Quellenangabe iSv. § 63 UrhG) rechtlich zulässig.
Verstöße hiergegen werden gerichtlich verfolgt.
© 1997 - 2025:
Rechtsanwalt Dr. Martin Hensche, Berlin
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Lützowstraße 32, 10785 Berlin
Telefon: 030 - 26 39 62 0
Telefax: 030 - 26 39 62 499
E-mail: hensche@hensche.de