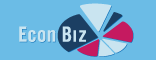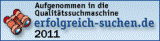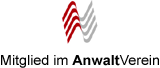- -> zur Mobil-Ansicht
- Arbeitsrecht aktuell
- Tipps und Tricks
- Handbuch Arbeitsrecht
- Gesetze zum Arbeitsrecht
- Urteile zum Arbeitsrecht
- Urteile 2023
- Urteile 2021
- Urteile 2020
- Urteile 2019
- Urteile 2018
- Urteile 2017
- Urteile 2016
- Urteile 2015
- Urteile 2014
- Urteile 2013
- Urteile 2012
- Urteile 2011
- Urteile 2010
- Urteile 2009
- Urteile 2008
- Urteile 2007
- Urteile 2006
- Urteile 2005
- Urteile 2004
- Urteile 2003
- Urteile 2002
- Urteile 2001
- Urteile 2000
- Urteile 1999
- Urteile 1998
- Urteile 1997
- Urteile 1996
- Urteile 1995
- Urteile 1994
- Urteile 1993
- Urteile 1992
- Urteile 1991
- Urteile bis 1990
- Arbeitsrecht Muster
- Videos
- Impressum-Generator
- Webinare zum Arbeitsrecht
-
Kanzlei Berlin
 030 - 26 39 62 0
030 - 26 39 62 0
 berlin@hensche.de
berlin@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Frankfurt
 069 - 71 03 30 04
069 - 71 03 30 04
 frankfurt@hensche.de
frankfurt@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hamburg
 040 - 69 20 68 04
040 - 69 20 68 04
 hamburg@hensche.de
hamburg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hannover
 0511 - 89 97 701
0511 - 89 97 701
 hannover@hensche.de
hannover@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Köln
 0221 - 70 90 718
0221 - 70 90 718
 koeln@hensche.de
koeln@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei München
 089 - 21 56 88 63
089 - 21 56 88 63
 muenchen@hensche.de
muenchen@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Nürnberg
 0911 - 95 33 207
0911 - 95 33 207
 nuernberg@hensche.de
nuernberg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Stuttgart
 0711 - 47 09 710
0711 - 47 09 710
 stuttgart@hensche.de
stuttgart@hensche.de
AnfahrtDetails
LAG Baden-Württemberg, Urteil vom 07.05.2015, 6 Sa 78/14
| Schlagworte: | Arbeitsverhältnis, Betriebsübergang | |
| Gericht: | Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg | |
| Aktenzeichen: | 6 Sa 78/14 | |
| Typ: | Urteil | |
| Entscheidungsdatum: | 07.05.2015 | |
| Leitsätze: | ||
| Vorinstanzen: | Arbeitsgericht Stuttgart, Urteil vom 12.08.2014, 5 Ca 751/14 | |
In dem Rechtsstreit
- Klägerin/Berufungsklägerin -
Proz.-Bev.:
gegen
- Beklagte/Berufungsbeklagte -
Proz.-Bev.:
hat das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg - 6. Kammer - durch den Vorsitzen-den Richter am Landesarbeitsgericht Müller, den ehrenamtlichen Richter Denkers und die ehrenamtliche Richterin Höppner auf die mündliche Verhandlung vom 07.05.2015
für Recht erkannt:
1. Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Arbeitsgerichts Stuttgart vom 12.08.2014, Az. 5 Ca 751/14, wird zurückgewiesen.
2. Die Klägerin trägt die Kosten der Berufung.
3. Die Revision wird zugelassen.
Tatbestand
Die Parteien streiten über das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses seit 9. Februar 2004 und die Beschäftigung der Klägerin.
Zwischen der am 00.00.1972 geborenen, verheirateten und zwei Kindern unterhaltsverpflich-teten Klägerin und der I. GmbH (Vertragsarbeitgeberin) bestand auf der Grundlage des An-stellungsvertrags vom 4. Februar 2004 (Bl. 7 bis 12 d. A.) seit 9. Februar 2004 ein Arbeits-verhältnis. Die Vertragsarbeitgeberin verfügt ausweislich der Urkunde vom 22. April 1998 (Bl. 305 d. A.) seit dem 9. Mai 1995 über eine uneingeschränkte Erlaubnis zur gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung. Die Vertragsarbeitgeberin setzte die Klägerin von Anbeginn des Arbeitsverhältnisses an bei der Beklagten, einer Automobilherstellerin, mit der die Vertrags-arbeitgeberin als „Werkvertrag“ bezeichnete Verträge über die Erbringung von CAD-Konstruktionsleistungen abgeschlossen hatte, in deren Werk in S-U. im Bereich „Technischer Anwendungssupport“ als CAD-Konstrukteurin (technische Zeichnerin) ein. Für die Abwicklung der Verträge waren auf Seite der Vertragsarbeitgeberin und der Beklagten jeweils Ansprechpartner benannt. Ab 2011 umfassten die von der Vertragsarbeitgeberin zu erbrin-genden Konstruktionsleistungen die AdBlue-Tank-Konstruktionen für die Lkw-Entwicklung, Abteilung TP/ESW.
Die Klägerin arbeitete aufgrund einer Vertragsänderung vom 19. Dezember 2011 (Bl. 13 d. A.) an vier Tagen pro Woche 20 Stunden in der Abteilung TP/ESW der Beklagten und er-zielte einen durchschnittlichen Bruttomonatsverdienst von 1.822,63 €. Der Vertrag der Be-klagten mit der Vertragsarbeitgeberin endete zum 31. Dezember 2013. Diese kündigte das mit der Klägerin abgeschlossene Arbeitsverhältnis mit Schreiben vom 29. Oktober 2013 (Bl. 15 d. A.) unter Berufung auf betriebsbedingte Gründe zum 31. Januar 2014. Über die hiergegen von der Klägerin erhobene Kündigungsschutzklage ist noch nicht entschieden worden.
Die Klägerin hat vorgetragen,
der Betrieb der Vertragsarbeitgeberin sei vollumfänglich auf die Beklagte übergegangen. Die Betriebsstätte, in der die Klägerin gearbeitet habe, die Einrichtungen und das sonstige Per-sonal des Teams mit Ausnahme eines ebenfalls bei der Vertragsarbeitgeberin beschäftigten Kollegen der Klägerin seien noch vorhanden. Die Identität der wirtschaftlichen Einheit sei gewahrt, Veränderungen der betrieblichen Organisation seien nicht erfolgt. Der Teilbetrieb, in dem die Klägerin tätig war, werde aufgrund Rechtsgeschäfts, nämlich der Abwicklung des auslaufenden Vertrages, von der Beklagten ohne Unterbrechung fortgeführt. Alle von der Klägerin ausgeführten Aufgaben würden weiterhin im Betrieb der Beklagten erledigt.
Allerdings sei bereits zuvor ein Arbeitsverhältnis zwischen der Klägerin und der Beklagten zustande gekommen, da die Klägerin bereits von Anfang an im Rahmen eines sogenannten Werkvertrages ihrer Vertragsarbeitgeberin der Beklagten als CAD-Konstrukteurin überlassen worden sei. Bei der Vereinbarung zwischen der Beklagten und der Vertragsarbeitgeberin der Klägerin handle es sich um einen Scheinwerkvertrag und in Wirklichkeit um nicht genehmigte und den Anforderungen des § 12 AÜG nicht entsprechende Arbeitnehmerüberlassung. Von ihrer Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung habe die Vertragsarbeitgeberin im konkreten Fall keinen Gebrauch gemacht. Der sich über fast 10 Jahre erstreckende Einsatz der Klägerin im Betrieb der Beklagten sei auch nicht mehr als vorübergehende Überlassung im Sinne des § 1 AÜG anzusehen. Die Klägerin sei vollständig in das überwiegend aus Arbeitnehmern der Beklagten bestehende Team integriert gewesen. Sie habe im laufenden Geschäft den Anweisungen der in der Hierarchie der Betriebsorganisation übergeordneten Mitarbeitern der Beklagten unterlegen. Arbeitsanweisungen habe sie stets über E-Mail von verschiedenen Mitarbeitern der Beklagten (s. Bl. 52 bis 228 d. A.) und persönlich (vgl. Bl. 229 bis 240 d. A.) erhalten, jedoch zu keinem Zeitpunkt durch die Vertragsarbeitgeberin. Abstimmungsgesprä-che hätten grundsätzlich mit dem für die Entwicklung und Betreuung des Projektes „AdBlue-Tank-25 Liter“ zuständigen Ingenieur, stattgefunden, der ihr Vorgesetzter und Ansprechpart-ner gewesen sei. Sie habe mit den zuständigen Stellen der Beklagten ihre Urlaubsplanung abgestimmt, während die Vertragsarbeitgeberin vom gewährten Urlaub nur nachrichtlich Kenntnis erhalten habe, um diese Information in den Vergütungsabrechnungen der Klägerin verwerten zu können. In gleicher Weise habe sie sich im Falle der Arbeitsunfähigkeit zunächst bei der Beklagten krank gemeldet; die Vertragsarbeitgeberin habe schließlich nachrichtlich zum Zwecke der Lohnabrechnung ebenfalls Kenntnis erhalten.
Die Klägerin hat beantragt:
1. Es wird festgestellt, dass zwischen den Parteien ein Arbeitsverhältnis besteht.
2. Die Beklagte wird verurteilt, die Klägerin als CAD-Konstrukteurin entsprechend ihrer bisherigen Tätigkeit in der Lkw-Entwicklung, Technischer Anwendungs-support, Abteilung TP/ESW zu beschäftigen.
Die Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen.
Die Beklagte hat vorgetragen,
ein Betriebsübergang habe nicht stattgefunden. Die Klägerin habe nicht substantiiert zu den einzelnen Voraussetzungen nach § 613 a BGB vorgetragen.
Zwischen ihr und der Klägerin hätten zu keinem Zeitpunkt vertragliche Beziehungen bestan-den. Der Klägerin und ihrem Kollegen sei ein klar abgetrennter und als Fremdfirmenarbeits-platz ausgewiesener Arbeitsplatz in der Abteilung TP/ESW zugewiesen gewesen. Es handle sich um ein Großraumbüro, in dem die Arbeitsplätze der Klägerin und ihres Kollegen abge-trennt und eigens gekennzeichnet gewesen seien. Bei allen von der Klägerin vorgelegten E-Mails handle es sich um Konkretisierungen der zu erbringenden Werkleistungen, für die die Klägerin als Erfüllungsgehilfin von der Vertragsarbeitgeberin bei der Beklagten eingesetzt worden sei. Welche Teile wie konstruiert und gezeichnet werden müssen und welche Erfor-dernisse hierbei beachtet werden sollen, könne naturgemäß zum Zeitpunkt des Abschlusses des Werkvertrages noch nicht feststehen und bedürfe daher zwingend einer weiteren Kon-kretisierung. Die Klägerin sei zu keinem Zeitpunkt in die Organisation der Beklagten einge-gliedert gewesen. Auch eine - nicht vorliegende - Eingliederung der Klägerin in den Betrieb der Beklagten hätte nur zur Folge, dass das zwischen der Beklagten und der Vertragsarbeit-geberin bestehende Vertragsverhältnis nicht als Werkvertrag, sondern als Arbeitnehmerüber-lassung zu qualifizieren wäre. § 10 Abs. 1 AÜG fingiere nach der Rechtsprechung des Bun-desarbeitsgerichts das Zustandekommen eines Arbeitsverhältnisses ausschließlich bei feh-lender Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis des Verleihers. Alle anderen Verstöße gegen das AÜG führten nicht zur Unwirksamkeit des Arbeitsverhältnisses zwischen Leiharbeitnehmer und Verleiher. Die vom Gesetzgeber getroffene Entscheidung dürfe auch nicht über § 242 BGB umgangen werden.
Das Arbeitsgericht hat mit dem am 12. August 2014 verkündeten Urteil die Klage abgewie-sen. Zur Begründung hat es ausgeführt, ein Betriebsübergang sei nicht schlüssig dargelegt. Zwischen den Parteien sei auch kein Arbeitsverhältnis nach § 10 Abs. 1 Satz 1 iVm. § 9 Nr. 1 AÜG zustande gekommen. Ausgehend von den Rechtssätzen in der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 18. Januar 2012 (7 AZR 723/10) lasse sich auch aus der tat-sächlichen Handhabung des Einsatzes der Klägerin bei der Beklagten nicht auf eine Arbeit-nehmerüberlassung schließen. Bei den von der Klägerin vorgelegten E-Mails handle es sich um projektbezogene Anweisungen. Es sei nicht ersichtlich, dass die Klägerin zeitlich in den Betrieb der Beklagten eingegliedert war. Die Klägerin habe nicht behauptet, dass sie hin-sichtlich Arbeitszeitbeginn und Arbeitszeitende sowie Pausen an Weisungen der Beklagten gebunden gewesen sei. Ausweislich der von der Klägerin vorgelegten E-Mails habe sie die Beklagte über ihr Arbeitsende nur informiert. Dies sei aber nicht genehmigungsbedürftig ge-wesen. Dasselbe gelte für Urlaub und Krankheit. Dass die Klägerin sich bei der Beklagten krankgemeldet habe, sei unerheblich, weil die Klägerin nicht vorgetragen habe, dass die Par-teien des als „Werkvertrag“ bezeichneten Vertrages Kenntnis davon hatten. Dasselbe gelte für den Fall, dass die Klägerin sich bei Fachvertretern der Beklagten gemeldet habe, wenn sie mit der Arbeit fertig gewesen sei. Auch die gelegentliche Teilnahme an internen Besprechungen sei kein Indiz für eine Weisungsunterworfenheit. Im „Who is Who“ der Beklagten sei die Klägerin deutlich als Fremdmitarbeiterin gekennzeichnet gewesen. Auch der Werksausweis habe eine andere Farbe gehabt.
Selbst wenn ein verdeckter Arbeitnehmerüberlassungsvertrag vorgelegen habe, führe dies nicht zur Rechtsfolge eines Arbeitsverhältnisses mit der Beklagten. Die der Vertragsarbeit-geberin erteilte Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis schließe eine Anwendung von § 10 Abs. 1 Satz 1 iVm. § 9 AÜG aus. Die fehlende Kenntnis der Klägerin von der Arbeitnehmer-überlassungserlaubnis ihrer Vertrags Arbeitgeberin sei unerheblich. Ein Eingriff sei nur ver-hältnismäßig, wenn der Vertragsarbeitgeber sich unter Umgehung der durch § 3 AÜG be-zweckten Seriositätskontrolle betätigte. Im vorliegenden Fall sei ihm die Arbeitnehmerüber-lassungserlaubnis nicht entzogen worden. Das Interesse der Klägerin sei durch § 10 Abs. 4 AÜG ausreichend geschützt.
Das Arbeitsgericht hat das vollständig abgefasste Urteil am 4. September 2014 zur Post ge-geben. Das nicht ausgefüllte Empfangsbekenntnis des Prozessbevollmächtigten der Klägerin trägt den Eingangsstempel des Arbeitsgerichts vom 9. September 2014. Am Montag, den 6. Oktober 2014, ist die Berufung der Klägerin beim Landesarbeitsgericht eingegangen und deren Begründung innerhalb der bis 5. Dezember 2014 verlängerten Frist am 5. Dezember 2014. Mit einem weiteren am 10. April 2015 beim Landesarbeitsgericht eingegangenen Schriftsatz hat die Klägerin neuen Sachvortrag geleistet.
Die Klägerin trägt vor und ist der Ansicht,
bei dem zwischen der Vertragsarbeitgeberin und der Beklagten geschlossenen Vertrag han-dele es sich um einen Scheinwerkvertrag, in Wirklichkeit habe Arbeitnehmerüberlassung vorgelegen. Nach dem vorgelegten E-Mail-Verkehr sei die Klägerin vollständig in den Be-triebsablauf der Beklagten integriert gewesen. Die von der Beklagten erteilten detaillierten Vorgaben widersprächen dem Wesen eines Werkvertrages. Die Klägerin habe Arbeitsleistung und kein Werk erbringen müssen. Es sei völlig offen, welchen Erfolg die Vertragsarbeit-geberin der Klägerin geschuldet habe. Kalkulationsbasis sei die Zahl der Arbeitsstunden ge-wesen. Die Klägerin habe von der Möglichkeit der Gleitzeit Gebrauch gemacht und sich an den zeitlichen Rahmen der Beklagten gehalten. Die Klägerin habe ihre Arbeitsunfähigkeit zuerst der Beklagten gemeldet und erst dann ihrer Vertragsarbeitgeberin unter Vorlage der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Ihre Vertragsarbeitgeberin habe Entgeltfortzahlung bezahlt. Auch ihren Urlaub habe die Klägerin mit der Beklagten abgestimmt. Er sei von ihrer Vertragsarbeitgeberin genehmigt worden.
Im nachgeschobenen Schriftsatz behauptet die Klägerin,
der Urlaub sei von der Beklagten genehmigt worden. Außer dem Shortmeeting Truck am 27. Februar 2012, habe die Klägerin an weiteren Meetings und Schulungen am 7. Juli 2011, 12. Juni 2012, 11. Juni 2013 und 15. Mai 2013 teilgenommen. Persönliche Vorstellungsge-spräche mit der Vertragsarbeitgeberin habe es nie gegeben. Die Personalauswahl sei stets von Mitarbeitern der Beklagten entweder persönlich vorgenommen oder jedenfalls genehmigt worden. Ihre Arbeitsleistung habe die Klägerin ausschließlich an einem CAD-Arbeitsplatz der Beklagten mit deren Software erbracht.
Wegen der Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die in beiden Instanzen gewechselten Schriftsätze und Anlagen, den Tatbestand des erstinstanzlichen Urteils und die Sit-zungsniederschriften vom 14. März 2014, 12. August 2014 und 7. Mai 2015 ergänzend Bezug genommen.
Entscheidungsgründe
Die Berufung der Klägerin ist zulässig aber nicht begründet.
I.
Die Berufung der Klägerin ist statthaft (§ 64 Abs. 1 und 2 ArbGG), sie ist form- und fristge-recht eingelegt und begründet worden (§§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 Satz 1 ArbGG, 519 Abs. 1 und 2, 520 Abs. 3 ZPO) und auch im Übrigen zulässig. Da das Urteil vom Arbeitsgericht erst am 4. September 2014 zur Post gegeben worden ist, kann es dem Prozessbevollmächtigten der Klägerin frühestens einen Tag später zugegangen sein. Die Berufungsfrist lief daher frü-hestens am Montag, den 6. Oktober 2014 ab. An diesem Tag ist die Berufung beim Landes-arbeitsgericht eingegangen. Die Frist ist deshalb gewahrt.
II.
Die Berufung ist nicht begründet.
1. Die zutreffenden Ausführungen des Arbeitsgerichts zum Fehlen eines schlüssigen Vor-trags, aus dem die Rechtsfolge eines Betriebsübergangs nach § 613a BGB, ableitbar wä-re, greift die Berufung nicht an. Infolge Betriebsübergang ist das Arbeitsverhältnis der Klägerin daher nicht von ihrer Vertragsarbeitgeberin auf die Beklagte übergegangen.
2. Ergänzend zum Urteil des Arbeitsgerichts ist darauf hinzuweisen, dass die Parteien ein Arbeitsverhältnis weder ausdrücklich noch konkludent vereinbart haben. Zwischen den Parteien bestehen keine vertraglichen Beziehungen. Eine bloße Eingliederung ohne Ver-trag führt nicht zu einem Arbeitsverhältnis (LAG Baden-Württemberg 18. Dezember 2014, 3 Sa 33/14, Rn. 37 der Gründe, 3. Dezember 2014, 4 Sa 41/14 Rn. 84 der Gründe).
3. Dahinstehen kann, ob es sich bei den zwischen der Vertragsarbeitgeberin der Klägerin und der Beklagten als Werkvertrag bezeichneten Verträgen um Scheinwerkverträge gehandelt hat und in Wirklichkeit eine Arbeitnehmerüberlassung vorlag, da die Vertragsarbeitgeberin der Klägerin für die Gesamtdauer des Einsatzes der Klägerin bei der Beklagten über eine unbeschränkte Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis verfügt hat und selbst wenn man aus deren fehlender Offenlegung durch die Vertragsarbeitgeberin und die Beklagte deren Berufung auf die Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis gegenüber der Klägerin als treuwidrig ansehen wollte, sich hieraus jedenfalls nicht die Rechtsfolge der Fiktion eines Arbeitsverhältnisses mit der Beklagten ergibt.
a) Ist der Vertrag zwischen einem Verleiher und einem Leiharbeitnehmer nach § 9 Nr. 1 unwirksam, so gilt ein Arbeitsverhältnis zwischen Entleiher und Leiharbeitnehmer zu dem zwischen dem Entleiher und dem Verleiher für den Beginn der Tätigkeit vorgese-henen Zeitpunkt als zu Stande gekommen (§ 10 Abs. 1 Satz HS 1 AÜG). Gemäß § 9 Nr. 1 AÜG sind Verträge zwischen Verleiher und Entleiher sowie zwischen Verleihern und Leiharbeitnehmern (nur) unwirksam, wenn der Verleiher nicht die nach § 1 erfor-derliche Erlaubnis hat.
Diese Voraussetzungen liegen im vorliegenden Fall erkennbar nicht vor. Die Vertrags-arbeitgeberin der Klägerin hat zu jedem Zeitpunkt der Tätigkeit der Klägerin bei der Beklagten über eine unbeschränkte Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis verfügt. Bei dieser Erlaubnis handelt es sich um einen Verwaltungsakt der Arbeitsverwaltung. Dies ergibt sich aus § 2 und § 17 Abs. 1 AÜG. Die Erlaubnis fehlt nur, wenn der Verwal-tungsakt rechtlich nicht existent ist. Das AÜG enthält keine Regelungen zur Wirksam-keit. Deshalb ist das VwVfG ergänzend heranzuziehen. Danach ist die Überlassungs-erlaubnis unwirksam, wenn sie niemals bekannt gegeben (§ 43 Abs. 1 VwVfG) oder nachträglich aufgehoben wurde (§ 43 Abs. 2 VwVfG iVm. §§ 4, 5 AÜG) oder nichtig ist (§§ 43 Abs. 3, 44 VwVfG). Aus der Absicht des Antragstellers, die Erlaubnis nur als „Rettungsanker“ für den Fall des Vorliegens eines Scheinwerkvertrages zu nutzen, kann man die Nichtigkeit der Überlassungserlaubnis nicht ableiten, weil es sich nicht um einen nach § 44 Abs. 1 VwVfG erforderlichen offensichtlichen, besonders schwer-wiegenden Fehler handelt. Die beim Antragsteller vorhandene Absicht, die Erlaubnis nur als "Vorratserlaubnis“ einsetzen zu wollen, steht dem Verwaltungsakt nicht „auf der Stirn geschrieben" (vgl. Hamann, NZA 2015, 449 ff., 450 mwN.). Die Überlassungserlaubnis ist dem Antragsteller gegenüber auch bekannt gegeben und nicht nachträglich aufgehoben worden. Die Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis war demzufolge während der gesamten Dauer des Einsatzes der Klägerin bei der Beklagten wirksam erteilt.
b) Eine analoge Anwendung der §§ 9 Nr. 1, 10 Abs. 1 Satz 1 AÜG kommt nicht in Be-tracht. Die verdeckte Arbeitnehmerüberlassung ist in dieser Hinsicht vergleichbar mit der nicht nur vorübergehenden Überlassung. In beiden Fällen wird gravierend gegen das AÜG verstoßen, eine Überlassungserlaubnis liegt aber vor. Deshalb sind die Gründe, mit denen das Bundesarbeitsgericht (10. Dezember 2013, 9 AZR 51/13) eine Analogie der §§ 9 Nr. 1, 10 Abs. 1 Satz 1 AÜG bei der Dauerüberlassung abgelehnt hat, auf Scheinwerkverträge übertragbar. Es fehlt bereits eine planwidrige Regelungslücke. Obwohl die Problematik der Scheinwerkverträge seit längerer Zeit bekannt ist, hat der Gesetzgeber auf eine Gleichstellung der verdeckten mit der erlaubnislosen Überlassung verzichtet. Zudem kann es durchaus im Interesse des überlassenen Arbeitnehmers liegen, bei seinem bisherigen Arbeitgeber zu verbleiben, so dass es auch insoweit an einer Vergleichbarkeit mit der erlaubnislosen Überlassung fehlt (vgl. Hamann aaO 451 mwN, LAG Baden-Württemberg 3. Dezember 2014, 4 Sa 41/14 Rn. 84 der Gründe).
c) Ob ein Rechtsmissbrauch vorliegt und daher die Berufung der Parteien des dem Einsatz der Klägerin bei der Beklagten zu Grunde liegenden Vertragsverhältnisses auf die nicht offen gelegte Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis gemäß § 242 BGB treuwidrig ist, kann dahinstehen, weil eine etwaige Treuwidrigkeit jedenfalls nicht die Rechtsfolge der §§ 9 Nr. 1, 10 Abs. 1 Satz 1 AÜG, nämlich der gesetzlichen Begründung eines Ar-beitsverhältnisses mit der Entleiherin, auslöst.
aa) Ein institutioneller Rechtsmissbrauch liegt nicht vor (LAG Baden-Württemberg aaO Rn. 95 bis 98 der Gründe, LAG Baden-Württemberg 10. Oktober 2014, 17 Sa 22/14 mwN.). Allenfalls kommt widersprüchliches Verhalten (venire contra factum prorium, so LAG Baden-Württemberg 3. Dezember 2014, 4 Sa 41/14 Rn. 100 ff. der Gründe oder exceptio doli praetereti, so Hamann aaO 451) in Betracht.
bb) Rechtsfolge des individuellen Rechtsmissbrauchs ist, dass die Ausübung eines (existierenden) Rechts aufgrund besonderer Umstände als treuwidrig angesehen und deshalb untersagt wird. Liegt der Rechtsmissbrauch in der Vereitelung von Rechten der Gegenpartei, so wird ihr eine Rechtsstellung zuerkannt, als ob das Verhalten nicht ausgeübt worden wäre. Maßgeblich ist der Schutzzweck des Ge-setzes und die Frage, ob der Missbrauch der Verhinderung der gesetzlich an sich vorgesehenen Begründung eines Vertragsverhältnisses oder lediglich der Verkür-zung einzelner Ansprüche dient (vgl. Hamann aaO 452 mwN). Liegt ein Schein-werkvertrag vor, ist rechtstatsächlich Arbeitnehmerüberlassung gegeben. Im Ver-leiher hat der Arbeitnehmer einen Arbeitgeber. Durch die fehlende Offenlegung der Arbeitnehmerüberlassung verschlechtert sich die Situation des Arbeitnehmers nur insofern, als ihm insbesondere die Gleichstellung mit einem vergleichbaren Arbeit-nehmer des Entleihers gemäß § 10 Abs. 4 Satz 1 AÜG versagt wird. Nach Treu und Glauben muss er daher vertraglich und wirtschaftlich (nur) so gestellt werden, als hätte er von vornherein seine Rechte als Leiharbeitnehmer wahrnehmen kön-nen. Nur weil die Arbeitnehmerüberlassung verdeckt war, ergeben sich keine wei-tergehenden Rechte gegenüber einem Arbeitnehmer, der von vornherein im Rah-men einer erlaubten Arbeitnehmerüberlassung gearbeitet hat (zu Recht Hamann aaO 452). Eine Überdehnung der Rechtsfolge aus § 242 BGB dahin, dass gem. §§ 9 Nr. 1, 10 Abs. 1 Satz 1 AÜG ein Arbeitsverhältnis mit der Entleiherin begründet wird, kommt faktisch einer analogen Anwendung der §§ 9 Nr. 1, 10 Abs. 1 Satz 1 AÜG gleich, die - wie oben dargestellt - aufgrund bisher fehlender Initiative des Gesetzgebers ausgeschlossen ist. Ein Arbeitsverhältnis mit der Beklagten ist nicht zustande gekommen. Die Klage und die Berufung sind unbegründet.
III.
Die Klägerin trägt die Kosten ihres erfolglosen Rechtsmittels, § 97 Abs. 1 ZPO.
IV.
Die Revision wird wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtsfragen „analoge Anwendung der §§ 9 Nr. 1, 10 Abs. 1 Satz 1 AÜG auf die verdeckte Arbeitnehmerüberlassung“ und „Rechtsfolge einer treuwidrigen Berufung auf die gegenüber dem Arbeitnehmer nicht offen gelegte Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis“ gem. § 72 Abs. 2 Nr. 1 ArbGG zugelassen.
Müller
Denkers
Höppner
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gern:
 |
Dr. Martin Hensche Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hensche@hensche.de |
 |
Christoph Hildebrandt Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hildebrandt@hensche.de |
 |
Nina Wesemann Rechtsanwältin Fachanwältin für Arbeitsrecht Kontakt: 040 / 69 20 68 04 wesemann@hensche.de |