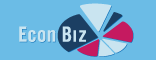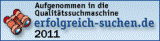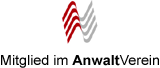- -> zur Mobil-Ansicht
- Arbeitsrecht aktuell
- Tipps und Tricks
- Handbuch Arbeitsrecht
- Gesetze zum Arbeitsrecht
- Urteile zum Arbeitsrecht
- Urteile 2023
- Urteile 2021
- Urteile 2020
- Urteile 2019
- Urteile 2018
- Urteile 2017
- Urteile 2016
- Urteile 2015
- Urteile 2014
- Urteile 2013
- Urteile 2012
- Urteile 2011
- Urteile 2010
- Urteile 2009
- Urteile 2008
- Urteile 2007
- Urteile 2006
- Urteile 2005
- Urteile 2004
- Urteile 2003
- Urteile 2002
- Urteile 2001
- Urteile 2000
- Urteile 1999
- Urteile 1998
- Urteile 1997
- Urteile 1996
- Urteile 1995
- Urteile 1994
- Urteile 1993
- Urteile 1992
- Urteile 1991
- Urteile bis 1990
- Arbeitsrecht Muster
- Videos
- Impressum-Generator
- Webinare zum Arbeitsrecht
-
Kanzlei Berlin
 030 - 26 39 62 0
030 - 26 39 62 0
 berlin@hensche.de
berlin@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Frankfurt
 069 - 71 03 30 04
069 - 71 03 30 04
 frankfurt@hensche.de
frankfurt@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hamburg
 040 - 69 20 68 04
040 - 69 20 68 04
 hamburg@hensche.de
hamburg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hannover
 0511 - 89 97 701
0511 - 89 97 701
 hannover@hensche.de
hannover@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Köln
 0221 - 70 90 718
0221 - 70 90 718
 koeln@hensche.de
koeln@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei München
 089 - 21 56 88 63
089 - 21 56 88 63
 muenchen@hensche.de
muenchen@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Nürnberg
 0911 - 95 33 207
0911 - 95 33 207
 nuernberg@hensche.de
nuernberg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Stuttgart
 0711 - 47 09 710
0711 - 47 09 710
 stuttgart@hensche.de
stuttgart@hensche.de
AnfahrtDetails
ArbG Berlin, Urteil vom 14.11.2011, 36 Ca 3627/11
| Schlagworte: | Menschenrechte, Mobbing, Lohnklage | |
| Gericht: | Arbeitsgericht Berlin | |
| Aktenzeichen: | 36 Ca 3627/11 | |
| Typ: | Urteil | |
| Entscheidungsdatum: | 14.11.2011 | |
| Leitsätze: | ||
| Vorinstanzen: | ||
Arbeitsgericht Berlin
Geschäftszeichen (bitte immer angeben)
36 Ca 3627/11
Verkündet
am 14.06.2011
Gerichtsbeschäftigtek
als Urkundsbeamter/in
der Geschäftsstelle
Im Namen des Volkes
Urteil
In Sachen
- Klägerin -
PP
- Beklagter -
hat das Arbeitsgericht Berlin, 36. Kammer, auf die mündliche Verhandlung vom 14.06.2011
durch den Richter am Arbeitsgericht K als Vorsitzender
sowie die ehrenamtlichen Richter Frau S und Herr M
für Recht erkannt:
I.
Die Klage wird abgewiesen.
II.
Die Kosten des Rechtsstreits hat die Klägerin bei einem Gebührenwert von 71.527,97 EUR zu tragen.
III.
Der Werd des Streitgegenstandes wird auf 70.754,00 EUR festgesetzt.
- 2 -
Tatbestand
Die Rechtsvorgängerin der Klägerin und der Beklagte, beide keine deutschen Staatsangehörigen, standen jedenfalls in einem Arbeitsverhältnis.
Der Beklagte ist als Attache akkreditiertes Mitglied der Botschaft des Königreichs S in Berlin, die Rechtsvorgängerin der Klägerin arbeitete als Hausangestellte im Familienhaushalt des Beklagten.
Im Rahmen der 9. März 2011 bei dem Arbeitsgericht Berlin eingegangenen und dem Beklagten am 15. März 2011 zugestellten Klage trägt die Klägerin vor, Ansprüche aus abgetretenem Recht geltend zu machen. Ihre Rechtsvorgängerin sei mit der Familie des Beklagten nach Berlin gekommen. Dort sei der Reisepass unzugänglich aufbewahrt worden. Die Tätigkeiten im Haushalt seien ausbeuterisch gewesen, ihre Rechtsvorgängerin sei der Freiheit beraubt, zudem seelisch sowie körperlich misshandelt und insbesondere von einer Ehefrau und einem Kind des Beklagten geschlagen worden.
Nachdem sich ihre Rechtsvorgängerin des Reisepasses habe bemächtigen können, sei jene am 30. November 2010 aus der Wohnung in eine Einrichtung für verfolgte Menschen geflüchtet.
Am 15. Februar 2011 habe sie ihre Ansprüche an die Klägerin abgetreten.
Die Klägerin beantragt die Vorlage des Rechtsstreites bei dem Bundesverfassungsgericht gern. Art. 100 Abs. 2 GG bzw. Art. 100 Abs. 1 GG. Des Weiteren regt sie an, durch Anfrage des Gerichts bei der Botschaft des Königreichs S anzufragen, ob seitens des Königreichs S auf die Immunität des Beklagten verzichtet bzw. einem Verzicht durch den Beklagten zugestimmt werde.
Die Klägerin beantragt unter Klagerücknahme im Übrigen,
den Beklagten zu verurteilen, an die Klägerin 1. (Entgeltansprüche) 14.950,00 EUR brutto nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz
- auf den Betrag von 700,00 EUR seit dem 1. Mai 2009,
- 3 -
- auf den Betrag von monatlich jeweils 750,00 EUR seit jedem Monatsanfang von Juni 2009 bis November 2010
zu zahlen;
2. (Überstunden)
15.804,00 EUR nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz
- auf den Betrag von 7.704,00 EUR seit dem 1. Januar 2010 und
- auf den Betrag von 8.100,00 EUR seit dem 1. November 2010 zu zahlen;
3. (Schmerzensgeld)
immateriellen Schadensersatz zu zahlen, dessen Höhe in das Ermessen des Gerichts gestellt wird, dessen Höhe aber 40.000,00 EUR nicht unterschreiten sollte, zudem auf den zugesprochenen Betrag Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Klagezustellung zu zahlen.
Der Beklagte beantragt,
die Klage als unzulässig abzuweisen.
Er trägt vor, er habe Beweismittel in der Hand, die den Vortrag der Klägerin widerlegen würden.
Zudem berufe er sich auf die diplomatische Immunität. Hieraus folge, dass nur eine abgesonderte mündliche Verhandlung über die Immunität zulässig sei, nicht jedoch ein Güte-und Kammertermin. Vorliegend könne bereits nach Aktenlage entschieden werden.
Wegen der Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf den vorgetragenen Inhalt der gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.
- 4 -
Entscheidungsgründe
I. Die Klage war abzuweisen.
1. Die Entscheidung bedurfte der mündlichen Verhandlung durch die Kammer gern. §§ 54, 55 Abs. 2, 57 ArbGG, denn eine Entscheidung von Arbeitsgerichten ist ohne mündliche Verhandlung nur unter der Voraussetzung nach § 55 Abs. 1 Einleitungssatz ArbGG in den in § 55 Abs. 2 ArbGG abschließend aufgeführten Fällen möglich. Die Entscheidung über die Zulässigkeit einer Klage gehört nicht hierzu.
Die Befreiung von der deutschen Gerichtsbarkeit nach § 18 GVG ist ein Verfahrenshindernis, über dessen Vorliegen im Wege eines Zwischenstreits nach §§ 46 Abs. 2 ArbGG, 280 ZPO entschieden werden kann_ Bei einem bestehenden Verfahrenshindernisses ist die Klage jedoch insgesamt durch Prozessurteil als unzulässig abzuweisen (vgl. BAG, Urteil vom 23. November 2000 - 2 AZR 490/99 -, zitiert nach juris).
2. Der Rechtsstreit war zur Entscheidung reif.
a. Es war seitens des erkennenden Gerichts keine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nach Art. 100 Abs. 2 GG darüber einzuholen, welche Reichweite die Regeln des Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen (nachfolgend WÜD) haben.
Nach Art. 31 WÜD genießt ein Diplomat Immunität von der Strafgerichtsbarkeit des Empfangsstaats, ferner steht ihm Immunität von dessen Zivil- und Verwaltungsgerichtsbarkeit zu (Art. 31 Abs. 1 WÜD), abgesehen von hier nicht einschlägigen Ausnahmen. Als Diplomat gelten der Missionschef und die Mitglieder des diplomatischen Personals der Mission (Art. 1 Buchst. e) WÜD). Auf die Immunität von der Gerichtsbarkeit, die einem Diplomaten zusteht, kann der Entsendestaat verzichten (Art. 32 Abs. 1 WÜD), der Verzicht muss stets ausdrücklich erklärt werden (Art. 32 Abs. 2 WÜD).
Weder hinsichtlich des Bestehens noch hinsichtlich der Tragweite dieser allgemeinen Regeln des Völkerrechts liegen objektiv ernstzunehmende Zweifel vor.
Unstreitig ist das Recht des diplomatischen Verkehrs zwischen Staaten in dem einschlägigen Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen als Teil des Völkerrechts kodifiziert (vgl. BVerfG, Beschluss vorn 6. Dezember 2006 - 2 BvM 9/03 -, zitiert nach juris).
Die diplomatische Immunität von rechtlicher Verfolgung kennt grundsätzlich keine Ausnahmen für besonders gravierende Rechtsverstöße; der Diplomat kann in solchen Fällen
- 5 -
nur zur persona non grata (Art. 9 WÜD) erklärt werden. Daneben besteht die Möglichkeit, auf völkerrechtlicher Ebene gegen den Entsendestaat vorzugehen (vgl. auch BVerfG, Beschluss vom 10. Juni 1997 - 2 BvR 1516/96 -, zitiert nach juris). Dies ergibt sich unmittelbar aus dem Sinn der diplomatischen Immunität, die nur eingreift, wenn der Diplomat angeblich oder tatsächlich gegen das Recht des Empfangsstaates verstößt. Immunität zu gewähren, ergibt überhaupt erst bei einer solchen rechtswidrigen Handlung einen Sinn (vgl. BVerfG a.a.O.).
Dürften der Empfangsstaat und also auch seine Gerichte mit anderen als den vom Diplomatenrecht vorgesehenen Mitteln gegen den Diplomaten vorgehen, so würden die Grundlagen der diplomatischen Beziehungen erschüttert, die ein Zusammenleben der Staaten erst ermöglichen. Die Unverletzlichkeit der Diplomaten als eine der ältesten Gewährleistungen des Völkergewohnheitsrechts ist fundamentale Voraussetzung für die Pflege zwischenstaatlicher Beziehungen. Im Verlauf der Geschichte haben daher Staaten aller Kulturen die zu diesem Zweck bestehenden gegenseitigen Verpflichtungen beachtet. Die Institution der Diplomatie mit ihren Privilegien und Immunitäten hat sich im Laufe der Jahrhunderte als unverzichtbares Instrument der effektiven Kooperation innerhalb der internationalen Gemeinschaft erwiesen, das es den Staaten erlaubt, unabhängig von ihren unterschiedlichen Verfassungs- und Sozialsystemen ein gegenseitiges Verständnis zu entwickeln und ihre Meinungsverschiedenheiten mit friedlichen Mitteln beizulegen (vgl. BVerfG a.a.O.).
Die Komplexität der heutigen internationalen Gemeinschaft verlangt mehr denn je, dass die Regeln, die den geordneten Fortschritt der Beziehungen zwischen ihren Mitgliedern sichern, dauerhaft und mit größter Sorgfalt respektiert werden. Zusätzlich ist die besondere Rolle der Gegenseitigkeit im Diplomatenrecht zu beachten: Jeder Empfangsstaat ist zugleich Entsendestaat; jede Einschränkung und jeder Verstoß gegen diplomatische Immunitäten und Vorrechte kann - rechtlich oder faktisch - auf die eigenen Diplomaten und ihre Angehörigen im Ausland zurückwirken (vgl. BVerfG a.a.O.).
Die Regeln des Diplomatenrechts stellen deshalb eine in sich geschlossene Ordnung dar, die die möglichen Reaktionen auf Missbräuche der diplomatischen Vorrechte und Immunitäten abschließend umschreibt (vgl. BVerfG a.a.O.).
b. Auch musste keine Vorlage nach Art. 100 Abs. 1 GG erfolgen.
Ein Gericht kann die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über die Verfassungsmäßigkeit einer Norm nach Art. 100 Abs. 1 GG nur einholen, wenn bei offensichtlich mehreren in Betracht kommenden Auslegungsmöglichkeiten keine
- 6 -
verfassungskonformen Auslegung möglich ist (vgl. BVerfG, Beschluss vom 12. Februar 1992 - 1 BvL 21/88 -, zitiert nach juris).
Zwar wird es aufgrund von § 18 GVG nicht möglich sein, etwaige Ansprüche gegen den Beklagten, den klägerischen Vortrag als wahr unterstellt, vor bundesdeutschen Gerichten für Arbeitssachen geltend zu machen.
Dieses ist aufgrund der hohen Stellung der Institution der Diplomatie hinzunehmen, zumal die Rechtsvorgängerin der Klägerin nicht schutzlos gestellt ist.
Gestützt auf die allgemeinen Aufopferungsgrundsätze hat ein Dritter, der ein Sonderopfer erbracht hat, Anspruch auf Ersatz (vgl. auch BGH, Urteil vorn 3. März 2011 - III ZR 174/10 -, zitiert nach juris).
Denn in dem Fall, dass tatsächlich bestehende Ansprüche der Rechtsvorgängerin der Klägerin gegenüber dem Beklagten nicht gerichtlich geltend gemacht werden können, wird ein Entschädigungsanspruch aufgrund einer rechtmäßigen hoheitliche Maßnahme der Bundesrepublik Deutschland als Gesetzgeber des § 18 GVG bestehen, weil diese Vorschrift zu einem unmittelbaren Eingriff in eine geschützte Eigentümerposition der Rechtsvorgängerin der Klägerin dergestalt geführt hat, dass die schädigende Auswirkung für die konkrete Betätigung hoheitlichen Handelns typisch ist und aus der Eigenart der hoheitlichen Maßnahme folgt. Bei den Nachteilen, die der Rechtsvorgängerin der Klägerin aufgrund der Immunität des Beklagten entstanden sein könnten, dürfte es sich um Nachteile handein, die in einem inneren Zusammenhang mit der schädigenden hoheitlichen Maßnahme stehen und die typischerweise in dieser selbst angelegt, also unmittelbar sein werden (vgl. auch Saarländisches OLG, Urteil vom 19. April 2011 - 4 U 314/10 -, zitiert nach juris).
Ob die Normsetzung als rechtmäßiges hoheitliches Handeln zu einem unzumutbaren Sonderopfer auf Seiten der Rechtsvorgängerin der Klägerin dergestalt geführt hat, dass in eine geschützte Eigentumsposition nach Dauer, Art, Intensität und Auswirkung schwer und unerträglich mit der Folge eingegriffen wurde, dass hieraus Leistungsansprüche gegenüber der Bundesrepublik Deutschland entstanden sein könnten, werden die Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit als die gern. Art 34 Satz 3 GG, § 17 Abs. 2 Satz 2 GVG ausschließlich zuständigen Gerichte zu entscheiden haben.
3. Die Klage hat keinen Erfolg. Da die deutsche Gerichtsbarkeit nicht gegeben ist, war die Klage auf Antrag des Beklagten als unzulässig abzuweisen.
- 7 -
Dabei kann dahinstehen, ob die Klägerin, die aus abgetretenem Recht Ansprüche der der Immunität nach Art. 37 Abs, 4 WÜD unterliegenden Rechtsvorgängerin geltend macht, einer Befreiung nach Art. 32 WÜD bedarf (vgl. zum Streitstand BGH, Beschluss vom 30. März 2011 - XII ZB 300/10 -, zitiert nach juris).
Jedenfalls fehlt es an der Zuständigkeit der deutschen Gerichtsbarkeit, weil Immunität des Beklagten nach § 18 GVG besteht.
Gemäß Art. 31 Abs. 1 Satz 2 WÜD genießt der Diplomat grundsätzlich Immunität von der
Zivilgerichtsbarkeit des Empfangsstaats. Das Königreich S ist dem WÜD am 12.
März 1981 beigetreten (BGBl. 11 1981 S. 572). Der Beklagte ist unstreitig als Mitglied des diplomatischen Personals zur Diplomatenliste angemeldet und damit Diplomat im Sinne von Art. 31 Abs. 1, Art. 1 Buchst. e) WÜD.
Der Entsendestaat hat nicht auf die Immunität von den Gerichten für Arbeitssachen verzichtet, Art. 32 Abs. 1, 2 WÜD. Dabei ist es nicht Aufgabe des erkennenden Gerichts, den Entsendestaat des Beklagten zu einer Erklärung über einen Verzicht nach Art. 32 WÜD aufzufordern, vielmehr hat die klagende Partei die zur Zulässigkeit ihrer Klage führenden Umstände selbst herbeizuführen. Ein Verzicht kann zudem auch nicht daraus hergeleitet werden, dass sich der Beklagte im vorliegenden Verfahren auf die Klage eingelassen hat (vgl. auch BGH, Beschluss vom 28. Mai 2003 - IXa ZB 19/03 -, zitiert nach juris).
Daher ist der Beklagte gern. § 18 GVG als Mitglied einer bei der Bundesrepublik Deutschland beglaubigten diplomatischen Vertretung der deutschen Gerichtsbarkeit entzogen (vgl. auch BAG, Urteil vom 25. Januar 1973 - 5 AZR 399/72 -, zitiert nach juris).
II. Bei der einheitlichen Kostenentscheidung war zwischen den Kosten des durch Klagerücknahme beendeten und des noch streitigen Teils des Rechtsstreites zu unterscheiden.
1. Hinsichtlich des durch Rücknahme beendeten Teils waren die Kosten gemäß §§ 46 Abs. 2 ArbGG, 269 Abs. 3 ZPO der Klägerin aufzuerlegen.
2. Im Übrigen unterliegt die Klägerin, weshalb sie die Kosten gern. §§ 46 Abs. 2 ArbGG, 91 ZPO zu tragen hat.
III. Die Entscheidung über den Streitwert folgt aus §§ 61 Abs. 1, 46 Abs. 2 ArbGG, 3, 5 ZPO
- 8 -
Rechtsmittelbelehrung
Gegen dieses Urteil kann von d. Klägerin Berufung eingelegt werden.
Die Berufungsschrift muss von einem Rechtsanwalt oder einem Vertreter einer Gewerkschaft bzw. einer Arbeitgebervereinigung oder eines Zusammenschlusses solcher Verbände eingereicht werden.
Die Berufungsschrift muss innerhalb
einer Notfrist von einem Monat
bei dem
Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg,
Magdeburger Platz 1,
10785 Berlin,
eingegangen sein. Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass Berufung gegen dieses Urteil eingelegt werde.
Die Berufung ist gleichzeitig oder innerhalb
einer Frist von zwei Monaten
in gleicher Form schriftlich zu begründen.
Der Schriftform wird auch durch Einreichung eines elektronischen Dokuments im Sinne des § 46 c ArbGG genügt. Nähere Informationen dazu finden sich auf der Internetseite unter www.berlin.de/erv.
Beide Fristen beginnen mit der Zustellung des in vollständiger Form abgesetzten Urteils, spätestens aber mit Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung.
Dabei ist zu beachten, dass das Urteil mit der Einlegung in den Briefkasten oder einer ähnlichen Vorrichtung für den Postempfang als zugestellt gilt. Wird bei der Partei eine schriftliche Mitteilung abgegeben, dass das Urteil auf der Geschäftsstelle eines Amtsgerichts oder einer von der Post bestimmten Stelle niedergelegt ist, gilt das Schriftstück mit der Abgabe der schriftlichen Mitteilung als zugestellt, also nicht erst mit der Abholung der Sendung. Das Zustellungsdatum ist auf dem Umschlag der Sendung vermerkt.
Für d. Beklagten ist keine Berufung gegeben.
Von der Begründungsschrift werden zwei zusätzliche Abschriften zur Unterrichtung der ehrenamtlichen Richter erbeten.
Weitere Statthaftigkeitsvoraussetzungen ergeben sich aus § 64 Abs. 2 ArbGG: „Die Berufung kann nur eingelegt werden,
a) wenn sie in dem Urteil zugelassen worden ist,
b) wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 600 EUR übersteigt,
c) in Rechtsstreitigkeiten über das Bestehen, das Nichtbestehen oder die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses oder
d) wenn es sich um ein Versäumnisurteil handelt, gegen das der Einspruch an sich nicht statthaft ist, wenn die Berufung oder Anschlussberufung darauf gestützt wird, dass der Fall schuldhafter Versäumung nicht vorgelegen habe."
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gern:
 |
Dr. Martin Hensche Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hensche@hensche.de |
 |
Christoph Hildebrandt Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hildebrandt@hensche.de |
 |
Nina Wesemann Rechtsanwältin Fachanwältin für Arbeitsrecht Kontakt: 040 / 69 20 68 04 wesemann@hensche.de |