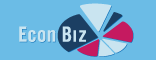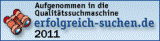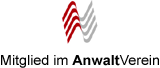- -> zur Mobil-Ansicht
- Arbeitsrecht aktuell
- Tipps und Tricks
- Handbuch Arbeitsrecht
- Gesetze zum Arbeitsrecht
- Urteile zum Arbeitsrecht
- Urteile 2023
- Urteile 2021
- Urteile 2020
- Urteile 2019
- Urteile 2018
- Urteile 2017
- Urteile 2016
- Urteile 2015
- Urteile 2014
- Urteile 2013
- Urteile 2012
- Urteile 2011
- Urteile 2010
- Urteile 2009
- Urteile 2008
- Urteile 2007
- Urteile 2006
- Urteile 2005
- Urteile 2004
- Urteile 2003
- Urteile 2002
- Urteile 2001
- Urteile 2000
- Urteile 1999
- Urteile 1998
- Urteile 1997
- Urteile 1996
- Urteile 1995
- Urteile 1994
- Urteile 1993
- Urteile 1992
- Urteile 1991
- Urteile bis 1990
- Arbeitsrecht Muster
- Videos
- Impressum-Generator
- Webinare zum Arbeitsrecht
-
Kanzlei Berlin
 030 - 26 39 62 0
030 - 26 39 62 0
 berlin@hensche.de
berlin@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Frankfurt
 069 - 71 03 30 04
069 - 71 03 30 04
 frankfurt@hensche.de
frankfurt@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hamburg
 040 - 69 20 68 04
040 - 69 20 68 04
 hamburg@hensche.de
hamburg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hannover
 0511 - 89 97 701
0511 - 89 97 701
 hannover@hensche.de
hannover@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Köln
 0221 - 70 90 718
0221 - 70 90 718
 koeln@hensche.de
koeln@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei München
 089 - 21 56 88 63
089 - 21 56 88 63
 muenchen@hensche.de
muenchen@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Nürnberg
 0911 - 95 33 207
0911 - 95 33 207
 nuernberg@hensche.de
nuernberg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Stuttgart
 0711 - 47 09 710
0711 - 47 09 710
 stuttgart@hensche.de
stuttgart@hensche.de
AnfahrtDetails
EuGH, Urteil vom 05.03.2009, C-350/07 - Kattner Stahlbau
| Schlagworte: | Unfallversicherung | |
| Gericht: | Europäischer Gerichtshof | |
| Aktenzeichen: | C-350/07 | |
| Typ: | Urteil | |
| Entscheidungsdatum: | 05.03.2009 | |
| Leitsätze: | ||
| Vorinstanzen: | Vorabentscheidungsersuchen eingereicht vom Sächsischen Landessozialgericht (Deutschland) | |
URTEIL DES GERICHTSHOFS (Dritte Kammer)
5. März 2009(*)
„Wettbewerb – Art. 81 EG, 82 EG und 86 EG – Pflichtversicherung gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten – Begriff ‚Unternehmen‘ – Missbrauch einer beherrschenden Stellung – Freier Dienstleistungsverkehr – Art. 49 EG und 50 EG – Beschränkung – Rechtfertigung – Erhebliche Gefährdung des finanziellen Gleichgewichts des Systems der sozialen Sicherheit“
In der Rechtssache C‑350/07
betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 234 EG, eingereicht vom Sächsischen Landessozialgericht (Deutschland) mit Entscheidung vom 25. Juli 2007, beim Gerichtshof eingegangen am 30. Juli 2007, in dem Verfahren
Kattner Stahlbau GmbH
gegen
Maschinenbau- und Metall-Berufsgenossenschaft
erlässt
DER GERICHTSHOF (Dritte Kammer)
unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten A. Rosas, der Richter A. Ó Caoimh (Berichterstatter), J. Klučka und U. Lõhmus sowie der Richterin P. Lindh,
Generalanwalt: J. Mazák,
Kanzler: R. Grass,
aufgrund des schriftlichen Verfahrens,
unter Berücksichtigung der Erklärungen
– der Kattner Stahlbau GmbH, vertreten durch Rechtsanwalt R. Mauer,
– der Maschinenbau- und Metall-Berufsgenossenschaft, vertreten durch Rechtsanwalt H. Plagemann,
– der deutschen Regierung, vertreten durch M. Lumma und J. Möller als Bevollmächtigte,
– der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch V. Kreuschitz und O. Weber als Bevollmächtigte,
nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 18. November 2008
folgendes
Urteil
| 1 |
Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung der Art. 49 EG und 50 EG sowie der Art. 81 EG, 82 EG und 86 EG. |
| 2 |
Dieses Ersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Kattner Stahlbau GmbH (im Folgenden: Kattner) und der Maschinenbau- und Metall-Berufsgenossenschaft (im Folgenden: MMB) über die Pflichtmitgliedschaft von Kattner bei dieser Berufsgenossenschaft im Rahmen der gesetzlichen Versicherung gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten. Nationales Recht |
| 3 |
In Deutschland ist das gesetzliche System der Versicherung gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Siebten Buch des Sozialgesetzbuchs (Gesetz vom 7. August 1996, BGBl 1998 I S. 1254, im Folgenden: SGB VII) geregelt, das am 1. Januar 1997 in Kraft trat. § 1 SGB VII sieht vor, dass diese Versicherung zur Aufgabe hat, „1. mit allen geeigneten Mitteln Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten sowie arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhüten, 2. nach Eintritt von Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit der Versicherten mit allen geeigneten Mitteln wiederherzustellen und sie oder ihre Hinterbliebenen durch Geldleistungen zu entschädigen“. |
| 4 |
Aus der Vorlageentscheidung und den beim Gerichtshof eingereichten Erklärungen geht hervor, dass dieses System insbesondere auf folgenden Bestandteilen beruht. Pflichtmitgliedschaft |
| 5 |
Im Rahmen des genannten Systems sind alle Unternehmen verpflichtet, für die Versicherung gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten der Berufsgenossenschaft beizutreten, die sachlich und örtlich für sie zuständig ist. Die verschiedenen Berufsgenossenschaften haben den Status öffentlich-rechtlicher Körperschaften und verfolgen keine Gewinnabsicht. Nach den Angaben der deutschen Regierung und der Kommission der Europäischen Gemeinschaften gibt es zurzeit 25 Berufsgenossenschaften. Jede Berufsgenossenschaft ist nach den entsprechenden Tätigkeitssektoren in mehrere Zweige aufgeteilt. Beiträge |
| 6 |
§ 152 SGB VII („Umlage“) bestimmt in Abs. 1: „Die Beiträge werden nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Beitragsansprüche dem Grunde nach entstanden sind, im Wege der Umlage festgesetzt. Die Umlage muss den Bedarf des abgelaufenen Kalenderjahres einschließlich der zur Ansammlung der Rücklage nötigen Beträge decken. Darüber hinaus dürfen Beiträge nur zur Zuführung zu den Betriebsmitteln erhoben werden.“ |
| 7 |
§ 153 SGB VII („Berechnungsgrundlagen“) sieht vor: „(1) Berechnungsgrundlagen für die Beiträge sind, soweit sich aus den nachfolgenden Vorschriften nicht etwas anderes ergibt, der Finanzbedarf (Umlagesoll), die Arbeitsentgelte der Versicherten und die Gefahrklassen. (2) Das Arbeitsentgelt der Versicherten wird bis zur Höhe des Höchstjahresarbeitsverdienstes zugrunde gelegt. (3) Die Satzung kann bestimmen, dass der Beitragsberechnung mindestens das Arbeitsentgelt in Höhe des Mindestjahresarbeitsverdienstes für Versicherte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, zugrunde gelegt wird. Waren die Versicherten nicht während des ganzen Kalenderjahres oder nicht ganztägig beschäftigt, wird ein entsprechender Teil dieses Betrages zugrunde gelegt. (4) Bei der Beitragsberechnung kann von der Berücksichtigung des Grades der Unfallgefahr in den Unternehmen ganz oder teilweise abgesehen werden, soweit Aufwendungen für Renten, Sterbegeld und Abfindungen 1. auf Versicherungsfällen in solchen Unternehmen beruhen, die vor dem vierten dem Umlagejahr vorausgegangenen Jahr eingestellt worden sind, oder 2. auf Versicherungsfällen beruhen, bei denen der Zeitpunkt der erstmaligen Feststellung vor dem vierten dem Umlagejahr vorausgegangenen Jahr liegt. Der Gesamtbetrag der Aufwendungen, die nach Satz 1 ohne Berücksichtigung des Grades der Unfallgefahr auf die Unternehmen umgelegt werden, darf 30 vom Hundert der Gesamtaufwendungen für Renten, Sterbegeld und Abfindungen nicht übersteigen. Das Nähere bestimmt die Satzung.“ |
| 8 |
§ 157 SGB VII („Gefahrtarif“) bestimmt: „(1) Der Unfallversicherungsträger setzt als autonomes Recht einen Gefahrtarif fest. In dem Gefahrtarif sind zur Abstufung der Beiträge Gefahrklassen festzustellen. … (2) Der Gefahrtarif wird nach Tarifstellen gegliedert, in denen Gefahrengemeinschaften nach Gefährdungsrisiken unter Berücksichtigung eines versicherungsmäßigen Risikoausgleichs gebildet werden. … (3) Die Gefahrklassen werden aus dem Verhältnis der gezahlten Leistungen zu den Arbeitsentgelten berechnet. …“ |
| 9 |
Nach den Angaben von Kattner erlaubt § 161 SGB VII den Berufsgenossenschaften, in ihrer Satzung einen einheitlichen Mindestbeitrag festzusetzen. |
| 10 |
§ 176 SGB VII („Ausgleichspflicht“) bestimmt in Abs. 1: „Soweit 1. der Rentenlastsatz einer gewerblichen Berufsgenossenschaft das 4,5fache des durchschnittlichen Rentenlastsatzes der Berufsgenossenschaften, 2. der Rentenlastsatz einer gewerblichen Berufsgenossenschaft, die mindestens 20 und höchstens 30 vom Hundert ihrer Aufwendungen für Renten, Sterbegeld und Abfindungen nach § 153 Abs. 4 ohne Berücksichtigung des Grades der Unfallgefahr auf die Unternehmen umlegt, das Dreifache des durchschnittlichen Rentenlastsatzes der Berufsgenossenschaften oder 3. der Entschädigungslastsatz einer gewerblichen Berufsgenossenschaft das Fünffache des durchschnittlichen Entschädigungslastsatzes der Berufsgenossenschaften übersteigt, gleichen die Berufsgenossenschaften den übersteigenden Lastenanteil untereinander aus. Übersteigt der Ausgleichsbetrag nach Satz 1 Nr. 2 den Betrag, den die Berufsgenossenschaft nach Satz 1 Nr. 2 ohne Berücksichtigung des Grades der Unfallgefahr auf die Unternehmen umlegt, wird er auf diesen Betrag gekürzt.“ Leistungen |
| 11 |
Die Arbeitnehmer haben einen unmittelbaren Leistungsanspruch gegen ihre Berufsgenossenschaft, ohne die Haftung des Arbeitgebers geltend machen zu müssen (§§ 104 bis 109 SGB VII). |
| 12 |
Die Liste der Leistungen und die Voraussetzungen für ihre Gewährung sind in den §§ 26 bis 103 SGB VII niedergelegt. Der Anspruch auf die entsprechenden Leistungen entsteht unabhängig davon, ob der Arbeitgeber imstande ist, seinen Beitrag zu zahlen. Nach § 85 SGB VII werden für die Berechnung der Leistungen nur Arbeitsentgelte zwischen einem Mindest- und einem Höchstverdienst berücksichtigt. Ausgangsrechtsstreit und Vorlagefragen |
| 13 | Kattner ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts, die am 13. November 2003 gegründet wurde und am 1. Januar 2004 ihre Tätigkeit im Bereich des Stahl-, Treppen- und Balkonbaus aufnahm. |
| 14 |
Am 27. Januar 2004 teilte die MMB Kattner mit, dass sie der gemäß den Vorschriften des SGB VII für Kattner gesetzlich zuständige Träger der Versicherung gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten sei und sie dieses Unternehmen daher als Mitglied der Berufsgenossenschaft aufgenommen und ihm im Übrigen bestimmte Gefahrklassen zugeteilt habe. |
| 15 | Mit Schreiben vom 1. November 2004 teilte Kattner der MMB ihre Absicht mit, sich privat gegen die bestehenden Risiken abzusichern, und kündigte ihre Pflichtmitgliedschaft zum Jahresende 2004. |
| 16 |
Am 15. November 2004 teilte die MMB Kattner mit, dass ein Austritt bzw. eine Kündigung der Mitgliedschaft rechtlich nicht möglich sei, weil sie der für Kattner gesetzlich zuständige Träger der Versicherung gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten sei, und dass eine Entlassung von Kattner aus der Mitgliedschaft daher abgelehnt werde. Mit Widerspruchsbescheid vom 20. April 2005 erhielt die MMB diese Entscheidung aufrecht. |
| 17 | Am 21. November 2005 wies das Sozialgericht Leipzig die von Kattner erhobene Klage ab. |
| 18 | Kattner legte beim Sächsischen Landessozialgericht Berufung ein und macht vor diesem Gericht zunächst geltend, dass die Zwangsmitgliedschaft bei der MMB die Dienstleistungsfreiheit gemäß den Art. 49 EG und 50 EG beschränke. Kattner legt dafür ein Angebot einer dänischen Versicherungsgesellschaft vor, sie zu denselben Bedingungen wie die MMB gegen Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und Wegeunfälle zu versichern. Überdies entsprächen die von dieser Gesellschaft erbrachten Leistungen den Leistungen, die das im Ausgangsverfahren streitige deutsche System vorsehe. Sodann verstoße die Ausschließlichkeitsstellung der MMB gegen die Art. 82 EG und 86 EG. Es gebe keinen zwingenden Grund des Allgemeininteresses, der eine Monopolstellung der deutschen Träger der Versicherung gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten in ihrem jeweiligen Bereich rechtfertigen könne. |
| 19 |
Das Sächsische Landessozialgericht legt in seiner Vorlageentscheidung dar, dass grundsätzliche Unterschiede zwischen dem im Ausgangsverfahren streitigen System und dem im Urteil vom 22. Januar 2002, Cisal (C‑218/00, Slg. 2002, I‑691), behandelten italienischen System der gesetzlichen Versicherung gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten bestünden, so dass nicht alle Fragen, die sich in dem bei ihm anhängigen Rechtsstreit stellten, anhand der vom Gerichtshof in diesem Urteil gegebenen Hinweise beantwortet werden könnten. |
| 20 |
Nach Ansicht des vorlegenden Gerichts ist nämlich zunächst fraglich, ob die MMB eine Einrichtung ist, die durch Gesetz mit der Verwaltung eines Systems der obligatorischen Versicherung gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten betraut ist. Ein wesentlicher Unterschied des italienischen Systems gegenüber dem deutschen bestehe insoweit darin, dass das Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (Staatliche Unfallversicherungsanstalt), um das es in der Rechtssache Cisal gegangen sei, ein Monopol innehabe, während das deutsche System auf einer Oligopolstruktur beruhe. Außerdem sei die MMB nicht mit der Verwaltung eines Systems der obligatorischen Versicherung betraut, sondern biete diese Versicherung selbst an. Die Verwaltungstätigkeit der MMB entspreche im Wesentlichen der von Wirtschaftsteilnehmern, insbesondere der Tätigkeit von Versicherungsgesellschaften. |
| 21 | Im Übrigen meint das vorlegende Gericht, dass die Pflichtmitgliedschaft bei dem deutschen System gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten auch nicht für dessen finanzielles Gleichgewicht oder die Umsetzung des Grundsatzes der Solidarität unerlässlich sei. Da sich die Beitragshöhe aus von jeder Berufsgenossenschaft autonom festgesetzten Regelungen ergebe und der Tätigkeitsbereich der einzelnen Berufsgenossenschaft geändert werden könne, führe nämlich die Bildung von Fach- und Gebietsmonopolen ohne Bezug zu dem entsprechenden Risiko je nach willkürlich gebildeter Gefahrengemeinschaft zu unterschiedlichen Tarifen bei gleichem Risiko. Außerdem gebe es keine Regelung, nach der der Beitrag bei hohen Risiken einen bestimmten Höchstbetrag nicht überschreiten dürfe. Überdies sei der Mindestverdienst, der nach § 153 Abs. 3 SGB VII für die Beitragsberechnung berücksichtigt werden könne, nicht zwingend vorgesehen, sondern könne durch die Satzung festgelegt werden. Nach den §§ 81 ff. sowie § 153 Abs. 2 SGB VII richte sich auch die Festlegung des Höchstverdiensts im Sinne der letztgenannten Vorschrift, der sowohl für die Leistungs- als auch für die Beitragsberechnung herangezogen werde, nach der Satzung. Schließlich seien die Leistungen, jedenfalls die meisten unter ihnen, von der Höhe des Arbeitsentgelts der Versicherten abhängig. Daraus folge, dass das im Ausgangsverfahren streitige deutsche System keinen sozialpolitisch intendierten Umverteilungsmechanismus kenne. |
| 22 |
Unter diesen Umständen hat das Sächsische Landessozialgericht das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt: 1. Handelt es sich bei der MMB um ein Unternehmen im Sinne der Art. 81 EG und 82 EG? 2. Verstößt die Pflichtmitgliedschaft von Kattner bei der MMB gegen gemeinschaftsrechtliche Vorschriften? Zu den Vorlagefragen Zur Zulässigkeit |
| 23 | Die MMB und die Kommission tragen zur ersten Frage vor, dass das vorlegende Gericht zum einen um eine Auslegung des nationalen Rechts ersuche und zum anderen nicht angebe, aufgrund welcher Umstände eine Berufsgenossenschaft ein Unternehmen im Sinne der Art. 81 EG und 82 EG darstellen könne. Die Kommission ergänzt zur zweiten Frage, dass das vorlegende Gericht die auszulegenden Normen des Gemeinschaftsrechts nicht hinreichend genau bezeichne. Im Übrigen macht die MMB geltend, dass die beiden vorgelegten Fragen nicht zu einer für das vorlegende Gericht nützlichen Antwort führen könnten, da dieses die Pflichtmitgliedschaft von Kattner deshalb nicht beenden könne, weil die ursprüngliche Entscheidung vom 27. Januar 2004 über die Mitgliedschaft nicht angefochten worden sei. |
| 24 |
Was erstens den Wortlaut der Vorlagefragen betrifft, ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Gerichtshof im Verfahren nach Art. 234 EG nicht befugt ist, die Normen des Gemeinschaftsrechts auf einen Einzelfall anzuwenden, und somit auch nicht dafür zuständig ist, Bestimmungen des innerstaatlichen Rechts unter eine solche Norm einzuordnen. Er kann aber dem innerstaatlichen Gericht alle Hinweise zur Auslegung des Gemeinschaftsrechts geben, die diesem bei der Beurteilung der Wirkungen dieser Bestimmungen dienlich sein können (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 24. September 1987, Coenen, 37/86, Slg. 1987, 3589, Randnr. 8, und vom 5. Juli 2007, Fendt Italiana, C‑145/06 und C‑146/06, Slg. 2007, I‑5869, Randnr. 30). Hierzu hat der Gerichtshof die ihm vorgelegten Fragen gegebenenfalls umzuformulieren (vgl. u. a. Urteile vom 8. März 2007, Campina, C‑45/06, Slg. 2007, I‑2089, Randnr. 30, und vom 11. März 2008, Jager, C‑420/06, Slg. 2008, I‑1315, Randnr. 46). |
| 25 |
Im vorliegenden Fall trifft es zwar zu, dass das vorlegende Gericht den Gerichtshof mit seiner ersten Frage ersucht, die Art. 81 EG und 82 EG auf den Ausgangsrechtsstreit anzuwenden und selbst zu entscheiden, ob die MMB ein Unternehmen im Sinne dieser Vorschriften darstellt, und dass es die für eine solche Qualifizierung erheblichen Umstände nicht genau bezeichnet, doch hindert nichts die Umformulierung dieser Frage, um dem genannten Gericht eine Auslegung der entsprechenden Vorschriften zu geben, die ihm für die Entscheidung des bei ihm anhängigen Rechtsstreits dienlich ist. |
| 26 |
Im Übrigen ist auch darauf hinzuweisen, dass der Gerichtshof, wenn in einer Vorlagefrage nur auf das Gemeinschaftsrecht verwiesen wird, ohne die Vorschriften dieses Rechts, auf die Bezug genommen wird, zu nennen, nach der Rechtsprechung aus dem gesamten von dem vorlegenden Gericht übermittelten Material, insbesondere aus der Begründung der Vorlageentscheidung, diejenigen Vorschriften des Gemeinschaftsrechts herauszuarbeiten hat, die unter Berücksichtigung des Gegenstands des Rechtsstreits einer Auslegung bedürfen (vgl. in diesem Sinne u. a. Urteil vom 20. April 1988, Bekaert, 204/87, Slg. 1988, 2029, Randnrn. 6 und 7). |
| 27 |
Im vorliegenden Fall werden die auszulegenden Vorschriften des Gemeinschaftsrechts zwar im Text der zweiten Frage nicht bezeichnet, doch geht aus der Vorlageentscheidung klar hervor, dass mit dieser Frage geklärt werden soll, ob die Pflichtmitgliedschaft bei einer Berufsgenossenschaft wie der MMB entsprechend dem Vorbringen von Kattner im Ausgangsrechtsstreit eine nach den Art. 49 EG und 50 EG verbotene Beschränkung des freien Dienstleistungsverkehrs oder ein nach Art. 82 EG, gegebenenfalls in Verbindung mit Art. 86 EG, untersagter Missbrauch sein kann, so dass sich die Frage in diesem Sinne umformulieren lässt. |
| 28 |
Was zweitens die Nützlichkeit der von dem vorlegenden Gericht gestellten Fragen betrifft, ist darauf hinzuweisen, dass es im Rahmen der durch Art. 234 EG geschaffenen Zusammenarbeit zwischen dem Gerichtshof und den nationalen Gerichten allein Sache des mit dem Rechtsstreit befassten nationalen Gerichts ist, in dessen Verantwortungsbereich die zu erlassende gerichtliche Entscheidung fällt, im Hinblick auf die Besonderheiten der Rechtssache sowohl die Erforderlichkeit einer Vorabentscheidung zum Erlass seines Urteils als auch die Erheblichkeit der dem Gerichtshof von ihm vorgelegten Fragen zu beurteilen. Betreffen also die vorgelegten Fragen die Auslegung des Gemeinschaftsrechts, so ist der Gerichtshof grundsätzlich gehalten, darüber zu befinden (vgl. u. a. Urteil vom 23. November 2006, Asnef‑Equifax und Administración del Estado, C‑238/05, Slg. 2006, I‑11125, Randnr. 15 und die dort angeführte Rechtsprechung). |
| 29 |
Ausnahmsweise hat der Gerichtshof allerdings zur Prüfung seiner eigenen Zuständigkeit die Umstände zu untersuchen, unter denen er von dem innerstaatlichen Gericht angerufen wird. Denn der Geist der Zusammenarbeit, in dem das Vorabentscheidungsverfahren durchzuführen ist, verlangt auch, dass das nationale Gericht auf die dem Gerichtshof übertragene Aufgabe Rücksicht nimmt, zur Rechtspflege in den Mitgliedstaaten beizutragen, nicht aber Gutachten zu allgemeinen oder hypothetischen Fragen abzugeben. Die Zurückweisung des Vorabentscheidungsersuchens eines nationalen Gerichts ist allerdings nur möglich, wenn offensichtlich ist, dass die erbetene Auslegung des Gemeinschaftsrechts in keinem Zusammenhang mit der Realität oder dem Gegenstand des Ausgangsrechtsstreits steht, wenn das Problem hypothetischer Natur ist oder der Gerichtshof nicht über die tatsächlichen und rechtlichen Angaben verfügt, die für eine zweckdienliche Beantwortung der ihm vorgelegten Fragen erforderlich sind (Urteil Asnef‑Equifax und Administración del Estado, Randnrn. 16 und 17 und die dort angeführte Rechtsprechung). |
| 30 |
Im vorliegenden Fall ergibt sich aus der Vorlageentscheidung, dass es im Ausgangsrechtsstreit um die Rechtmäßigkeit der Pflichtmitgliedschaft von Kattner bei der MMB für die Versicherung gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten geht. In diesem Rahmen fragt sich das vorlegende Gericht insbesondere, ob diese Pflichtmitgliedschaft zum einen mit den Art. 49 EG und 50 EG und zum anderen mit den Art. 82 EG und 86 EG vereinbar ist. |
| 31 |
Unter diesen Umständen ist nicht offensichtlich, dass die erbetene Auslegung des Gemeinschaftsrechts in keinem Zusammenhang mit der Realität oder dem Gegenstand des bei dem vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreits steht, der ganz offensichtlich nicht hypothetisch ist. |
| 32 |
Das Vorabentscheidungsersuchen ist somit zulässig. Zur Beantwortung der Fragen Zur ersten Frage |
| 33 |
Mit seiner ersten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob die Art. 81 EG und 82 EG dahin auszulegen sind, dass eine Einrichtung wie die MMB, der die Unternehmen, die in einem bestimmten Gebiet einem bestimmten Gewerbezweig angehören, für die Versicherung gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten beitreten müssen, ein Unternehmen im Sinne dieser Vorschriften ist. |
| 34 |
Nach ständiger Rechtsprechung umfasst der Begriff des Unternehmens im Rahmen des Wettbewerbsrechts jede eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübende Einheit, unabhängig von ihrer Rechtsform und der Art ihrer Finanzierung (vgl. u. a. Urteile vom 23. April 1991, Höfner und Elser, C‑41/90, Slg. 1991, I‑1979, Randnr. 21, und vom 11. Dezember 2007, ETI u. a., C‑280/06, Slg. 2007, I‑10893, Randnr. 38). |
| 35 |
Im vorliegenden Fall ist zunächst darauf hinzuweisen, dass die Berufsgenossenschaften wie die MMB als öffentlich-rechtliche Körperschaften an der Verwaltung des deutschen Systems der sozialen Sicherheit mitwirken und insoweit eine soziale Aufgabe wahrnehmen, die ohne Gewinnerzielungsabsicht ausgeübt wird (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 16. März 2004, AOK Bundesverband u. a., C‑264/01, C‑306/01, C‑354/01 und C‑355/01, Slg. 2004, I‑2493, Randnr. 51). |
| 36 |
Wie nämlich der Gerichtshof in Bezug auf das italienische gesetzliche System der Versicherung gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten entschieden hat, gehört der Schutz gegen diese Risiken seit langer Zeit zum sozialen Schutz, den die Mitgliedstaaten ihrer gesamten Bevölkerung oder einem Teil derselben gewähren (Urteil Cisal, Randnr. 32). |
| 37 | Nach ständiger Rechtsprechung lässt das Gemeinschaftsrecht die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die Ausgestaltung ihrer Systeme der sozialen Sicherheit unberührt (vgl. u. a. Urteile vom 28. April 1998, Kohll, C‑158/96, Slg. 1998, I‑1931, Randnr. 17, vom 12. Juli 2001, Smits und Peerbooms, C‑157/99, Slg. 2001, I‑5473, Randnr. 44, und vom 16. Mai 2006, Watts, C‑372/04, Slg. 2006, I‑4325, Randnr. 92). |
| 38 |
Im Übrigen verfolgt ein gesetzliches System der Versicherung gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten wie das im Ausgangsverfahren streitige insofern, als es eine obligatorische soziale Sicherung für alle Arbeitnehmer vorsieht, einen sozialen Zweck (vgl. entsprechend Urteil Cisal, Randnr. 34). |
| 39 |
Nach § 1 SGB VII hat dieses System nämlich zur Aufgabe, zum einen mit allen geeigneten Mitteln Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten sowie arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhüten und zum anderen die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit der Versicherten mit allen geeigneten Mitteln wiederherzustellen und sie oder ihre Hinterbliebenen durch Geldleistungen zu entschädigen. |
| 40 | Außerdem geht aus den beim Gerichtshof eingereichten Erklärungen hervor, dass dieses System allen geschützten Personen eine Deckung gegen die Risiken eines Arbeitsunfalls und von Berufskrankheiten gewähren soll, unabhängig von jeder Pflichtverletzung des Geschädigten oder des Arbeitgebers und damit ohne dass derjenige zivilrechtlich haftbar gemacht werden müsste, der die Vorteile aus der gefahrgeneigten Tätigkeit zieht (vgl. entsprechend Urteil Cisal, Randnr. 35). |
| 41 | Der soziale Zweck eines solchen Systems zeigt sich überdies daran, dass die Leistungen, wie aus den beim Gerichtshof eingereichten Unterlagen hervorgeht, auch dann gewährt werden, wenn die fälligen Beiträge nicht entrichtet wurden; dies trägt offensichtlich zum Schutz aller Versicherten gegen die wirtschaftlichen Folgen von Arbeitsunfällen bei (vgl. entsprechend Urteil Cisal, Randnr. 36). |
| 42 | Allerdings genügt der soziale Zweck eines Versicherungssystems als solcher nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs nicht, um eine Einstufung der betreffenden Tätigkeit als wirtschaftliche Tätigkeit auszuschließen (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 21. September 1999, Albany, C‑67/96, Slg. 1999, I‑5751, Randnr. 86, vom 12. September 2000, Pavlov u. a., C‑180/98 bis C‑184/98, Slg. 2000, I‑6451, Randnr. 118, und Cisal, Randnr. 37). |
| 43 |
Zu prüfen bleibt insbesondere, ob dieses System als Umsetzung des Grundsatzes der Solidarität angesehen werden kann und in welchem Umfang es staatlicher Aufsicht unterliegt; diese Umstände können den wirtschaftlichen Charakter einer Tätigkeit ausschließen (vgl. in diesem Sinne Urteil Cisal, Randnrn. 38 bis 44). – Zur Umsetzung des Grundsatzes der Solidarität |
| 44 |
Was an erster Stelle die Umsetzung des Grundsatzes der Solidarität betrifft, so ergibt sich erstens aus einer Gesamtbetrachtung des im Ausgangsverfahren streitigen Systems, dass es ebenso wie das System, das in der Rechtssache Cisal in Rede stand (vgl. Urteil Cisal, dessen Randnr. 39), durch Beiträge finanziert wird, deren Höhe nicht streng proportional zum versicherten Risiko ist. |
| 45 | Die Höhe der Beiträge hängt nämlich nicht nur vom versicherten Risiko ab, sondern, wie sich aus § 153 Abs. 1 bis 3 SGB VII ergibt, auch – in den Grenzen eines Höchst- und gegebenenfalls eines Mindestbetrags – vom Arbeitsentgelt der Versicherten (vgl. entsprechend Urteil Cisal, Randnr. 39). |
| 46 |
Außerdem hängt die Beitragshöhe nach § 152 Abs. 1 und § 153 Abs. 1 SGB VII auch von dem Finanzbedarf ab, der sich aus den von der betreffenden Berufsgenossenschaft im jeweils vergangenen Kalenderjahr erbrachten Leistungen ergibt. Die Berücksichtigung des Finanzbedarfs erlaubt es, die mit der Tätigkeit der Mitglieder einer Berufsgenossenschaft verbundenen Gefahren über ihren jeweiligen Gewerbezweig hinaus auf alle Mitglieder zu verteilen, und schafft so eine Gefahrengemeinschaft auf der Ebene der Berufsgenossenschaft. |
| 47 |
Im Übrigen wird für die Beitragsberechnung vorbehaltlich bestimmter möglicher Anpassungen in Verbindung mit der Tätigkeit individueller Unternehmen über nach § 157 SGB VII festgesetzte Gefahrklassen auf die Gefahren des Gewerbezweigs abgestellt, dem die Mitglieder einer Berufsgenossenschaft innerhalb derselben angehören, so dass die Mitglieder entsprechend den in diesem Gewerbezweig bestehenden Gefährdungsrisiken eine Gefahrengemeinschaft bilden. |
| 48 |
Überdies sind die Berufsgenossenschaften nach § 176 SGB VII untereinander zum Ausgleich verpflichtet, wenn die Ausgaben einer von ihnen die durchschnittlichen Ausgaben aller Berufsgenossenschaften erheblich übersteigen. Daraus folgt, dass der Grundsatz der Solidarität auf diese Weise auch auf nationaler Ebene zwischen allen Gewerbezweigen umgesetzt wird, da die verschiedenen Berufsgenossenschaften ihrerseits in einer Gefahrengemeinschaft zusammengeschlossen sind, die es ihnen ermöglicht, untereinander einen Kosten- und Risikoausgleich vorzunehmen (vgl. entsprechend Urteile vom 17. Februar 1993, Poucet und Pistre, C‑159/91 und C‑160/91, Slg. 1993, I‑637, Randnr. 12, und AOK Bundesverband, Randnr. 53). |
| 49 | Zwar weist das vorlegende Gericht darauf hin, dass das im Ausgangsverfahren streitige deutsche System anders als das italienische System, das in der Rechtssache Cisal betroffen war, zum einen für die Beiträge keine Obergrenze vorsieht und zum anderen nicht von einer einzigen Einrichtung mit Monopolstellung umgesetzt wird, sondern von mehreren Einrichtungen, die sich nach den Angaben dieses Gerichts in einer Oligopolsituation befinden. |
| 50 |
Diese beiden Umstände stellen allerdings den solidarischen Charakter der Finanzierung eines Systems wie des im Ausgangsverfahren streitigen nicht in Frage, der sich im Rahmen einer Gesamtbetrachtung dieses Systems aus den Feststellungen in den Randnrn. 44 bis 48 des vorliegenden Urteils ergibt. |
| 51 | In Bezug auf den ersten Umstand ist darauf hinzuweisen, dass die Existenz einer Obergrenze zwar zur Umsetzung des Grundsatzes der Solidarität beiträgt, insbesondere dann, wenn der Finanzierungssaldo von allen Unternehmen derselben Klasse getragen wird (vgl. entsprechend Urteil Cisal, Randnr. 39), dass allein ihr Fehlen aber nicht zur Folge hat, dass ein System mit den genannten Merkmalen seinen solidarischen Charakter verliert. |
| 52 |
Da § 153 Abs. 2 SGB VII ausdrücklich vorsieht, dass „[d]as Arbeitsentgelt der Versicherten … bis zur Höhe des Höchstjahresarbeitsverdienstes zugrunde gelegt [wird]“, hat das vorlegende Gericht, in dessen Entscheidung im Übrigen ausdrücklich auf diese Vorschrift Bezug genommen wird, außerdem in jedem Fall zu prüfen, ob diese Vorschrift, wie die deutsche Regierung geltend macht und auch aus den Erklärungen von Kattner hervorgeht, nicht den solidarischen Charakter des im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Systems dadurch verstärkt, dass die Beitragshöhe bei einem hohen versicherten Risiko indirekt begrenzt wird. |
| 53 |
In Bezug auf den zweiten Umstand, den das vorlegende Gericht anführt, ist darauf hinzuweisen, dass das Gemeinschaftsrecht, wie bereits in Randnr. 37 des vorliegenden Urteils ausgeführt, die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten zur Ausgestaltung ihrer Systeme der sozialen Sicherheit unberührt lässt. Wenn sich ein Mitgliedstaat in Ausübung dieser Zuständigkeit dafür entscheidet, die Durchführung eines Systems der sozialen Sicherheit auf sektorieller und/oder geografischer Grundlage auf mehrere Träger zu verteilen, dann setzt er tatsächlich den Grundsatz der Solidarität um, auch wenn er den Rahmen beschränkt, in dem dieser Grundsatz angewandt wird. Das gilt umso mehr, wenn die Berufsgenossenschaften, wie es in dem im Ausgangsverfahren streitigen System der Fall ist, untereinander auf nationaler Ebene einen Kosten- und Risikoausgleich vornehmen. |
| 54 |
Schließlich wird der solidarische Charakter der Finanzierung eines Systems wie des im Ausgangsverfahren streitigen entgegen dem Vorbringen von Kattner auch nicht dadurch beeinträchtigt, dass die Berufsgenossenschaften nach § 161 SGB VII beschließen könnten, einen einheitlichen Mindestbeitrag festzusetzen. Vielmehr kann die Festsetzung eines derartigen Beitrags, selbst wenn man annimmt, dass dadurch, wie Kattner geltend macht, der aufzuteilende Finanzbedarf reduziert wird, ihrerseits zum solidarischen Charakter des Systems beitragen. Bei Versicherten, deren Arbeitsentgelt unter dem Entgelt liegt, dem der Mindestbeitrag entspricht, führt dessen Existenz nämlich dazu, dass ein Beitrag erhoben wird, der nicht nur für alle diese Versicherten der betreffenden Berufsgenossenschaft einheitlich ist, sondern zudem nicht vom versicherten Risiko und damit von dem Gewerbezweig abhängt, dem die entsprechenden Versicherten angehören. |
| 55 |
Zweitens ist – ebenfalls entsprechend den Ausführungen des Gerichtshofs im Urteil Cisal (Randnr. 40) – festzustellen, dass der Wert der von den Berufsgenossenschaften wie der MMB erbrachten Leistungen nicht notwendigerweise proportional zum Arbeitsentgelt des Versicherten ist. |
| 56 |
Auch wenn die Höhe des Arbeitsentgelts bei der Beitragsberechnung berücksichtigt wird, geht nämlich aus der Vorlageentscheidung und den beim Gerichtshof eingereichten Erklärungen hervor, dass die Sachleistungen wie Präventions- und Rehabilitationsleistungen völlig unabhängig vom Arbeitsentgelt sind. Diese Leistungen sind erheblich, da sie nach den Angaben des vorlegenden Gerichts rund 12 % der Gesamtausgaben der MMB im Jahr 2002 bzw. nach den Angaben der MMB und der deutschen Regierung sogar zwischen 25 % und 30 % dieser Ausgaben ausmachen. |
| 57 |
Hinsichtlich der Geldleistungen, mit denen ein Teil des Entgeltverlusts infolge eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit ausgeglichen werden soll, geht ferner aus der Vorlageentscheidung und den Erklärungen gegenüber dem Gerichtshof hervor, dass nach § 85 SGB VII nur die Arbeitsentgelte zwischen einem Mindest- und einem Höchstbetrag – dem „Mindestjahresarbeitsverdienst“ und dem „Höchstjahresarbeitsverdienst“ – berücksichtigt werden, was allerdings vom vorlegenden Gericht zu bestätigen ist. Außerdem haben sowohl die deutsche Regierung als auch die Kommission vorgetragen, dass die Höhe des Pflegegelds völlig unabhängig von den gezahlten Beiträgen sei, was das vorlegende Gericht ebenfalls zu prüfen hat. |
| 58 |
Unter diesen Umständen führt die Zahlung hoher Beiträge wie im Rahmen des Systems, das in der Rechtssache Cisal in Rede stand, möglicherweise nur zu begrenzten Leistungen, und umgekehrt kann die Zahlung verhältnismäßig niedriger Beiträge, wie Kattner in ihren Erklärungen selbst ausgeführt hat, zu einem Anspruch auf Leistungen führen, die nach einem höheren Arbeitsentgelt berechnet werden. |
| 59 |
Das Fehlen eines unmittelbaren Zusammenhangs zwischen den entrichteten Beiträgen und den gewährten Leistungen bewirkt somit eine Solidarität zwischen den am besten bezahlten Arbeitnehmern und denjenigen, die in Anbetracht ihrer niedrigen Einkünfte keine angemessene soziale Absicherung hätten, wenn ein solcher Zusammenhang bestünde (vgl. Urteil Cisal, Randnr. 42). – Zur staatlichen Aufsicht |
| 60 |
Was an zweiter Stelle die vom Staat ausgeübte Aufsicht anbelangt, geht aus der Vorlageentscheidung hervor, dass das deutsche Gesetz den Berufsgenossenschaften wie der MMB zwar die Durchführung der gesetzlichen Versicherung gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten übertragen hat, dass die Berufsgenossenschaften aber in ihrer Satzung zum einen bestimmen können, dass gemäß § 153 Abs. 3 SGB VII der Beitragsberechnung mindestens der Betrag des Mindestjahresarbeitsverdienstes zugrunde gelegt wird, und zum anderen, wie Kattner in ihren Erklärungen mit Nachdruck betont, den Betrag des Höchstjahresarbeitsverdienstes, der nach § 153 Abs. 2 SGB VII für die Berechnung der Beiträge und nach § 85 SGB VII für die Berechnung der Leistungen herangezogen wird, heraufsetzen können. Außerdem ergibt sich aus den Erklärungen von Kattner, die insoweit durch die Erklärungen der deutschen Regierung bestätigt werden, dass die Berufsgenossenschaften nach § 157 Abs. 1 SGB VII den Gefahrtarif und die Gefahrklassen, die ein Faktor für die Beitragsberechnung sind, autonom festsetzen. |
| 61 | Dass Berufsgenossenschaften wie der MMB im Rahmen eines Selbstverwaltungssystems ein solcher Handlungsspielraum gewährt wird, um Faktoren festzusetzen, die für die Höhe der Beiträge und der Leistungen ausschlaggebend sind, kann jedoch als solches die Natur der von den Berufsgenossenschaften ausgeübten Tätigkeit nicht ändern (vgl. in diesem Sinne Urteil AOK Bundesverband u. a., Randnr. 56). |
| 62 |
Aus den beim Gerichtshof eingereichten Unterlagen geht nämlich hervor, dass dieser Handlungsspielraum, wie der Generalanwalt in Nr. 54 seiner Schlussanträge festgestellt hat, durch das Gesetz vorgesehen ist und strikt begrenzt wird, da das SGB VII zum einen die Faktoren bezeichnet, die für die Berechnung der Beiträge heranzuziehen sind, die nach dem im Ausgangsverfahren streitigen gesetzlichen System geschuldet werden, und zum anderen ein abschließendes Verzeichnis der nach diesem System erbrachten Leistungen enthält und die Modalitäten für ihre Gewährung regelt. |
| 63 |
Insoweit ergibt sich aus den von Kattner, der deutschen Regierung und der Kommission eingereichten Erklärungen, dass die anwendbaren Rechtsvorschriften, was das vorlegende Gericht allerdings zu überprüfen hat, den Mindest- und den Höchstentgeltbetrag festlegen, der bei der Berechnung der Beiträge bzw. der Leistungen zu berücksichtigen ist, wobei nur der Höchstbetrag gegebenenfalls in der Satzung der Berufsgenossenschaften heraufgesetzt werden kann. |
| 64 |
Außerdem unterliegen die Berufsgenossenschaften offensichtlich, was jedoch wiederum vom vorlegenden Gericht zu prüfen ist, in Bezug auf die Ausarbeitung ihrer Satzung und insbesondere die Festsetzung der Höhe der Beiträge und der Leistungen im Rahmen des im Ausgangsverfahren streitigen gesetzlichen Systems der Kontrolle der Bundesrepublik, die insoweit nach den Vorschriften des SGB VII als Aufsichtsbehörde tätig wird. |
| 65 |
Aus dem Vorstehenden ergibt sich somit, dass in einem gesetzlichen Versicherungssystem wie dem im Ausgangsverfahren streitigen zum einen mit der Höhe der Beiträge und dem Wert der Leistungen – den beiden wesentlichen Elementen eines solchen Systems – vorbehaltlich der vom vorlegenden Gericht vorzunehmenden Prüfungen der Grundsatz der Solidarität umgesetzt wird, der impliziert, dass die erbrachten Leistungen nicht streng proportional zu den gezahlten Beiträgen sind, und dass diese Elemente zum anderen staatlicher Aufsicht unterliegen (vgl. in diesem Sinne Urteil Cisal, Randnr. 44). |
| 66 |
Unter diesen Umständen ist vorbehaltlich einer vom vorlegenden Gericht vorzunehmenden Prüfung dieser beiden Elemente hinsichtlich des Grundsatzes der Solidarität und der staatlichen Aufsicht festzustellen, dass eine Einrichtung wie die MMB durch ihre Mitwirkung an der Verwaltung eines der traditionellen Zweige der sozialen Sicherheit, der Versicherung gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten, eine Aufgabe rein sozialer Natur wahrnimmt, so dass ihre Tätigkeit keine wirtschaftliche Tätigkeit im Sinne des Wettbewerbsrechts und diese Einrichtung somit kein Unternehmen im Sinne der Art. 81 EG und 82 EG ist (vgl. in diesem Sinne Urteil Cisal, Randnr. 45). |
| 67 | Dieser Schluss wird nicht durch den vom vorlegenden Gericht hervorgehobenen Umstand in Frage gestellt, dass eine Berufsgenossenschaft wie die MMB im Gegensatz zu der Situation im Rahmen des italienischen Systems, das in der Rechtssache Cisal in Rede stand, nicht die Verwaltung des betreffenden gesetzlichen Versicherungssystems gewährleistet, sondern unmittelbar Versicherungsdienstleistungen erbringt. Da das Gemeinschaftsrecht die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die Ausgestaltung ihrer Systeme der sozialen Sicherheit unberührt lässt, kann nämlich, wie der Generalanwalt in Nr. 61 seiner Schlussanträge im Wesentlichen ausgeführt hat, allein dieser Umstand als solcher nichts am rein sozialen Charakter der von einer derartigen Berufsgenossenschaft ausgeübten Tätigkeit ändern, da er weder den solidarischen Charakter des entsprechenden Systems noch die vom Staat darüber ausgeübte Aufsicht, so wie diese Umstände aus der vorstehenden Analyse hervorgehen, beeinträchtigt. |
| 68 |
Folglich ist auf die erste Vorlagefrage zu antworten, dass die Art. 81 EG und 82 EG dahin auszulegen sind, dass eine Einrichtung wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehende Berufsgenossenschaft, der die Unternehmen, die in einem bestimmten Gebiet einem bestimmten Gewerbezweig angehören, für die Versicherung gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten beitreten müssen, kein Unternehmen im Sinne dieser Vorschriften ist, sondern eine Aufgabe rein sozialer Natur wahrnimmt, soweit sie im Rahmen eines Systems tätig wird, mit dem der Grundsatz der Solidarität umgesetzt wird und das staatlicher Aufsicht unterliegt, was vom vorlegenden Gericht zu prüfen ist. Zur zweiten Frage |
| 69 |
Mit seiner zweiten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob die Art. 49 EG und 50 EG einerseits und die Art. 82 EG und 86 EG andererseits dahin auszulegen sind, dass sie einer nationalen Regelung wie der im Ausgangsverfahren streitigen entgegenstehen, nach der die Unternehmen, die in einem bestimmten Gebiet einem bestimmten Gewerbezweig angehören, verpflichtet sind, einer Einrichtung wie der MMB beizutreten. |
| 70 | Insoweit ist eingangs darauf hinzuweisen, dass die zweite Frage angesichts der Antwort auf die erste Frage insoweit nicht zu beantworten ist, als sie sich auf die Auslegung der Art. 82 EG und 86 EG bezieht, da die Anwendbarkeit dieser Vorschriften von der Existenz eines Unternehmens abhängt. |
| 71 |
Was die Auslegung der Art. 49 EG und 50 EG betrifft, ist daran zu erinnern, dass in Ermangelung einer Harmonisierung auf Gemeinschaftsebene das Recht jedes betroffenen Mitgliedstaats bestimmt, unter welchen Voraussetzungen ein Recht auf Anschluss an ein System der sozialen Sicherheit oder die Verpflichtung hierzu besteht, da das Gemeinschaftsrecht, wie bereits in Randnr. 37 des vorliegenden Urteils ausgeführt, die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die Ausgestaltung ihrer Systeme der sozialen Sicherheit unberührt lässt (vgl. insbesondere Urteile Kohll, Randnr. 18, Smits und Peerbooms, Randnr. 45, und Watts, Randnr. 92). |
| 72 |
Die Kommission und im Wesentlichen auch die deutsche Regierung folgern aus dieser Rechtsprechung, dass die Einrichtung einer Pflichtmitgliedschaft in einem System der sozialen Sicherheit wie die mit der im Ausgangsverfahren streitigen Regelung vorgesehene in die alleinige Zuständigkeit der Mitgliedstaaten falle, so dass diese Regelung vom Anwendungsbereich der Art. 49 EG und 50 EG nicht erfasst werde. Über die Pflichtmitgliedschaft hinaus sei nämlich keine Beschränkung des freien Dienstleistungsverkehrs angesprochen, da nur die Art der Finanzierung eines Systems der sozialen Sicherheit, nicht aber die Erbringung von Leistungen nach dem Eintritt des versicherten sozialen Risikos in Frage stehe. |
| 73 | Dieser These kann nicht gefolgt werden. |
| 74 |
Zwar ist es nach der in Randnr. 71 des vorliegenden Urteils angeführten ständigen Rechtsprechung in Ermangelung einer gemeinschaftlichen Harmonisierung Sache des Rechts jedes Mitgliedstaats, insbesondere die Voraussetzungen der Verpflichtung, sich bei einem System der sozialen Sicherheit zu versichern, und damit die Art der Finanzierung dieses Systems festzulegen, doch müssen die Mitgliedstaaten bei der Ausübung dieser Befugnis gleichwohl das Gemeinschaftsrecht beachten (vgl. u. a. Urteile Kohll, Randnr. 19, und Smits und Peerbooms, Randnr. 46). Die entsprechende Zuständigkeit der Mitgliedstaaten ist also nicht unbegrenzt (Urteil vom 3. April 2008, Derouin, C‑103/06, Slg. 2008, I‑0000, Randnr. 25). |
| 75 |
Dass eine nationale Regelung wie die im Ausgangsverfahren streitige nur die Finanzierung eines Zweigs der sozialen Sicherheit betrifft, im vorliegenden Fall der Versicherung gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten, indem sie die Pflichtmitgliedschaft der von dem fraglichen System erfassten Unternehmen bei Berufsgenossenschaften vorsieht, denen das Gesetz die Durchführung dieser Versicherung übertragen hat, kann demnach die Anwendung der Vorschriften des EG-Vertrags, insbesondere derjenigen über den freien Dienstleistungsverkehr, nicht ausschließen (vgl. Urteil vom 26. Januar 1999, Terhoeve, C‑18/95, Slg. 1999, I‑345, Randnr. 35). |
| 76 |
Das System der Pflichtmitgliedschaft, das die im Ausgangsverfahren streitige nationale Regelung vorsieht, muss somit mit den Art. 49 EG und 50 EG vereinbar sein. |
| 77 |
Zu prüfen ist daher, ob, wie Kattner vor dem vorlegenden Gericht und in ihren beim Gerichtshof eingereichten Erklärungen geltend gemacht hat, der freie Dienstleistungsverkehr im Sinne von Art. 49 EG dadurch beschränkt werden kann, dass ein Mitgliedstaat ein gesetzliches Versicherungssystem wie das im Ausgangsverfahren streitige einrichtet, das die Pflichtmitgliedschaft von Unternehmen bei Berufsgenossenschaften wie der MMB zur Versicherung gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten vorsieht. Zum einen ist demnach zu prüfen, ob dadurch die Möglichkeit von in anderen Mitgliedstaaten niedergelassenen Versicherungsgesellschaften beschränkt wird, auf dem Markt des erstgenannten Mitgliedstaats ihre Dienste hinsichtlich der Versicherung der betreffenden Risiken oder einiger dieser Risiken anzubieten, und zum anderen, ob dadurch die in diesem ersten Mitgliedstaat niedergelassenen Unternehmen als Dienstleistungsempfänger davon abgehalten werden, sich bei solchen Gesellschaften zu versichern. |
| 78 |
Dazu ist darauf hinzuweisen, dass der freie Dienstleistungsverkehr nach der Rechtsprechung nicht nur die Beseitigung jeder Diskriminierung des in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen Dienstleistenden aufgrund seiner Staatsangehörigkeit, sondern auch die Aufhebung aller Beschränkungen – selbst wenn sie unterschiedslos für inländische Dienstleistende wie für solche aus anderen Mitgliedstaaten gelten – verlangt, sofern sie geeignet sind, die Tätigkeiten des Dienstleistenden, der in einem anderen Mitgliedstaat ansässig ist und dort rechtmäßig ähnliche Dienstleistungen erbringt, zu unterbinden, zu behindern oder weniger attraktiv zu machen (vgl. in diesem Sinne u. a. Urteile vom 20. Februar 2001, Analir u. a., C‑205/99, Slg. 2001, I‑1271, Randnr. 21, vom 5. Dezember 2006, Cipolla u. a., C‑202/04 und C‑94/04, Slg. 2006, I‑11421, Randnr. 56, und vom 11. Januar 2007, ITC, C‑208/05, Slg. 2007, I‑181, Randnr. 55). |
| 79 |
Außerdem steht Art. 49 EG nach ständiger Rechtsprechung der Anwendung jeder nationalen Regelung entgegen, die die Leistung von Diensten zwischen Mitgliedstaaten im Ergebnis gegenüber der Leistung von Diensten im Inneren eines Mitgliedstaats erschwert (Urteile Kohll, Randnr. 33, und Smits und Peerbooms, Randnr. 61). |
| 80 |
Im vorliegenden Fall mag es zwar, wie der Generalanwalt in Nr. 72 seiner Schlussanträge im Wesentlichen darlegt, zweifelhaft erscheinen, ob die von dem im Ausgangsverfahren streitigen gesetzlichen Versicherungssystem abgedeckten Risiken oder jedenfalls einige dieser Risiken bei privaten Versicherungsgesellschaften versichert werden könnten, da diese grundsätzlich nicht nach einem System tätig werden, das die in den Randnrn. 44 bis 59 des vorliegenden Urteils genannten Solidarelemente umfasst. |
| 81 |
Da das im Ausgangsverfahren streitige gesetzliche Versicherungssystem, wie aus den Randnrn. 57 und 58 des vorliegenden Urteils hervorgeht, nur begrenzte Leistungen und damit eine Mindestabdeckung vorsieht, steht es den diesem System unterliegenden Unternehmen, wie das vorlegende Gericht angibt und Kattner einräumt, überdies frei, zusätzliche Versicherungsverträge mit sowohl in Deutschland als auch in anderen Mitgliedstaaten niedergelassenen privaten Versicherungsgesellschaften abzuschließen (vgl. entsprechend Urteil vom 22. Mai 2003, Freskot, C‑355/00, Slg. 2003, I‑5263, Randnr. 62). |
| 82 | Das im Ausgangsverfahren streitige Versicherungssystem kann aber, da es, wie der Sachverhalt des Ausgangsverfahrens zeigt, offenbar auch Risiken abdecken soll, die sich bei nicht nach dem Grundsatz der Solidarität arbeitenden Versicherungsunternehmen versichern lassen, ein Hindernis für die freie Erbringung von Dienstleistungen durch in anderen Mitgliedstaaten niedergelassene Versicherungsgesellschaften, die Versicherungsverträge für derartige Risiken in dem betreffenden Mitgliedstaat anbieten möchten, insoweit darstellen, als es die Ausübung dieser Freiheit behindert oder weniger attraktiv macht, ja sogar unmittelbar oder mittelbar verhindert (vgl. in diesem Sinne Urteil Freskot, Randnr. 63). |
| 83 |
Außerdem kann ein solches System auch die ihm unterliegenden Unternehmen davon abschrecken oder sogar daran hindern, sich an solche in anderen Mitgliedstaaten als dem ihrer Mitgliedschaft niedergelassene Versicherungsdienstleister zu wenden, und stellt auch für diese Unternehmen ein Hemmnis für den freien Dienstleistungsverkehr dar (vgl. entsprechend Urteile vom 31. Januar 1984, Luisi und Carbone, 286/82 und 26/83, Slg. 1984, 377, Randnr. 16, Kohll, Randnr. 35, sowie Smits und Peerbooms, Randnr. 69). |
| 84 |
Eine solche Beschränkung kann allerdings gerechtfertigt sein, wenn sie zwingenden Gründen des Allgemeinwohls entspricht, geeignet ist, die Erreichung des mit ihr verfolgten Ziels zu gewährleisten, und nicht über das hinausgeht, was zur Erreichung dieses Ziels erforderlich ist (vgl. u. a. Urteile vom 5. Juni 1997, SETTG, C‑398/95, Slg. 1997, I‑3091, Randnr. 21, Cipolla u. a., Randnr. 61, und vom 13. Dezember 2007, United Pan‑Europe Communications Belgium u. a., C‑250/06, Slg. 2007, I‑11135, Randnr. 39). |
| 85 |
Insoweit kann nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs eine erhebliche Gefährdung des finanziellen Gleichgewichts des Systems der sozialen Sicherheit als solche einen zwingenden Grund des Allgemeininteresses darstellen, der eine Beschränkung des Grundsatzes des freien Dienstleistungsverkehrs rechtfertigen kann (vgl. u. a. Urteile Kohll, Randnr. 41, Smits und Peerbooms, Randnr. 72, und vom 19. April 2007, Stamatelaki, C‑444/05, Slg. 2007, I‑3185, Randnr. 30). |
| 86 |
Wie aus den beim Gerichtshof eingereichten Erklärungen hervorgeht, bezweckt eine Pflichtmitgliedschaft in einem gesetzlichen Versicherungssystem, wie sie die im Ausgangsverfahren streitige nationale Regelung vorsieht, die Gewährleistung des finanziellen Gleichgewichts eines der traditionellen Zweige der sozialen Sicherheit, hier der Versicherung gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten. |
| 87 |
Indem diese Verpflichtung den Zusammenschluss aller dem entsprechenden System unterliegenden Unternehmen innerhalb von Gefahrengemeinschaften gewährleistet, erlaubt sie es nämlich, dass dieses System, mit dem, wie aus Randnr. 38 des vorliegenden Urteils hervorgeht, ein soziales Ziel verfolgt wird, so funktioniert, dass der Grundsatz der Solidarität umgesetzt wird, indem insbesondere die Finanzierung über Beiträge erfolgt, deren Höhe nicht streng proportional zu den versicherten Risiken ist, und Leistungen erbracht werden, deren Wert nicht streng proportional zu den Beiträgen ist. |
| 88 |
Daher kann eine nationale Regelung wie die im Ausgangsverfahren streitige, soweit sie eine Pflichtmitgliedschaft vorsieht, durch einen zwingenden Grund des Allgemeininteresses, nämlich das Ziel, das finanzielle Gleichgewicht eines Zweigs der sozialen Sicherheit zu gewährleisten, gerechtfertigt werden, da diese Verpflichtung geeignet ist, die Verwirklichung dieses Ziels zu gewährleisten. |
| 89 |
Was die Frage anbelangt, ob eine solche Regelung nicht über das hinausgeht, was zur Erreichung des angestrebten Ziels erforderlich ist, ergibt sich, wie bereits in Randnr. 81 des vorliegenden Urteils festgestellt, aus den beim Gerichtshof eingereichten Unterlagen, dass das im Ausgangsverfahren streitige gesetzliche System eine Mindestabdeckung bietet, so dass es den ihr unterliegenden Unternehmen trotz der damit verbundenen Pflichtmitgliedschaft freisteht, diese Abdeckung dadurch zu ergänzen, dass sie zusätzliche Versicherungen abschließen, sofern diese auf dem Markt angeboten werden. Dieser Umstand stellt einen Faktor dar, der für die Verhältnismäßigkeit eines gesetzlichen Versicherungssystems wie des im Ausgangsverfahren streitigen spricht (vgl. in diesem Sinne Urteil Freskot, Randnr. 70). |
| 90 |
Was im Übrigen den Umfang der Abdeckung betrifft, wie sie dieses System vorsieht, lässt sich, wie die MMB in ihren Erklärungen ausführt, nicht ausschließen, dass sich Unternehmen, die beispielsweise ein junges und gesundes Personal mit ungefährlichen Tätigkeiten beschäftigen, bei privaten Versicherern um günstigere Versicherungsbedingungen bemühen würden, wenn die Versicherungspflicht auf bestimmte Leistungen, etwa die sich aus dem Ziel der Prävention ergebenden, zu beschränken wäre, wie es Kattner als Möglichkeit in ihren Erklärungen andeutet. Das fortschreitende Ausscheiden dieser „guten“ Risiken könnte den Berufsgenossenschaften wie der MMB einen wachsenden Anteil von „schlechten“ Risiken belassen, was zu einer Erhöhung der Kosten für die Leistungen, insbesondere für Unternehmen mit einem älteren, gefährliche Tätigkeiten ausübenden Personal, führen würde, denen die Berufsgenossenschaften zu annehmbaren Kosten keine Leistungen mehr anbieten könnten. Dies würde umso mehr gelten, wenn das betreffende gesetzliche Versicherungssystem, wie es im Ausgangsverfahren der Fall ist, in Umsetzung des Grundsatzes der Solidarität durch das Fehlen einer strengen Proportionalität zwischen den Beiträgen und den versicherten Risiken gekennzeichnet ist (vgl. entsprechend Urteil Albany, Randnrn. 108 und 109). |
| 91 |
Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, unter Berücksichtigung aller Umstände des bei ihm anhängigen Rechtsstreits und der in den Randnrn. 89 und 90 des vorliegenden Urteils gegebenen Hinweise zu prüfen, ob das im Ausgangsverfahren streitige gesetzliche Versicherungssystem im Hinblick auf das damit verfolgte Ziel des finanziellen Gleichgewichts der sozialen Sicherheit erforderlich ist. |
| 92 |
Folglich ist auf die zweite Vorlagefrage zu antworten, dass die Art. 49 EG und 50 EG dahin auszulegen sind, dass sie einer nationalen Regelung wie der im Ausgangsverfahren streitigen nicht entgegenstehen, nach der die Unternehmen, die in einem bestimmten Gebiet einem bestimmten Gewerbezweig angehören, verpflichtet sind, einer Einrichtung wie der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Berufsgenossenschaft beizutreten, soweit dieses System nicht über das hinausgeht, was zur Erreichung des Ziels der Gewährleistung des finanziellen Gleichgewichts eines Zweigs der sozialen Sicherheit erforderlich ist, was vom vorlegenden Gericht zu prüfen ist. Kosten |
| 93 |
Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig. Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Dritte Kammer) für Recht erkannt: 1. Die Art. 81 EG und 82 EG sind dahin auszulegen, dass eine Einrichtung wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehende Berufsgenossenschaft, der die Unternehmen, die in einem bestimmten Gebiet einem bestimmten Gewerbezweig angehören, für die Versicherung gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten beitreten müssen, kein Unternehmen im Sinne dieser Vorschriften ist, sondern eine Aufgabe rein sozialer Natur wahrnimmt, soweit sie im Rahmen eines Systems tätig wird, mit dem der Grundsatz der Solidarität umgesetzt wird und das staatlicher Aufsicht unterliegt, was vom vorlegenden Gericht zu prüfen ist. 2. Die Art. 49 EG und 50 EG sind dahin auszulegen, dass sie einer nationalen Regelung wie der im Ausgangsverfahren streitigen nicht entgegenstehen, nach der die Unternehmen, die in einem bestimmten Gebiet einem bestimmten Gewerbezweig angehören, verpflichtet sind, einer Einrichtung wie der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Berufsgenossenschaft beizutreten, soweit dieses System nicht über das hinausgeht, was zur Erreichung des Ziels der Gewährleistung des finanziellen Gleichgewichts eines Zweigs der sozialen Sicherheit erforderlich ist, was vom vorlegenden Gericht zu prüfen ist. Unterschriften |
* Verfahrenssprache: Deutsch.
Quelle: Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH), http://curia.europa.eu
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gern:
 |
Dr. Martin Hensche Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hensche@hensche.de |
 |
Christoph Hildebrandt Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hildebrandt@hensche.de |
 |
Nina Wesemann Rechtsanwältin Fachanwältin für Arbeitsrecht Kontakt: 040 / 69 20 68 04 wesemann@hensche.de |