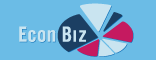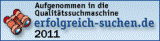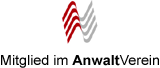- -> zur Mobil-Ansicht
- Arbeitsrecht aktuell
- Tipps und Tricks
- Handbuch Arbeitsrecht
- Gesetze zum Arbeitsrecht
- Urteile zum Arbeitsrecht
- Urteile 2023
- Urteile 2021
- Urteile 2020
- Urteile 2019
- Urteile 2018
- Urteile 2017
- Urteile 2016
- Urteile 2015
- Urteile 2014
- Urteile 2013
- Urteile 2012
- Urteile 2011
- Urteile 2010
- Urteile 2009
- Urteile 2008
- Urteile 2007
- Urteile 2006
- Urteile 2005
- Urteile 2004
- Urteile 2003
- Urteile 2002
- Urteile 2001
- Urteile 2000
- Urteile 1999
- Urteile 1998
- Urteile 1997
- Urteile 1996
- Urteile 1995
- Urteile 1994
- Urteile 1993
- Urteile 1992
- Urteile 1991
- Urteile bis 1990
- Arbeitsrecht Muster
- Videos
- Impressum-Generator
- Webinare zum Arbeitsrecht
-
Kanzlei Berlin
 030 - 26 39 62 0
030 - 26 39 62 0
 berlin@hensche.de
berlin@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Frankfurt
 069 - 71 03 30 04
069 - 71 03 30 04
 frankfurt@hensche.de
frankfurt@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hamburg
 040 - 69 20 68 04
040 - 69 20 68 04
 hamburg@hensche.de
hamburg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hannover
 0511 - 89 97 701
0511 - 89 97 701
 hannover@hensche.de
hannover@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Köln
 0221 - 70 90 718
0221 - 70 90 718
 koeln@hensche.de
koeln@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei München
 089 - 21 56 88 63
089 - 21 56 88 63
 muenchen@hensche.de
muenchen@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Nürnberg
 0911 - 95 33 207
0911 - 95 33 207
 nuernberg@hensche.de
nuernberg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Stuttgart
 0711 - 47 09 710
0711 - 47 09 710
 stuttgart@hensche.de
stuttgart@hensche.de
AnfahrtDetails
OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 30.01.2009, 10 A 10805/08
| Schlagworte: | Konkurrentenklage | |
| Gericht: | Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz | |
| Aktenzeichen: | 10 A 10805/08 | |
| Typ: | Urteil | |
| Entscheidungsdatum: | 30.01.2009 | |
| Leitsätze: | ||
| Vorinstanzen: | Verwaltungsgericht Koblenz, Urteil vom 1.07.2008, 6 K 1816/07.KO | |
10 A 10805/08.OVG
Verkündet am: 30.01.2009
gez.
Justizbeschäftigte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz
Urteil
Im Namen des Volkes
In dem Verwaltungsrechtsstreit
- Kläger und Berufungskläger -
Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Heinle, Felsch, Baden, Redeker und Partner GbR, Koblenzer Straße 99-103, 53177 Bonn,
gegen
das Land Rheinland-Pfalz, vertreten durch den Minister der Justiz, Ernst-Ludwig-Straße 3, 55116 Mainz,
- Beklagter und Berufungsbeklagter -
Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. Henning Obst, Mozartstraße 21, 40479 Düsseldorf,
beigeladen:
- 2 -
wegen Richterrechts
hat der 10. Senat des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz in Koblenz aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 30. Januar 2009, an der teilgenommen haben
Vizepräsident des Oberverwaltungsgerichts Steppling Richter am Oberverwaltungsgericht Hennig Richter am Oberverwaltungsgericht Möller ehrenamtliche Richterin Rentnerin Böhm ehrenamtliche Richterin Einzelhandelskauffrau Cleemann
für Recht erkannt:
Die Berufung des Klägers gegen das aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 1. Juli 2008 ergangene Urteil des Verwaltungsgerichts Koblenz wird zurückgewiesen.
Der Kläger trägt die Kosten des Berufungsverfahrens, mit Ausnahme der außer¬erichtlichen Kosten des Beigeladenen, die dieser selbst trägt.
Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar.
Die Revision wird zugelassen.
Tatbestand
Der Justizminister des Beklagten war bis zu seiner Ernennung zum Minister am 18. Mai 2006 Präsident des Oberlandesgerichts Koblenz. Nachdem diese nach R 8 besoldete Stelle frei geworden war, wurde sie im Justizblatt vom 6. Juni 2006 ausgeschrieben. Daraufhin bewarben sich unter anderem der Kläger - als nach R 6 besoldeter Präsident des Landgerichts Koblenz - sowie der Beigeladene - als ebenfalls nach R 6 besoldeter Präsident des Landessozialgerichts -. Beide wurden aus Anlass ihrer Bewerbung dienstlich beurteilt, der Kläger am 6. November 2006 durch den Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht X.... - als Vertreter des Vizepräsidenten des Oberlandesgerichts, der sich ebenfalls auf die Präsidentenstelle beworben hatte - und der Beigeladene am 11. Oktober 2006 durch den Justizminister selbst. Dabei war der Beurteilung des Klägers eine Beurteilung durch den Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht Y.... - als seinerzeitigen Vertreter des Vizepräsidenten - vom 11. August 2006 vorausgegangen, die jedoch aufgehoben worden war, nachdem der Kläger gegen sie Einwände erhoben hatte. Zu dieser Beurteilung wie auch zu der Beurteilung des Klägers vom 6. November 2006 gab der Justizminister - als ehemaliger OLG-Präsident - einen Beurteilungsbeitrag ab. Sowohl die Beurteilung des Klägers vom 6. November 2006 als auch die Beurteilung des Beigeladenen schlossen mit der zusammenfassenden Gesamtbeurteilung „hervorragend“. Für das angestrebte Amt wurde der Kläger als „sehr gut geeignet“, der Beigeladene als „hervorragend geeignet“ erachtet.
Dem Besetzungsvermerk des Justizministeriums vom 3. Januar 2007 wurde vorangestellt, welchen Anforderungen des zu vergebenden Amtes der Bewerber genügen müsse. Dabei wurde nicht darauf abgestellt, dass dieser über profunde Kenntnisse und Erfahrungen in allen Bereichen der ordentlichen Gerichtsbarkeit verfügen müsse. In dem Besetzungsvermerk wurde sodann im Einzelnen dargelegt, dass und warum der Beigeladene den Anforderungen des zu vergebenden Amtes am besten gerecht werde und ihm namentlich auch gegenüber dem Kläger der Vorzug zu geben
- 3 -
sei. Abschließend wurde vorgeschlagen, die Stelle des Präsidenten des Oberlandesgerichts dem Beigeladenen zu übertragen.
Der Präsidialrat der ordentlichen Gerichtsbarkeit stimmte in seiner Stellungnahme vom 23. Januar 2007 dem Besetzungsvorschlag des Justizministers nicht zu. Er vertrat die Auffassung, dass dem Anforderungsprofil des Amtes des Präsidenten des Oberlandesgerichts nur derjenige gerecht werde, der – wie bisher stets gefordert - zumindest auch mit den Besonderheiten und der Vielschichtigkeit der ordentlichen Gerichtsbarkeit vertraut sei und in diesem Bereich die zu fordernden herausragenden fachlichen Fähigkeiten nachweisen könne. Davon könne bei dem Beigeladenen aber nicht die Rede sein.
Das daraufhin anberaumte Einigungsgespräch zwischen dem Justizminister und dem Präsidialrat am 30. Januar 2007 führte zu keinem Erfolg. Der Präsidialrat nahm dies zum Anlass, mit Schreiben vom 1. Februar 2007 noch einmal seinen Standpunkt darzulegen. Darin hob er unter anderem hervor, das Ministerium habe einen Paradigmenwechsel vorgenommen, der den Eindruck erwecken könne, das Anforderungsprofil sei auf den Beigeladenen zugeschnitten.
Die Sitzung des Richterwahlausschusses vom 6. Februar 2007 zur Besetzung der Stelle des OLG-Präsidenten wurde auf den 8. Februar 2007 vertagt.
Eine Stunde vor dieser Sitzung kam es auf Initiative der Staatssekretärin im Justizministerium zu einem Gespräch zwischen ihr und den beiden richterlichen Mitgliedern des Richterwahlausschusses.
In der Sitzung vom 8. Februar 2007 erklärten diese unmittelbar vor der Abstimmung über den Besetzungsvorschlag des Justizministers, dass sie zwar in der Sache die Meinung des Präsidialrats teilten, dass sie sich aber bei der Abstimmung der Stimme enthalten würden, um so ihre Missbilligung des Verhaltens von Ausschussmitgliedern deutlich zu machen, die die anstehende Personalfrage in der Öffentlichkeit politisiert und Einzelheiten über den Verlauf der Sitzung vom 6. Februar an die Presse gegeben hätten.
Bei der Abstimmung votierten 5 Ausschussmitglieder für den Besetzungsvorschlag des Justizministers, 4 lehnten ihn ab und die beiden richterlichen Mitglieder enthielten sich der Stimme.
Unter dem 14. Februar 2007 teilte daraufhin das Justizministerium dem Kläger mit, dass beabsichtigt sei, die OLG-Präsidenten-Stelle dem Beigeladenen zu übertragen. Der Richterwahlausschuss habe dem Besetzungsvorschlag zugestimmt.
Gegen diese Mitteilung erhob der Kläger Widerspruch und suchte beim Verwaltungsgericht um die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes nach. Dieses lehnte den Antrag, dem Beklagten im Wege der einstweiligen Anordnung aufzugeben, den Beigeladenen vorläufig nicht zum Präsidenten des Oberlandesgerichts zu ernennen, mit Beschluss vom 25. April 2007 ab.
Gegen diesen Beschluss legte der Kläger Beschwerde ein.
Nachdem der Senat den Beteiligten unter dem 8. Juni 2007 mitgeteilt hatte, am 13. Juni eine Entscheidung treffen zu wollen, wandte sich der Kläger mit Schriftsatz vom 12. Juni 2007 an das Bundesverfassungsgericht und kündigte unter kurzer Darlegung des Verfahrensstandes einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung an. Dabei wies er darauf hin, dass zu erwarten sei, dass umgehend nach der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts am 13. Juni 2007 eine Urkundenaushändigung erfolge, wenn die Entscheidung zu seinen Lasten ausfalle. Schließlich bat er darum, kurzfristig eine Zwischenregelung zu treffen oder dem Justizministerium eine Zusicherung abzuverlangen, dass die Urkunde nicht ausgehändigt werde, bis das Bundesverfassungsgericht über den beabsichtigten einstweiligen Anordnungsantrag entschieden habe. Eine Abschrift dieses Schreibens übersandte er dem Justizministerium am 13. Juni 2007 per Fax. In dem Begleitschreiben hob er hervor, dass er davon ausgehe, dass vor einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im einstweiligen Anordnungsverfahren keine Ernennungsurkunde ausgehändigt werde.
Der Senat wies die Beschwerde mit Beschluss vom 13. Juni 2007 zurück. Den zugleich gestellten Hilfsantrag des Klägers, dem Beklagten aufzugeben, den Beigeladenen nicht vor Ablauf der Frist für die Einreichung einer Verfassungsbeschwerde bzw. - bei Einlegung einer solchen - vor dem Zeitpunkt, bis zu dem das Bundesverfassungsgericht eine Zwischenregelung habe treffen können, zum Präsidenten des Oberlandesgerichts Koblenz zu ernennen, verwarf der Senat.
- 4 -
Der Beschluss wurde dem Kläger und dem Beklagten am 22. Juni 2007 gleichzeitig mittags per Fax übermittelt. Wenig später händigte der Justizminister dem Beigeladenen die Ernennungsurkunde aus.
In Unkenntnis der bereits erfolgten Ernennung des Beigeladenen zum OLG-Präsidenten beantragte der Kläger noch am selben Tage beim Bundesverfassungsgericht den Erlass einer einstweiligen Anordnung. Diesen Antrag nahm er eine Woche später zurück, um stattdessen eine Verfassungsbeschwerde gegen die Entscheidungen des Verwaltungsgerichts und des Senats im Eilverfahren zu erheben.
Außerdem legte er mit Schriftsatz vom 30. Juli 2007 gegen die zwischenzeitliche Aushändigung der Ernennungsurkunde an den Beigeladenen Widerspruch ein.
Das Bundesverfassungsgericht nahm mit Beschluss vom 24. September 2007 die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung an. Zur Begründung führte es aus: Dem Kläger stehe die Möglichkeit zur Seite, zunächst fachgerichtlichen Rechtsschutz bei den Verwaltungsgerichten zu suchen, dessen Inanspruchnahme nicht offensichtlich aussichtslos erscheine. Die trotz bereits angekündigter Absicht der Anrufung des Bundesverfassungsgerichts unmittelbar nach Zustellung der Beschwerdeentscheidung des Oberverwaltungsgerichts erfolgte Aushändigung der Ernennungsurkunde an den Beigeladenen verletze den Kläger in seinen Rechten aus Art. 33 Abs. 2 i.V.m. Art. 19 Abs. 4 des Grundgesetzes. Es sei in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts geklärt, dass aus diesen Vorschriften eine Verpflichtung des Dienstherrn folge, vor Aushändigung der Ernennungsurkunde einen ausreichenden Zeitraum abzuwarten, um dem unterlegenen Mitbewerber die Möglichkeit zu geben, Eilantrag, Beschwerde oder Verfassungsbeschwerde zu erheben, wenn nur so die Möglichkeit der Gewährung effektiven Rechtsschutzes bestehe. Zur Verfolgung seiner Rechte stehe dem Kläger jedoch zunächst die Hauptsacheklage vor den Verwaltungsgerichten offen. Angesichts der jüngeren Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, die in verschiedenen mit dem hier gegebenen Sachverhalt durchaus vergleichbaren Fallgestaltungen die Durchführung des Hauptsacheverfahrens trotz bereits erfolgter Ernennung eines Mitbewerbers für zulässig halte, könne die Durchführung eines solchen fachgerichtlichen Verfahrens nicht als offensichtlich aussichtslos bewertet werden. Dem Kläger sei daher die Erschöpfung des Rechtsweges zuzumuten.
Als der Kläger dem Beklagten gegenüber klargestellt hatte, an seinen Widersprüchen gegen die Mitteilung vom 14. Februar 2007 und die Ernennung des Beigeladenen festzuhalten, wies der Beklagte die Widersprüche mit Bescheid vom 1. Oktober 2007 zurück. Zur Begründung führte er aus: Der Rechtsbehelf gegen die Ernennung sei bereits unstatthaft. Es gebe keine gegen die Ernennung gerichtete
„Beamtenkonkurrentenklage“. Der Widerspruch gegen die Negativmitteilung sei mit der Ernennung des Beigeladenen unzulässig geworden. Aus dem Grundsatz der Ämterstabilität folge, dass mit der endgültigen anderweitigen Besetzung der Stelle sich die Entscheidung, mit der die Bewerbung eines nicht berücksichtigten Beamten abschlägig beschieden werde, erledige. Für die Weiterverfolgung des hiergegen gerichteten Rechtsbehelfs fehle es am Sachbescheidungsinteresse.
Nachdem der Kläger daraufhin unter Hinweis auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts eine Überprüfung der Widerspruchsentscheidung angeregt hatte, antwortete ihm der Beklagte unter dem 22. Oktober 2007, es gebe keine Veranlassung zu einer Änderung des Widerspruchsbescheids. Im Übrigen wären die beiden Widersprüche auch als unbegründet zurückzuweisen. Die Auswahlentscheidung sei, wie es sich aus der rechtskräftigen Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts ergebe, inhaltlich nicht zu beanstanden. Im Folgenden wurde dies dann noch kurz ausgeführt.
Am 31. Oktober 2007 hat der Kläger sodann Klage erhoben und zu ihrer Begründung im Wesentlichen vorgetragen: Das Stellenbesetzungsverfahren sei noch nicht beendet. Damit sei auch sein Rechtsschutzinteresse nicht entfallen. Der Grundsatz der Ämterstabilität sei hier durchbrochen. Ihm sei durch die Vorgehensweise des Beklagten in verfassungswidriger Weise die Möglichkeit genommen worden, eine einstweilige Anordnung des Bundesverfassungsgerichts zu erwirken. Vermutlich sei sogar die Bekanntgabe der Beschwerdeentscheidung zwischen dem Oberverwaltungsgericht und dem Justizministerium abgestimmt worden, um vollendete Tatsachen schaffen zu können. Damit könnten sowohl die Ernennung des Beigeladenen angefochten als auch der Bewerbungsverfahrensanspruch voll weiterverfolgt werden. Sollte die Ernennung dagegen nicht angefochten werden können, so komme jedenfalls seine Bestellung neben dem Beigeladenen in Betracht. Hilfsweise rechtfertige sich sein Begehren als Fortsetzungsfeststellungsklage. Das Feststellungsinteresse ergebe sich aus der beabsichtigten Geltendmachung von Schadensersatz und unter dem Gesichtspunkt der Rehabilitation.
- 5 -
In der Sache sei zunächst zu sehen, dass der Beklagte, was das überhaupt erst nachträglich erstellte Anforderungsprofil anlange, von den sonst herangezogenen Grundsätzen, die zweifellos für ihn gesprochen hätten, abgewichen sei. Das neue Anforderungsprofil sei auf den Beigeladenen, der auch für weitaus weniger Bedienstete als er Verantwortung trage, zugeschnitten worden. Die dienstliche Beurteilung des Beigeladenen habe der Justizminister, praktisch ohne eigene Erkenntnisse zu dessen Leistungsstand und ohne die Anforderungen von Beurteilungsbeiträgen oder die Beiziehung von Verwaltungsvorgängen und anderem mehr, stimmig zu diesem Anforderungsprofil erstellt. Des Weiteren sei unberücksichtigt geblieben, dass er die bessere Beurteilungsentwicklung vorzuweisen habe. Darauf sei aber bei einem Beurteilungsgleichstand, wie er hier gegeben sei, maßgeblich abzustellen. Im Besetzungsvermerk seien - wie im Übrigen auch schon in den diesem zugrunde gelegten dienstlichen Beurteilungen - wesentliche Leistungen seinerseits gar nicht erwähnt worden, während beim Beigeladenen selbst Unbedeutendes groß herausgestellt worden sei; dessen angebliche Leistungen als Präsident des Landessozialgerichts würden im Übrigen relativiert durch Feststellungen des Landesrechnungshofes. Alles dies zeige, dass der Justizminister ihm gegenüber voreingenommen sei. Darauf deuteten auch weitere Umstände hin, wie die Verhinderung einstweiligen Rechtsschutzes beim Bundesverfassungsgericht, die Erstellung eines zunächst unzutreffende gravierende Einschränkungen enthaltenden Beurteilungsbeitrags, dem zudem eine gezielte Suche nach Defiziten in seiner Amtsführung vorausgegangen sei, die Einbestellung der richterlichen Mitglieder des Richterwahlausschusses vor der Sitzung am 8. Februar 2007, um, wie anzunehmen sei, auf deren Stimmverhalten einzuwirken, und die Bemühungen um weitere Kandidaten für das Amt, um an seiner Bewerbung vorbeikommen zu können. Zu Beginn des Besetzungsverfahrens - im Juni/Juli 2006 - sei der Justizminister noch erklärtermaßen davon ausgegangen, dass der Beigeladene für das zu vergebende Amt nicht in Betracht zu ziehen sei, zumal er „es nicht so gut mit den Leuten könne“. Der von ihm hilfsweise ins Auge gefasste Schadensersatzanspruch betreffe nicht nur die Gehaltsdifferenz, sondern auch die nutzlos aufgewandten Kosten. Schließlich halte er auch seinen bereits im Eilverfahren geltend gemachten Einwand aufrecht, dass der Richterwahlausschuss dem Besetzungsvorschlag des Justizministers nicht mit der erforderlichen Mehrheit zugestimmt habe.
Der Kläger hat beantragt,
1. die Entscheidung über die Ernennung des Beigeladenen zum Präsidenten des Oberlandesgerichts und die Besetzung des Dienstpostens des Präsidenten des Oberlandesgerichts Koblenz mit dem Beigeladenen sowie den Widerspruchsbescheid vom 1. Oktober 2007 in Gestalt des Ergänzungsbescheids vom 22. Oktober 2007, soweit er auf den Widerspruch gegen die Ernennung und die vollzogene Stellenbesetzung bezogen ist, aufzuheben,
2. den Beklagten unter Aufhebung des Widerspruchsbescheids vom 1. Oktober 2007 in Gestalt des Ergänzungsbescheids vom 22. Oktober 2007 im Übrigen und Änderung der für ihn abschlägigen Entscheidung vom 14. Februar 2007 über seine Nichtberücksichtigung im Auswahlverfahren zu verpflichten,
a) ihn zum Präsidenten des Oberlandesgerichts zu ernennen und in den Dienstposten des Präsidenten des Oberlandesgerichts Koblenz einzuweisen,
b) hilfsweise: dem Richterwahlausschuss seine Bestellung zum Präsidenten des Oberlandesgerichts Koblenz vorzuschlagen,
c) äußerst hilfsweise: über die Besetzung des Dienstpostens des Präsidenten des Oberlandesgerichts Koblenz unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts erneut zu entscheiden,
3. hilfsweise:
festzustellen, dass die Besetzung des Dienstpostens des Präsidenten des Oberlandesgerichts Koblenz mit dem Beigeladenen durch Aushändigung einer Ernennungsurkunde am 22. Juni 2007 rechtswidrig gewesen ist,
weiter hilfsweise:
festzustellen, dass die Aushändigung der Ernennungsurkunde und des
Einweisungsschreibens an den Beigeladenen am 22. Juni 2007 rechtswidrig gewesen ist und ihn in seinen Rechten verletzt.
- 6 -
Der Beklagte hat
Klageabweisung
beantragt und entgegnet: Der Kläger habe es unterlassen - was möglich gewesen wäre - beim Bundesverfassungsgericht Vollstreckungsschutz gegen die anstehende Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts zu beantragen. Eine Anfechtung der Ernennung eines Mitbewerbers habe das Bundesverwaltungsgericht bisher nicht für zulässig erachtet. Eine Ernennung des Klägers neben dem Beigeladenen zum Präsidenten des Oberlandesgerichts Koblenz sei nicht möglich. Es gehe um eine Funktionsstelle, die nicht geteilt werden könne. Es könne auch nur zwei Oberlandesgerichte in Rheinland-Pfalz geben. Ferner dürfe aus einer Funktionsstelle auch nur einer besoldet werden. In einem Besetzungsverfahren könne nach Organisationsermessen sehr wohl ein verändertes Anforderungsprofil erstellt werden. Die vom Kläger darin vermissten Einschränkungen seien keineswegs geboten. Die Verengung eines Anforderungsprofils - insbesondere auf Erfahrung - sei vielmehr durchaus problematisch. Im Übrigen gehe es um ein Amt mit überwiegend Verwaltungsaufgaben, wie sie auch in einer anderen Gerichtsbarkeit anstünden. Der Justizminister habe über den Beigeladenen ausreichende Kenntnisse gehabt, um ihn dienstlich beurteilen zu können. Entgegen der Auffassung des Klägers sei bei einem Gleichstand im Gesamturteil der dienstlichen Beurteilungen zweier Konkurrenten nicht sofort auf die Leistungsentwicklung abzustellen. Es seien vielmehr zunächst die Einzelaussagen auszuwerten. Wenn der Kläger den Justizminister ihm gegenüber für voreingenommen halte, hätte er die über ihn erstellte dienstliche Beurteilung anfechten müssen. Dieser sei im Besetzungsverfahren im Übrigen nur soweit tätig geworden, wie es aufgrund der Konstellation unvermeidbar gewesen sei. Was die angebliche Einwirkung auf den Richterwahlausschuss angehe, werde vom Kläger nichts Konkretes vorgetragen. Die dienstliche Beurteilung eines Chefpräsidenten müsse anderen Regeln folgen als die dienstliche Leistungserfassung eines in die Gerichtshierarchie eingebundenen Richters. Es gebe keinen Vorgesetzten, der mit einem Chefpräsidenten täglich zusammenarbeite.
Der Beigeladene hat sich im erstinstanzlichen Verfahren nicht zur Sache geäußert.
Das Verwaltungsgericht hat die Klage mit aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 1. Juli 2008 ergangenem Urteil abgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt: Die Hauptanträge zu 1. und 2 a. seien zwar zulässig; insoweit könne dem Kläger ein allgemeines Rechtsschutzbedürfnis nicht abgesprochen werden. Die Entscheidung des Ministers der Justiz, die ausgeschriebene Stelle mit dem Beigeladenen zu besetzen, begegne jedoch keinen rechtlichen Bedenken.
Die Beschreibung der Anforderungen im Rahmen des Besetzungsvermerks sei rechtlich unbedenklich. Nicht zu beanstanden sei zunächst, dass erst der Besetzungsvermerk eine Beschreibung der Anforderungen enthalten habe. Anhaltspunkte für das Vorliegen eines Ermessensmissbrauchs seien nicht zu erkennen. Insbesondere ergebe sich dies nicht schon daraus, dass der Beklagte entgegen seiner bisherigen Besetzungspraxis keine Erfahrungen der Bewerber in der entsprechenden Gerichtsbarkeit gefordert habe. Mit Blick auf das öffentliche Interesse an der bestmöglichen Besetzung der Dienstposten sei die Durchführung einer „offenen“ Ausschreibung rechtlich unbedenklich. Eine Bindung des Dienstherrn an frühere Anforderungsprofile gebe es nicht. Schließlich würden auch nicht „von der Natur der Sache her“ Erfahrungen des Bewerbers im Bereich der entsprechenden Gerichtsbarkeit gefordert.
Des Weiteren beruhe die Auswahlentscheidung nicht auf einer fehlerhaften Entscheidungsgrundlage. Die ihr zugrunde gelegten Beurteilungen des Klägers und des Beigeladenen hielten der gerichtlichen Überprüfung stand. Seine eigene Beurteilung habe der Kläger akzeptiert und gegen die Beurteilung des Beigeladenen sei nichts zu erinnern. Diese unterliege dabei in gleichem Maße einer gerichtlichen Überprüfung wie die des Klägers. Die Beurteilung des Beigeladenen beruhe auf gesicherten Erkenntnisquellen des Beurteilers. Es sei insofern zu berücksichtigen, dass eine Beurteilungssituation, wie sie in der Regel gegeben sei, hier nicht vorgelegen habe. Der Minister der Justiz sei zwar der unmittelbare Dienstvorgesetzte der Präsidenten der Landesobergerichte, stehe aber nicht in einem solch unmittelbaren und ständigen Kontakt zu diesen, dass er sich deren Tätigkeit, deren Einsatz und deren persönliches Verhalten gleichsam täglich über einen längeren Zeitraum hinweg unmittelbar vor Augen führen könne. Hinzu komme, dass Art, Inhalt und Umfang der Tätigkeit eines Chefpräsidenten und damit auch die an diesen zu stellenden Anforderungen sich grundlegend und qualitativ von denjenigen unterschieden, die ein Richter oder ein Vorsitzender Richter zu erfüllen habe. Der Präsident eines Landesobergerichts müsse sich überwiegend an anderen Kriterien messen lassen. Prägendes Qualitätsmerkmal sei insoweit das gute und reibungslose Funktionieren der betreffenden Gerichtsbarkeit. Ob,
- 7 -
wie und in welchem Umfang ein Chefpräsident diese Vorgaben habe erreichen können, bedürfe der Würdigung des Gesamtbildes der Gerichtsbarkeit; Aussagekräftiges lasse sich weder durch die tägliche Beobachtung noch durch die Bewertung einzelner Vorkommnisse und Ereignisse gewinnen. Die objektivierbare Faktenlage in Bezug auf das Gesamtbild der Gerichtsbarkeit lasse sich namentlich vorhandenem Zahlenmaterial über den Geschäftsanfall, die Erledigungen, die Dauer der Verfahren und die Stellung im Vergleich zu den entsprechenden Obergerichten anderer Bundesländer entnehmen. Aus der Natur dieser Beurteilungsgrundlage folge, dass das hierfür herangezogene Material den Beurteilungszeitraum abdecken und dem Beurteiler zum Zeitpunkt der Beurteilung verfügbar sein müsse. Demgegenüber komme es nicht darauf an, dass der Beurteiler während des gesamten Beurteilungszeitraumes der unmittelbare Dienstvorgesetzte des Beurteilten gewesen sei. Ebenso wenig bedürfe es insoweit der Einholung von Beurteilungen dritter Personen. Auch das in der Beurteilung des Beigeladenen abgegebene persönlichkeitsbedingte Werturteil beruhe auf einer tragfähigen Grundlage. Der Justizminister kenne den Beigeladenen nicht nur aus seiner Ministerzeit, sondern auch aus seiner mehrjährigen Zusammenarbeit im Kreis der Chefpräsidenten der rheinland-pfälzischen Obergerichte. Wenn der Kläger meine, es müsse hier wegen des gleichen Gesamturteils auf die Beurteilungsentwicklung abgestellt werden, übersehe er, dass zunächst die letzten Beurteilungen in Bezug auf die Einzelaussagen auszuwerten seien. Erst wenn sie insofern ausgeschöpft und die Bewerber im Wesentlichen gleich einzustufen seien, komme es auf die Beurteilungsentwicklung an. Vorliegend stütze sich die Beurteilung, der Beigeladene sei besser geeignet, auf die Bewertung einzelner - im Erwartungshorizont des Dienstherrn als besonders wichtig bezeichneter - Eigenschaften des Beigeladenen. Dies sei rechtlich nicht zu beanstanden.
Auch der Besetzungsvermerk sei verfahrensfehlerfrei zustande gekommen und inhaltlich nicht zu beanstanden. Für die Behauptung des Klägers, der Justizminister sei ihm gegenüber voreingenommen gewesen, fehle es, wie es bereits im Eilverfahren festgestellt worden sei, an Anhaltspunkten. Soweit der Kläger vortrage, er sei insgesamt besser geeignet als der Beigeladene, setze er unzulässigerweise seine
Selbsteinschätzung an die Stelle der Wertung des Dienstherrn.
Schließlich begegne, wie ebenfalls bereits im Eilverfahren festgestellt, die Beschlussfassung des Richterwahlausschusses keinen rechtlichen Bedenken. Was den angeblichen Versuch der Justizstaatssekretärin angehe, auf das Abstimmungsverhalten der beiden richterlichen Mitglieder des Richterwahlausschusses Einfluss zu nehmen, sei zu sehen, dass diese sich in deutlicher Form dazu erklärt hätten, dass und warum sie sich der Stimme enthalten wollten.
Die Hilfsanträge zu 2 b. und c. sowie der erste Hilfsantrag zu 3. seien zulässig, aber unbegründet, da die Auswahlentscheidung rechtlich nicht zu beanstanden sei. Der zweite Hilfsantrag zu 3. sei demgegenüber bereits unzulässig. Es sei schon nicht erkennbar, in welchem Recht der Kläger hierdurch möglicherweise verletzt sein könnte. Durch die erfolgte Ernennung des Beigeladenen könne die Rechtmäßigkeit der Auswahlentscheidung nicht nachträglich in Frage gestellt werden und auf eine mögliche Verletzung durch sie in seinen Rechten aus Art. 33 Abs. 2 i.V.m. Art. 19 Abs. 4 des Grundgesetzes könne sich der Kläger nicht mehr berufen, nachdem ihm im Rahmen des vorliegenden Verfahrens effektiver Rechtsschutz gewährt worden sei. Es fehle zudem ein besonderes Feststellungsinteresse. Das Bestehen eines Schadensersatzanspruchs sei bereits nicht substantiiert dargetan. Darüber hinaus werde ein berechtigtes Interesse insoweit nur dann anerkannt, wenn die Erledigung des Verwaltungsaktes erst nach Klageerhebung eingetreten sei.
Gegen das Urteil hat der Kläger fristgerecht die vom Verwaltungsgericht zugelassene Berufung eingelegt und zunächst die nach der Geschäftsverteilung des 10. Senats zur Mitwirkung im Berufungsverfahren berufenen Senatsmitglieder wegen der Besorgnis der Befangenheit abgelehnt. Das Gesuch hat der Senat in anderer Besetzung mit Beschluss vom 7. Oktober 2008 zurückgewiesen. Die daraufhin erhobene Gegenvorstellung, hilfsweise Anhörungsrüge, blieb erfolglos.
Zur Begründung der Berufung wiederholt der Kläger unter Aufrechterhaltung der vorgetragenen Befangenheitsgründe und des hierauf gestützten Befangenheitsgesuchs gegen die zur Mitwirkung am Verfahren berufenen Richter im Wesentlichen sein erstinstanzliches Vorbringen. Dabei stellt er insbesondere noch einmal heraus, dass jeder Verfahrensschritt, der möglicherweise den Richterwahlausschuss zu einem anderen Votum veranlasst hätte, unmittelbar auf das Gesamtergebnis durchschlüge; dem Richterwahlausschuss seien jedoch relevante Auswahlinformationen vorenthalten worden. Was die Beurteilung des Beigeladenen angeht, hält er daran fest, dass insofern nichts anderes gelte, als für dienstliche Beurteilungen ganz allgemein; die früheren
- 8 -
Dienstvorgesetzten des Beigeladenen hätten dessen Personalführungs- und Sozialkompetenz aber weniger euphorisch beurteilt. Mit Blick auf die Erforderlichkeit einer Einbeziehung auch der Beurteilungsentwicklung in den Eignungs- und Leistungsvergleich hebt er namentlich nochmals hervor, dass der qualitative Gehalt seiner vorausgegangenen Beurteilungen deutlich für ihn spreche und dass diese Ausrichtung erstmals mit der Anlassbeurteilung vom 6. November 2006 „gekippt“ sei. Was die geltend gemachte Voreingenommenheit des Justizministers ihm gegenüber angeht, stellt er klar, dass es insoweit auf eine Gesamtschau und Gesamtwürdigung der betreffenden Tatsachen ankomme. Zum Verfahren vor dem Richterwahlausschuss rügt er vor allem weiterhin, dass die Staatssekretärin auf das Stimmverhalten der richterlichen Ausschussmitglieder Einfluss genommen habe. Hierzu trägt er ergänzend vor, dass er, wenn er von dem betreffenden Gespräch rechtzeitig Kenntnis erlangt hätte, die beiden Richter als befangen abgelehnt hätte. Ferner macht er als Mangel des Besetzungsverfahrens erstmals geltend, dass sich der Niederschrift über das Einigungsgespräch zwischen dem Präsidialrat und dem Justizminister nicht entnehmen lasse, aufgrund welcher Erwägungen der Justizminister die Einschätzung des Präsidialrats für entkräftet erachtet habe. Zu den hilfsweise gestellten Feststellungsanträgen weist er darauf hin, dass er unabhängig von der Ordnungsgemäßheit des Auswahlverfahrens schon durch die Art und Weise der Urkundenaushändigung an den Beigeladenen in seinen Rechten verletzt sein könne; zumindest komme insoweit ein Anspruch auf Übernahme der im verfassungsgerichtlichen Eilverfahren vergeblich aufgewandten Kosten in Betracht. Im Übrigen beruft er sich zum Feststellungsinteresse erneut auf den Gesichtspunkt der Rehabilitierung; dazu sieht er insbesondere mit Rücksicht auf die „Blitzernennung“ des Beigeladenen Anlass.
Der Kläger beantragt,
unter Abänderung des angefochtenen Urteils nach seinen Anträgen erster Instanz zu erkennen.
Der Beklagte beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Zu der umgehenden Ernennung des Beigeladenen nach Zustellung der Beschwerdeentscheidung im Eilverfahren weist er darauf hin, dass es bis zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 24. September 2007 keinerlei Rechtsprechung dazu gegeben habe, dass nach Abschluss des verwaltungsgerichtlichen Eilverfahrens zum Konkurrentenrechtsschutz allein die Ankündigung einer Anrufung dieses Gerichts durch den unterlegenen Bewerber eine Sperrwirkung in Bezug auf die Ernennung des Konkurrenten auslösen solle. In der Sache beruft er sich zunächst erneut auf das Recht des Dienstherrn, für jedes Stellenbesetzungsverfahren ein eigenständiges Anforderungsprofil erstellen zu können, und weist hierzu darauf hin, dass die Auffassung antiquiert sei, dass Leitungsfunktionen der ordentlichen Gerichtsbarkeit nur mit Personen aus eben dieser Gerichtsbarkeit besetzt werden könnten. Des Weiteren bleibt er bei seiner Auffassung, dass die Beurteilung des Beigeladenen unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Beurteilung eines Chefpräsidenten auf ausreichenden Erkenntnissen des Justizministers in Bezug auf die Leistungen des Beigeladenen beruhe und dass es auf die Beurteilungsentwicklung erst dann ankomme, wenn auch nach Auswertung der Einzelaussagen der letzten dienstlichen Beurteilungen ein Beurteilungsgleichstand gegeben sei. Zur Voreingenommenheit des Justizministers hebt er insbesondere hervor, dass es zur Feststellung einer solchen im Gegensatz zu einer Besorgnis der Befangenheit auf die Sicht eines objektiven Dritten ankomme und insofern zu berücksichtigen sei, dass die Führungsaufgaben eines Vorgesetzten naturgemäß Konflikte mit sich bringen könnten; dabei seien zudem nur vor der in Rede stehenden Maßnahme aufgetretene Umstände in die Betrachtung miteinzubeziehen. Zum Verfahren vor dem Richterwahlausschuss führt er ergänzend aus, dass eine Ablehnung von Ausschussmitgliedern nur vor der zu treffenden Entscheidung möglich sei. Was die hilfsweise gestellten Feststellungsanträge angeht, fehlt es seiner Auffassung nach an einem Rehabilitationsinteresse, da es hinzunehmen sei, im Rahmen einer Beförderungsauswahl nur als zweitbester Kandidat zu gelten; daran ändere auch eine breite Presseberichterstattung nichts. Ein Feststellungsinteresse aus Gründen einer beabsichtigten Schadensersatzklage hält er wegen der Möglichkeit, insoweit Leistungsklage zu erheben, sowie mit Rücksicht auf die Bestimmung des § 839 Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches für nicht gegeben. Zu letzterem weist er auf die unzureichende „Einschaltung“ des Bundesverfassungsgerichts durch den Kläger und die Nichtanfechtung seiner eigenen dienstlichen Beurteilung hin.
Der Beigeladene hat sich auch im Berufungsverfahren nicht zur Sache eingelassen.
- 9 -
In der mündlichen Verhandlung hat der Kläger die aus der Anlage zur Sitzungsniederschrift ersichtlichen Beweisanträge gestellt. Diese sind vom Senat mit in der mündlichen Verhandlung verkündetem Beschluss abgelehnt worden.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der von den Beteiligten zu den Prozessakten gereichten Schriftsätze sowie der zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemachten Verwaltungsvorgänge, Personalakten des Klägers und des Beigeladenen sowie Gerichtsakten betreffend den Eilrechtsschutz verwiesen.
Entscheidungsgründe
Der Senat kann ungeachtet der Aufrechterhaltung des Befangenheitsgesuchs des Klägers gegen die nach der senatsinternen Geschäftsverteilung zur Mitwirkung am vorliegenden Verfahren berufenen Senatsmitglieder in der regulären Besetzung über die Berufung entscheiden, nachdem das betreffende Befangenheitsgesuch bereits mit den Beschlüssen vom 7. Oktober und 3. November 2008 zurückgewiesen worden ist, ohne dass der Kläger in der Folgezeit neue Befangenheitsgründe geltend gemacht hätte.
Die Berufung ist zulässig, hat in der Sache aber keinen Erfolg.
Das Verwaltungsgericht hat die Klage im Ergebnis zu Recht in vollem Umfang abgewiesen. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz ist die Klage allerdings nicht nur in Bezug auf einzelne Anträge unzulässig und im Übrigen unbegründet; vielmehr sind sämtliche Klageanträge bereits unzulässig.
Soweit der Kläger die Aufhebung der Ernennung des Beigeladenen zum Präsidenten des Oberlandesgerichts und die Verpflichtung des Beklagten erstrebt, ihn selbst zum OLG-Präsidenten zu ernennen, ist die Klage - einschließlich der insoweit zum Verpflichtungsbegehren gestellten Hilfsanträge - unzulässig, weil wegen der Stabilität des dem Beigeladenen mit der Aushändigung der Ernennungsurkunde am 22. Juni 2007 verliehenen Amtes weder die Ernennung vom Beklagten rückgängig gemacht noch gerichtlicherseits aufgehoben werden kann. Damit ist der auf die eigene Ernennung anstelle des Beigeladenen gerichtete Bewerbungsverfahrensanspruch des Klägers mangels Erfüllbarkeit untergegangen.
An dem beamten- und richterrechtlichen Grundsatz der Ämterstabilität, der besagt, dass eine einmal erfolgte Ernennung nur unter den gesetzlich festgelegten engen Voraussetzungen - die hier nicht gegeben sind - rückgängig gemacht werden kann - und damit einer auf die Verletzung des Art. 33 Abs. 2 des Grundgesetzes - GG - gestützten Anfechtung durch einen unterlegenen Beförderungsbewerber entzogen ist -, hat das Bundesverwaltungsgericht bis zuletzt festgehalten. Dies gilt auch insoweit, als es in bestimmten Fällen eine Weiterverfolgung des Bewerbungsverfahrensanspruchs durch den im Stellenbesetzungsverfahren unterlegenen Beförderungsbewerber ungeachtet der zwischenzeitlichen Beförderung des Konkurrenten für möglich gehalten hat. Der Bundesgerichtshof und das Bundesarbeitsgericht haben sich dem ebenso wie auch der Senat in ständiger Rechtsprechung angeschlossen. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Rechtsauffassung in ständiger Rechtsprechung für verfassungsrechtlich unbedenklich erachtet.
Bis zu seinem Urteil vom 13. September 2001 (BVerwGE 115, 89) war gefestigte Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, dass sich mit der Ernennung des ausgewählten Konkurrenten der um eine Beförderungsauswahl geführte Rechtsstreit erledigt, weil die Beförderung nicht mehr rückgängig gemacht werden kann (vgl. hierzu z.B. Urteil vom 25. August 1988, BVerwGE 80, 127, sowie Beschluss vom 30. Juni 1993, Buchholz 232 § 8 BBG Nr. 49). Nachdem in der Entscheidung vom 25. August 1988 noch offen gelassen worden war, ob und inwieweit dem bei einer Stellenbesetzung nicht berücksichtigten Bewerber durch eine Anfechtungsklage gegen die Ernennung des vorgezogenen Konkurrenten Rechtsschutz gewährt werden könne, wurde im Beschluss vom 30. Juni 1993 überdies klargestellt, dass nach der Ernennung des ausgewählten Mitbewerbers auch das auf Aufhebung dieser Entscheidung gerichtete Klagebegehren des nichtberücksichtigten Bewerbers von Anfang an keinen Erfolg haben könne.
Diese Rechtsprechung, der sich auch der Bundesgerichtshof (vgl. z.B. Urteil vom 6. April 1995, BGHZ 129, 226) sowie das Bundesarbeitsgericht (vgl. z.B. Urteil vom 2. Dezember 1997, BAGE 87, 165) anschlossen, begegnete, wie das Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung feststellte (vgl. z.B. Beschluss vom 19. September 1989, NJW 1990, 501) keinen verfassungsrechtlichen Bedenken.
- 10 -
Nachdem das Bundesverwaltungsgericht dann in einem „sich ....schon im Ausgangspunkt von einem Streit um die Auswahl für eine Beförderungsstelle“ unterscheidenden Verfahren in einem „obiter dictum“ zu seinem Urteil vom 13. September 2001 (a.a.O.) Zweifel geäußert hatte, ob an der oben dargestellten Rechtsprechung festzuhalten sei, hat es in seinem Urteil vom 21. August 2003 (BVerwGE 118, 370) klargestellt, dass die bisherige Rechtsauffassung aufrechterhalten werde, und zur Begründung darauf hingewiesen, dass das Bundesverfassungsgericht die im Urteil vom 13. September 2001 geäußerten verfassungsrechtlichen Bedenken durch Beschluss vom 24. September 2002 (DVBl. 2002, 1633) entkräftet habe. Dort hatte das Bundesverfassungsgericht ein weiteres Mal die bisherige Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts als verfassungsrechtlich unbedenklich bezeichnet. Soweit das Bundesverwaltungsgericht in der Entscheidung vom 21. August 2003 in bestimmten Fällen eine Weiterverfolgung des Bewerbungsverfahrensanspruchs durch den unterlegenen Beförderungsbewerber trotz der zwischenzeitlichen Beförderung des Konkurrenten für möglich gehalten hat, hat es ergänzend hervorgehoben, dass dies nicht die Möglichkeit voraussetze, die bereits erfolgte Ernennung aufzuheben.
In seinem Beschluss vom 28. April 2005 (NJW-RR 2005, 998) hat das Bundesverfassungsgericht dann in einem die Besetzung einer Notarstelle betreffenden Verfahren noch einmal bei Prüfung der Zulässigkeit der erhobenen Verfassungsbeschwerde den Grundsatz der Ämterstabilität und dessen Rechtsfolgen für das Besetzungsverfahren angesprochen. Es hat ausgeführt, für die Verfassungsbeschwerde sei das Rechtsschutzinteresse gegeben, obwohl wegen des Grundsatzes der Ämterstabilität die bereits erfolgte Bestellung des ausgewählten Bewerbers nicht widerrufen und der Beschwerdeführer auf der diesem übertragenen Notarstelle nicht ernannt werden könne.
In seinem ebenfalls zu einer Notarstelle ergangenen Beschluss vom 28. November 2005 (BGHZ 165, 139) hat der Bundesgerichtshof die eigene dem entsprechende Rechtsprechung fortgeführt und nochmals hervorgehoben, dass einer Rückgängigmachung der zwischenzeitlich erfolgten Ernennung des Mitbewerbers der Grundsatz der Ämterstabilität entgegenstehe; die Rechtsposition, welche der Mitbewerber durch seine Bestellung erlangt habe, könne von dem unberücksichtigt gebliebenen Bewerber nicht erfolgreich angefochten werden, da sie nicht mehr revidiert werden könne.
Die Verfassungsbeschwerde gegen diesen BGH-Beschluss hat das Bundesverfassungsgericht mit Beschluss vom 29. März 2006 (NJW 2006, 2395) nicht zur Entscheidung angenommen. In den Gründen hat es die Auffassung des Bundesgerichtshofs für verfassungsgemäß erachtet.
Vor allem aber hat das Bundesverfassungsgericht noch zwei Monate vor seiner Entscheidung im Verfassungsbeschwerdeverfahren des Klägers - mit Beschluss vom 9. Juli 2007 (NVwZ 2007, 1178) - in einem beamtenrechtlichen Konkurrentenverfahren wiederum bei Prüfung der Zulässigkeit der erhobenen Verfassungsbeschwerde herausgestellt, ihr fehle nicht das Rechtsschutzbedürfnis, obwohl die bereits erfolgte Ernennung des ausgewählten Bewerbers wegen des Grundsatzes der Ämterstabilität nicht zurückgenommen und dem Beschwerdeführer die ausgeschriebene Stelle daher auch nicht mehr übertragen werden könne. Zur Begründetheit der Verfassungsbeschwerde hat es dann unter Zitierung der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. August 2003 zum Beleg der „ständigen Rechtsprechung“ dieses Gerichts festgestellt, dass sich nach dieser Rechtsprechung der um eine Beförderungsauswahl geführte Rechtsstreit grundsätzlich mit der endgültigen Besetzung der ausgeschriebenen Stelle erledigt.
Warum das Bundesverfassungsgericht nur kurz danach in seinem Kammerbeschluss vom 24. September 2007 (NVwZ 2008, 70) in Sachen des Klägers bei dem dargestellten Meinungsstand in der höchstrichterlichen - und seiner eigenen ‑ Rechtsprechung einen Klärungsbedarf in Bezug auf die sich in einem Stellenbesetzungsverfahren aus dem Grundsatz der Ämterstabilität ergebenden Rechtsfolgen glaubte feststellen zu können, erschließt sich dem Senat nicht, jedenfalls dann nicht, wenn man dem Begriff der Ämterstabilität das allgemeine Verständnis zugrunde legt. Namentlich kann danach nicht davon die Rede sein, dass der Bundesgerichtshof „in Abgrenzung zur Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts“ am Grundsatz der Ämterstabilität festhält. Vielmehr hat dies auch das Bundesverwaltungsgericht bis zuletzt getan.
Insbesondere sei dazu hier noch hervorgehoben, dass nicht nur, wie oben bereits angesprochen, eine unter Verstoß gegen Art. 33 Abs. 2 GG erfolgende Ernennung, sondern auch eine die Gewährung effektiven Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 GG) vereitelnde Ernennung nicht dazu berechtigt, die Ernennung zurückzunehmen; auch
- 11 -
eine solche Ernennung erfüllt keinen der abschließend gesetzlich bestimmten Tatbestände, die eine Rückgängigmachung der Ernennung zulassen.
Die Klage ist auch insoweit unzulässig, als der Kläger mit seinem Klageantrag zu 2. des Weiteren jedenfalls die Verpflichtung des Beklagten zu seiner Ernennung zum OLG-Präsidenten ungeachtet der zwischenzeitlichen Verleihung dieses Amtes an den Beigeladenen erstrebt. Unzulässig sind dabei auch die hierauf bezogenen Hilfsanträge zu 2 b) und c). Eine solche Möglichkeit besteht nach der bisherigen Rechtsprechung nur in engen Ausnahmefällen. Die Voraussetzungen hierfür liegen nicht vor, bzw. deren Annahme verbietet sich angesichts der Besonderheiten des vorliegenden Falles.
Allerdings hat das Bundesverwaltungsgericht in seiner Entscheidung vom 21. August 2003 (a.a.O.) im Anschluss an seine oben schon in Bezug genommene Klarstellung, dass es bei seiner bisherigen Rechtsprechung verbleibe, festgestellt, wenn entgegen einer einstweiligen Anordnung ein Mitbewerber befördert worden sei, könne der im vorläufigen Rechtsschutz erfolgreiche Beamte seinen Bewerbungsverfahrensanspruch im Hauptsacheverfahren weiterverfolgen. Ein unter Verstoß gegen Art. 33 Abs. 2 GG abgelehnter Beförderungsbewerber müsse vor Gericht seinen Bewerbungsverfahrensanspruch durchsetzen können. Die bloße Feststellung der Rechtswidrigkeit der Ablehnung oder die Verweisung auf Schadensersatz genügten dem Rechtsschutzanspruch nicht, wenn nicht tatsächliche Umstände oder zwingende Gründe des allgemeinen Wohls der Beseitigung der ablehnenden Entscheidung entgegenstünden. Werde die Verletzung eines subjektiven Rechts gerügt, fordere das Gebot effektiven Rechtsschutzes die Möglichkeit einer vollständigen rechtlichen und tatsächlichen Nachprüfung durch ein Gericht und dessen ausreichende Entscheidungsmacht, um drohende Rechtsverletzungen abzuwenden und geschehene Rechtsverletzungen zu beheben. Praktische Schwierigkeiten rechtfertigten es nicht, den durch Art. 19 Abs. 4 GG gewährleisteten Rechtsschutz einzuschränken. Mit diesen Vorgaben sei die Annahme unvereinbar, der Bewerbungsverfahrensanspruch gehe auch dann mangels Erfüllbarkeit durch den Dienstherrn unter, wenn dieser unter Verstoß gegen eine den Anspruch sichernde einstweilige Anordnung einen Konkurrenten befördere. Ebenso wie es Art. 19 Abs. 4 GG i.V.m. Art. 33 Abs. 2 GG verletze, wenn der unterlegene Bewerber vom Ausgang des Stellenbesetzungsverfahrens erst nach der Ernennung des Mitbewerbers erfahre, sei dies auch dann der Fall, wenn der Dienstherr sich mit der Ernennung des Konkurrenten unter zusätzlicher Verletzung des Art. 20 Abs. 3 GG über eine einstweilige Anordnung hinwegsetze. Der Betroffene habe vielmehr einen Anspruch auf Wiederherstellung, wenn die Verwaltung durch ihr Verhalten rechtzeitigen vorläufigen Rechtsschutz verhindere oder dessen erfolgreiche Inanspruchnahme missachte. Der Dienstherr könne dem übergangenen Bewerber nicht das Fehlen einer besetzbaren Planstelle entgegenhalten. Dieser könne vielmehr verlangen, verfahrensrechtlich und materiell-rechtlich so gestellt zu werden, als sei die einstweilige Anordnung befolgt worden. Die Beförderung eines erweislich zu Unrecht nicht ausgewählten Bewerbers sei von Rechts wegen nicht ausgeschlossen, wenn der Dienstherr eine einstweilige Sicherungsanordnung missachtet habe. Erforderlichenfalls sei eine benötigte weitere Planstelle zu schaffen.
Ob dem uneingeschränkt zu folgen ist, kann hier letztlich dahingestellt bleiben. Rechtliche Bedenken könnten sich insoweit insbesondere (vgl. im Übrigen z.B. Schnellenbach, Anmerkung zu dem Urteil, ZBR 2004, 104) daraus ergeben, dass die Vergabe einer anderen als der ursprünglich ausgeschriebenen Stelle - um eine solche handelte es sich zweifellos bei einer „neu geschaffenen“ Stelle, im Übrigen aber auch dann, wenn die mit dem Konkurrenten besetzte Stelle etwa durch dessen Versetzung oder Umsetzung wieder frei geworden ist (vgl. hierzu z.B. BVerwG, Urteil vom 25. August 1988, a.a.O.) - ohne eine Ausschreibung, wie sie für derartige Stellen zwingend vorgeschrieben ist (vgl. zur Ausschreibungspflicht hinsichtlich freier Richterstellen z.B. Beschluss des Senats vom 19. Dezember 1996, ZBR 1998, 61), das grundrechtsgleiche Recht anderer (auch neuer) ‑ möglicherweise leistungsstärkerer - Bewerber aus Art. 33 Abs. 2 GG verletzen könnte (vgl. dazu neben dem Urteil des BVerwG vom 25. August 1988 den Beschluss des BGH vom 28. November 2005, a.a.O.).
Denn auch aus dieser Rechtsprechung lässt sich ein Anspruch des Klägers auf Ernennung zum Präsidenten des Oberlandesgerichts nicht herleiten.
Es stellt sich bereits die Frage, ob sie sich überhaupt auf den vorliegenden Sachverhalt übertragen lässt. Der Senat teilt jedenfalls nicht die vom Bundesverfassungsgericht in seinem Kammerbeschluss vom 24. September 2007 (a.a.O.) geäußerte Auffassung, dass zwischen den im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts angesprochenen Fallgestaltungen und den im Falle des Klägers gegebenen Umständen eine „sachliche Übereinstimmung“ besteht. Keiner weiteren Vertiefung bedarf es, dass von einer solchen
- 12 -
Übereinstimmung zwischen der Fallgestaltung, die das Bundesverwaltungsgericht zu würdigen hatte, und der hier vorliegenden nicht die Rede sein kann, ging es dort doch um eine Beförderung des Mitbewerbers unter Missachtung einer einstweiligen Anordnung, während hier eine Beförderung nach unanfechtbarer Ablehnung einer einstweiligen Anordnung inmitten steht. Aber auch in Bezug auf den nach dem angeführten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vergleichbaren Fall, dass der unterlegene Bewerber vom Ausgang des Stellenbesetzungsverfahrens erst nach der Ernennung des Mitbewerbers erfährt, fehlt es nach Auffassung des Senats an einer „sachlichen Übereinstimmung“. Vorliegend erfolgte die Ernennung des Beigeladenen erst nach Mitteilung an den Kläger, dass beabsichtigt sei, jenem die Stelle zu übertragen, und nach Erschöpfung des Rechtsweges im verwaltungsgerichtlichen Eilrechtsschutz.
Eine „sachliche Übereinstimmung“ mit den hier gegebenen Umständen folgt schließlich auch nicht aus der Tatsache, dass der Kläger gegenüber dem Bundesverfassungsgericht die Stellung eines einstweiligen Anordnungsantrages angekündigt und den Beklagten davon in Kenntnis gesetzt hatte. Selbst wenn die ungeachtet dessen kurz nach Bekanntgabe der Beschwerdeentscheidung erfolgte Ernennung des Beigeladenen den Kläger in seinen Rechten aus Art. 33 Abs. 2 i.V.m. Art. 19 Abs. 4 GG verletzte, wie dies das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss vom 24. September 2007 einleitend herausgestellt hat, ließe sich der hier gegebene Sachverhalt nicht gleichsetzen mit dem Fall der Beförderung ohne vorherige Negativmitteilung. Dem steht zumindest entgegen, dass sich dem Beklagten nach dem Stand der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung im Zeitpunkt der Aushändigung der Ernennungsurkunde keineswegs aufdrängen musste, dass die ihm bekannte bloße Ankündigung eines einstweiligen Anordnungsantrages seitens des Klägers gegenüber dem Bundesverfassungsgericht ihn von Verfassungswegen daran hindern könnte, den Beigeladenen nach der unanfechtbaren Ablehnung des Antrags des Klägers auf Gewährung verwaltungsgerichtlichen Eilrechtsschutzes zum OLG-Präsidenten zu ernennen. Das gilt umso mehr, als das Bundesverfassungsgericht die ihm „vorab per Fax“ zugeleitete Schutzschrift des Klägers vom 12. Juni 2007, in der dieser die Ankündigung eines einstweiligen Anordnungsantrages mit dem Ersuchen verbunden hatte, kurzfristig eine Zwischenregelung zu treffen oder dem Justizministerium die Zusicherung eines Zuwartens mit der Urkundenaushändigung bis zur Entscheidung über den beabsichtigten einstweiligen Anordnungsantrag abzuverlangen, bis zum 22. Juni 2006 nicht zum Anlass genommen hatte, dieser Bitte nachzukommen. Auch sie war dem Beklagten aber bekannt, da der Kläger ihm am 13. Juni 2006 die Schutzschrift an das Bundesverfassungsgericht in Abschrift zugeleitet hatte.
Auch nach der Auffassung des Bundesverfassungsgerichts ist die Verfassungsbeschwerde kein zusätzlicher Rechtsbehelf zum fachgerichtlichen Verfahren, der sich diesem in gleicher Funktion ohne weiteres anschließt (vgl. z.B. BVerfG, Beschluss vom 10. Februar 1987, BVerfGE 74, 220). Sie ist ein besonderes Rechtsschutzmittel zur prozessualen Durchsetzung der Grundrechte oder der diesen gleichgestellten Rechte (vgl. z.B. BVerfG, Beschluss vom 27. September 1951, BVerfGE 1, 4), mithin ein außerordentlicher Rechtsbehelf; mit ihr wurde nicht eine Ergänzung des fachgerichtlichen Rechtsschutzes, nicht ein weiterer Rechtsweg, sondern ein Rechtsinstitut geschaffen, das in einem außerhalb des Rechtswegs angesiedelten außerordentlichen Rechtsbehelfsverfahren eine Überprüfung am Maßstab der Grundrechte ermöglicht (vgl. z.B. BVerfG, Urteil vom 14. Mai 1996, BVerfGE 94, 166). Kontrolle der Einhaltung und die Beachtung der Grundrechte sind zunächst Sache der fachgerichtlichen Rechtsprechung (vgl. z.B. BVerfG, Beschluss vom 2. Dezember 1986, BVerfGE 74, 69). Die bloße Erhebung der Verfassungsbeschwerde entfaltet noch keine aufschiebende Wirkung (vgl. z.B. BVerfG, Beschluss vom 18. Januar 1996, BVerfGE 93, 381). Die Prozessordnungen gewährleisten die nach Art. 19 Abs. 4 GG gebotene Effektivität des Rechtsschutzes (vgl. z.B. BVerfG, Urteil vom 14. Mai 1996, a.a.O.). Wenn im verwaltungsgerichtlichen Eilverfahren dem Antragsteller bei Versagung des einstweiligen Rechtsschutzes eine erhebliche, über den Randbereich hinausgehende Verletzung in seinen Grundrechten droht, die durch eine der Klage stattgebende Entscheidung in der Hauptsache nicht mehr beseitigt werden kann, ist ihm erforderlichenfalls unter eingehender tatsächlicher und rechtlicher Prüfung des im Hauptverfahren geltend gemachten Anspruchs einstweiliger Rechtsschutz zu gewähren, sofern nicht ausnahmsweise gewichtige Gründe entgegenstehen (vgl. z.B. BVerfG, Beschluss vom 29. Juli 2003, DVBl. 2003, 1524).
Was in Sonderheit die Effektivität des verfassungsgerichtlichen Rechtsschutzes nach Erschöpfung des fachgerichtlichen Rechtsschutzes, die Sicherung des Übergangs vom fachgerichtlichen Verfahren zum außerordentlichen Rechtsbehelfsverfahren der Verfassungsbeschwerde, angeht, gab es bis zum 22. Juni 2007 keine – jedenfalls keine veröffentlichte – Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts dahin, dass in einem
- 13 -
Beförderungskonkurrentenstreit stets nach Erschöpfung des Rechtswegs im verwaltungsgerichtlichen Eilrechtsschutz die Aushändigung der Ernennungsurkunde an den ausgewählten Mitbewerber zunächst über einen ausreichenden Zeitraum zurückgestellt werden müsse, um dem unterlegenen Mitbewerber auch noch die Möglichkeit zu geben, Verfassungsbeschwerde zu erheben – oder doch dass dies jedenfalls dann nötig sei, wenn der unterlegene Mitbewerber bereits die Absicht angekündigt habe, beim Bundesverfassungsgericht einen Eilantrag gemäß § 32 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes – BVerfGG – zu stellen.
So hatte das Bundesverfassungsgericht noch in seinem Urteil vom 14. Mai 1996 (a.a.O.) erkannt, dass „die Rechtsordnung ....nicht .... (vorsehe), dass mit der Vollstreckung von Gerichtsentscheidungen solange innezuhalten sei, bis ein Betroffener dem Bundesverfassungsgericht darlegen .... (könne), die Entscheidung verletze ihn in Grundrechten, und es Gelegenheit .... (gehabt habe), ihn durch den Erlass einer einstweiligen Anordnung vor den faktischen Folgen möglicher Grundrechtsverletzungen zu schützen“. Das Bundesverfassungsgericht hatte nur entschieden, dass die Exekutive ein beim Bundesverfassungsgericht anhängiges Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Anordnung nicht durch den faktischen Vollzug des angegriffenen Hoheitsaktes überspielen dürfe (vgl. z.B. BVerfG, Urteil vom 18. Juni 1973, BVerfGE 35, 257). Dem entsprach der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 28. April 2005 (a.a.O.), der den Fall einer Ernennung des ausgewählten Mitbewerbers um eine Notarstelle nach Erhebung einer Verfassungsbeschwerde und Beantragung einer verfassungsgerichtlichen einstweiligen Anordnung seitens des unterlegenen Mitbewerbers betraf. Dort hatte das Bundesverfassungsgericht festgestellt, auch wenn sich das Justizministerium nicht über eine einstweilige Anordnung hinweggesetzt habe, sei dem Beschwerdeführer durch die umgehende Ernennung des Mitbewerbers faktisch die Möglichkeit genommen worden, die Besetzung der Notarstelle durch eine verfassungsgerichtliche Eilentscheidung zu verhindern; daher folge aus dem Gebot effektiven Rechtsschutzes in Verbindung mit den zu wahrenden Grundrechten, dass dem Beschwerdeführer die Weiterverfolgung des Bewerbungsverfahrensanspruchs im Wege der Verfassungsbeschwerde möglich sein müsse. Zitiert war dazu die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 8. Oktober 2004 (NJW 2005, 50), die eine Ernennung zum Notar sogar unter Missachtung einer verfassungsgerichtlichen einstweiligen Anordnung zugunsten des unterlegenen Mitbewerbers betraf.
Unter Berücksichtigung des aufgezeigten Standes der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts am 22. Juni 2007 musste sich dem Beklagten zu dem genannten Zeitpunkt nicht die erstmals im Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 9. Juli 2007 (a.a.O.) und sodann in dessen die Verfassungsbeschwerde des Klägers betreffenden Beschluss vom 24. September 2007 (a.a.O.) zum Ausdruck gebrachte Rechtsauffassung aufdrängen.
Danach geht der Senat – in Übereinstimmung mit dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof (vgl. Beschluss vom 4. September 2007, ESVGH 58, 123) – allerdings davon aus, dass das Bundesverfassungsgericht mit diesen Entscheidungen unabhängig davon, ob ein Eilantrag zum Bundesverfassungsgericht bereits angekündigt ist, ein angemessen langes Zuwarten mit der Aushändigung der Ernennungsurkunde an den ausgewählten Mitbewerber nach Erschöpfung des Rechtswegs im verwaltungsgerichtlichen Eilrechtsschutz fordert. So wird im Beschluss vom 9. Juli 2007 ohne gesonderte Erwähnung der auch in jenem Fall bereits vorliegenden Ankündigung eines Antrags gemäß § 32 BVerfGG ausgeführt, aus denselben Erwägungen – wie zu den Erfordernissen eines effektiven verwaltungsgerichtlichen Eilrechtsschutzes im Konkurrentenstreit – folge auch eine Verpflichtung, vor Aushändigung der Urkunde einen ausreichenden Zeitraum abzuwarten, um dem Mitbewerber die Möglichkeit zu geben, „Eilantrag, Beschwerde oder Verfassungsbeschwerde“ zu erheben, weil nur so die Möglichkeit der Gewährung effektiven Rechtsschutzes bestehe. Durch die umgehende Ernennung des Mitbewerbers werde dem unterlegenen Konkurrenten faktisch die Möglichkeit genommen, die Besetzung der ausgeschriebenen Stelle durch eine verfassungsgerichtliche Eilentscheidung zu verhindern. Zitiert wurde hierzu die allerdings den Fall einer nach Stellung eines Eilantrages beim Bundesverfassungsgericht erfolgten Ernennung betreffende Entscheidung vom 28. April 2005 (a.a.O.). In dem Beschluss vom 24. September 2007 (a.a.O.) wurde dann der Beschluss vom 9. Juli 2007 als Beleg dafür angeführt, dass es „in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts .... geklärt .... (sei), dass aus Art. 19 Abs. 4 GG i.V.m. Art. 33 Abs. 2 GG eine Verpflichtung des Dienstherrn .... (folge), vor Aushändigung der Ernennungsurkunde einen ausreichenden Zeitraum abzuwarten, um dem unterlegenen Mitbewerber die Möglichkeit zu geben, Eilantrag, Beschwerde oder Verfassungs-
- 14 -
beschwerde zu erheben, wenn nur so die Möglichkeit der Gewährung effektiven Rechtsschutzes .... (bestehe)“.
Der Beklagte musste sich indes auch nicht wegen der hier aber doch zumindest gegebenen – und im Beschluss vom 24. September 2007 anders als im Beschluss vom 9. Juli 2007 zumindest angesprochenen – „Besonderheit“ der bereits vorliegenden Ankündigung eines Eilantrags an das Bundesverfassungsgericht daran gehindert sehen, den Beigeladenen alsbald nach Zustellung der Beschwerdeentscheidung des Senats vom 13. Juni 2007 zum OLG-Präsidenten zu ernennen. Dies folgt daraus, dass der Kläger die – dem Beklagten bekannte – Ankündigung des Eilantrags mit der – dem Beklagten gleichermaßen bekannten – Bitte an das Bundesverfassungsgericht um eine Zwischenregelung bzw. eine „Stillhalteabsprache“ verbunden hatte, ohne dass das Bundesverfassungsgericht in den ihm dafür zur Verfügung stehenden 9 Tagen in irgendeiner Weise reagiert hätte.
Nach alledem fehlt es nach Auffassung des Senats schon an einer „sachlichen Übereinstimmung“ zwischen den hier gegebenen Umständen und den im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. August 2003 (a.a.O.) angesprochenen Fallgestaltungen.
Eine Ernennung des Klägers zum OLG-Präsidenten ungeachtet der zwischenzeitlichen Verleihung dieses Amtes an den Beigeladenen scheidet aber auch deswegen – mit der Folge der Unzulässigkeit der hierauf gerichteten Klage – aus, weil mit Rücksicht auf die hier gegebenen Besonderheiten aus zwingenden Rechtsgründen der Weg verstellt ist, den Kläger unabhängig von der nicht mehr revidierbaren Rechtsposition des Beigeladenen zu befördern. Die Rechtslage ist insofern vergleichbar mit den rechtlichen Gegebenheiten, wie sie vom Bundesgerichtshof in seinem – vom Bundesverfassungsgericht nicht beanstandeten (vgl. Beschluss vom 29. März 2006, a.a.O.) – Beschluss vom 28. November 2005 (a.a.O.) mit Blick auf eine Notarstelle gewürdigt wurden.
Eine Ernennung des Klägers zum – nach R 8 besoldeten – Präsidenten des Oberlandesgerichts kann zunächst nicht dadurch ermöglicht werden, dass der Beigeladene versetzt wird (vgl. hierzu z.B. die Urteile des Bundesverwaltungsgerichts vom 25. August 1988, a.a.O., und 13. September 2001, a.a.O.). Dem steht schon die verfassungsrechtlich gewährleistete persönliche Unabhängigkeit der Richter auf Lebenszeit entgegen. Gemäß Art. 97 Abs. 2 Satz 1 GG können die hauptamtlich und planmäßig endgültig angestellten Richter wider ihren Willen nur kraft richterlicher Entscheidung und nur aus Gründen und unter den Formen, welche die Gesetze bestimmen, an eine andere Stelle versetzt werden. Unter welchen Voraussetzungen ein Lebenszeitrichter gegen seinen Willen versetzt werden kann, ist in § 30 des Deutschen Richtergesetzes – DRiG – abschließend geregelt. Nach Absatz 1 der Vorschrift kann ein Richter auf Lebenszeit ohne seine Zustimmung nur im Verfahren über die Richteranklage gemäß Art. 98 Abs. 2 und Abs. 5 GG, im gerichtlichen Disziplinarverfahren, im Interesse der Rechtspflege oder bei Veränderung der Gerichtsorganisation in ein anderes Amt versetzt werden. Eine Versetzung im Interesse der Rechtspflege, wie sie vorliegend überhaupt nur in Betracht gezogen werden könnte, erfordert gemäß § 31 DRiG, dass Tatsachen außerhalb der richterlichen Tätigkeit des betreffenden Richters eine Versetzung in ein anderes Richteramt mit dem gleichen Endgrundgehalt zwingend gebieten, um eine schwere Beeinträchtigung der Rechtspflege abzuwenden. Es bedarf keiner weiteren Vertiefung, dass es bei einer Versetzung des Beigeladenen zu dem alleinigen Zweck, die Planstelle, in die er mit seiner Ernennung zum OLG-Präsidenten eingewiesen wurde, besetzbar zu machen, nicht um die Abwendung einer schweren Beeinträchtigung der Rechtspflege geht. Eine Ernennung des Klägers zum OLG-Präsidenten, die nur unter Einweisung in eine diesem Amt zugeordnete – besetzbare – Planstelle erfolgen könnte (§ 49 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung – LHO -), unter vorheriger Versetzung des Beigeladenen scheidet damit aus.
Eine andere – bereits vorhandene – besetzbare dem Amt des Präsidenten des Oberlandesgerichts (Besoldungsgruppe R 8) zugeordnete Planstelle ist in Rhein-land-Pfalz derzeit nicht vorhanden. Die Stelle des Präsidenten des zweiten gemäß dem Gerichtsorganisationsgesetz – GerOrgG – in Rheinland-Pfalz eingerichteten Oberlandesgerichts – des Pfälzischen Oberlandesgerichts Zweibrücken -, die ebenfalls in die Besoldungsgruppe R 8 eingestuft ist, ist besetzt. Der derzeitige Amtsinhaber tritt Ende Februar 2009 zwar in den Ruhestand; die Stelle wurde aber bereits am 26. Januar 2009 – mit Wirkung zum 1. März 2009 – mit dem derzeitigen Präsidenten des Landgerichts Mainz neu besetzt.
Eine Beförderung des Klägers unter zusätzlicher Einweisung in die an den Beigeladenen vergebene Planstelle ist nicht möglich. Besetzbar ist eine Planstelle nur, wenn in sie kein anderer eingewiesen ist (vgl. z.B. Piduch, Bundeshaushaltsordnung, Stand Juni 2007,
- 15 -
Rdnr. 4 zu § 49); aus einer Planstelle darf jeweils nur ein (vollzeitbeschäftigter) Beamter bzw. Richter besoldet werden (vgl. z.B. das Urteil des BVerwG vom 13. September 2001, a.a.O.).
Auch die Schaffung einer weiteren der Besoldungsgruppe R 8 zugeordnete OLG-Präsidentenstelle scheidet aus.
Das Gerichtsorganisationsgesetz sieht in Rheinland-Pfalz zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Rechtspflege schon nur zwei Oberlandesgerichte als erforderlich aber auch ausreichend vor (§ 4 GerOrgG). Gemäß § 115 des Gerichtsverfassungsgesetzes – GVG – werden die Oberlandesgerichte wiederum nur mit einem Präsidenten sowie mit Vorsitzenden Richtern und weiteren Richtern besetzt. Das Gerichtsverfassungsgesetz schließt damit für die Oberlandesgerichte das Vorhandensein einer weiteren Funktionsstelle des Gerichtspräsidenten aus. Da die Anzahl der im Stellenplan für bestimmte Ämter ausgewiesenen Planstellen der Zahl der insoweit eingerichteten Ämter entsprechen muss (vgl. § 17 Abs. 5 LHO; vgl. hierzu auch die Urteile des BVerwG vom 13. September 2001, a.a.O., und 25. April 1996, BVerwGE 101, 112; ferner z.B. Schütz/Maiwald, Beamtenrecht des Bundes und der Länder, Stand Januar 2009, C § 8 Rdnr. 88), kann somit in Rheinland-Pfalz keine dritte Planstelle für einen OLG-Präsidenten ausgebracht werden.
Soweit der Kläger in der mündlichen Verhandlung angedeutet hat, dass es ihm nicht in jedem Fall darum geht, die mit dem Amt eines OLG-Präsidenten verbundenen Aufgaben tatsächlich wahrzunehmen, ist ihm zunächst entgegenzuhalten, dass dies nicht daran vorbeizuführen vermag, dass die Verleihung eines Amtes die gleichzeitige Einweisung in eine besetzbare Planstelle zur unverzichtbaren haushaltsrechtlichen Voraussetzung hat, und die Ausbringung einer solchen voraussetzt, dass ein entsprechendes Amt eingerichtet ist. Im Übrigen hat sich ein Richter gemäß § 5 Abs. 1 des Landesrichtergesetzes – LRiG – i.V.m. § 64 Abs. 1 des Landesbeamtengesetzes – LBG – mit voller Hingabe seinem Beruf zu widmen. Dass dabei die Erfüllung der dienstlichen Aufgaben, die mit dem ihm verliehenen Statusamt – nach dem sich auch seine Alimentation richtet – verbunden sind, und nicht ein Tätigwerden in einem früher bekleideten Amt in Rede steht, versteht sich von selbst. Der OLG-Präsident nimmt die ihm zugewiesenen Aufgaben der Gerichts- und Justizverwaltung wahr und führt in einem Umfang, der ihm einen Richtung gebenden Einfluss auf dessen Rechtsprechung erlaubt (vgl. z.B. BGH, Beschluss vom 20. November 1967, BGHZ 49, 64), den Vorsitz in einem Senat.
Wenn sich der Kläger in dem hier behandelten Zusammenhang in der Berufungsverhandlung des Weiteren darauf berufen hat, es habe in Rheinland-Pfalz – bei nur einer OVG-Präsidenten-Stelle – ja auch schon einmal zwei OVG-Präsidenten gegeben, übersieht er, dass sich das damalige zeitweise Vorhandensein zweier OVG-Präsidenten aus zwingenden Rechtsgründen (vgl. § 16 Ministergesetz) ergab, während es hier um die Herbeiführung einer solchen Situation im Rahmen der Auswahl für eine Beförderungsstelle geht.
Unabhängig von der vorstehend dargestellten sich aus dem Landesorganisations- und -haushaltsrecht ergebenden Unmöglichkeit einer Ernennung des Klägers neben dem Beigeladenen zum OLG-Präsidenten, stünde einer solchen mit Rücksicht darauf, dass sie aus den dargelegten Gründen nicht ohne Amtsausübung denkbar ist, auch der Anspruch des Beigeladenen auf amtsangemessene (Vollzeit-)Beschäftigung entgegen.
Der Inhaber eines statusrechtlichen Amtes kann gemäß Art. 33 Abs. 5 GG beanspruchen, dass ihm ein abstrakt-funktionelles Amt sowie ein amtsangemessenes konkret-funktionelles Amt übertragen werden (vgl. z.B. BVerfG, Beschluss vom 3. Juli 1985, BVerfGE 70, 251). Mit der das Statusamt kennzeichnenden Zugehörigkeit zu einer Laufbahn und einer Laufbahngruppe, dem Endgrundgehalt der Besoldungsgruppe und der verliehenen Amtsbezeichnung wird in abstrakter Weise seine Wertigkeit im Verhältnis zu anderen Ämtern zum Ausdruck gebracht (vgl. z.B. BVerwG, Urteil vom 3. März 2005, BVerwGE 123, 107). Das abstrakt-funktionelle Amt betrifft den einem statusrechtlichen Amt entsprechenden Aufgabenkreis, der einem Inhaber dieses Statusamtes bei einer bestimmten Behörde auf Dauer zugewiesen ist (vgl. z.B. BVerfG, Beschluss vom 3. Juli 1985, a.a.O.); es wird durch gesonderte Verfügung des Dienstherrn übertragen (vgl. z.B. BVerwG, Urteil vom 23. September 2004, BVerwGE 122, 53). Das konkret-funktionelle Amt, der Dienstposten, bezeichnet die dem Beamten tatsächlich übertragene Funktion, seinen Aufgabenbereich. Die für die amtsgemäße Besoldung notwendige Zusammenschau von Amt im statusrechtlichen und im funktionellen Sinne steht einer dauernden Trennung von Amt und Funktion grundsätzlich entgegen (vgl. z.B. BVerfG, Beschluss vom 3. Juli 1985, a.a.O.). Im Rahmen dieser Vorgaben liegt es im Ermessen des Dienstherrn, den Inhalt des abstrakt- und des konkret-funktionellen Amts
- 16 -
festzulegen. Der Dienstherr ist dabei aber gehalten, dem Beamten bzw. Richter solche Funktionsämter zu übertragen, die in ihrer Wertigkeit dem Amt im statusrechtlichen Sinne entsprechen (vgl. z.B. BVerwG, Urteil vom 3. März 2005, a.a.O.). Damit ist der Beamte bzw. Richter zwar nicht vor einer Änderung seines abstrakten und konkreten Aufgabenbereichs nach Maßgabe seines statusrechtlichen Amtes gefeit (vgl. z.B. BVerwG, Urteil vom 23. September 2004, a.a.O.). Ihm muss dabei jedoch stets ein amtsangemessener Tätigkeitsbereich verbleiben (vgl. z.B. BVerwG, Urteil vom 1. Juni 1995, BVerwGE 98, 334). Ohne seine Zustimmung darf dem Beamten bzw. Richter diese Beschäftigung weder entzogen, noch darf er auf Dauer unterwertig beschäftigt werden (vgl. z.B. BVerfG, Beschluss vom 3. Juli 1985, a.a.O.; BVerwG, Urteil vom 22. Juni 2006, BVerwGE 126, 182).
Eine hälftige Aufteilung der dem Präsidenten des Oberlandesgerichts Koblenz zukommenden Gerichts- und Justizverwaltungsaufgaben, sei es in zeitlicher oder aber sachlicher Hinsicht, wie sie die Einrichtung einer „Doppelspitze“ in der Leitung des Oberlandesgerichts zwangsläufig zur Folge hätte, verletzte den Beigeladenen jedoch in diesem Recht auf amtsangemessene Beschäftigung. Dabei ist zu sehen, dass es hier um eine einmalige Funktionsstelle mit einem gerichts- und justizorganisationsrechtlich fest umrissenen Aufgabenbereich geht. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass dem Statusamt eines höchstmöglich besoldeten OLG-Präsidenten eine besondere Anforderungen stellende Umfänglichkeit der ihm obliegenden Dienstgeschäfte entspricht. Allein hierauf beruht die Einstufung des Amtes in die oberste Besoldungsgruppe für OLG-Präsidenten; die richterliche Tätigkeit entspricht in ihrer Wertigkeit bei allen OLG-Präsidenten gleichermaßen der für Vorsitzende Richter am Oberlandesgericht geltenden Besoldungsgruppe R 3. Danach kann nicht zweifelhaft sein, dass mit diesem „Alleinstellungsanspruch auf höchstem Niveau“ des Beigeladenen eine erhebliche Einengung seines Tätigkeitsfeldes ohne adäquaten Ersatz unvereinbar wäre.
Schließlich würde eine Ernennung des Klägers zum weiteren (vollzeitbeschäftigten) Präsidenten des Oberlandesgerichts den Anspruch des Rechtssuchenden auf den gesetzlichen Richter (Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG) als Ausprägung des Rechtsstaatsprinzips verletzen. Damit wären nämlich anstelle des im Gesetz insofern vorgesehenen einzigen Richters zwei Richter der Konkretisierung des gesetzlichen Richters durch das dazu grundsätzlich berufene Gremium entzogen. Gemäß § 21 e Abs. 1 Satz 1 GVG bestimmt das Präsidium die Besetzung der Spruchkörper und verteilt die Geschäfte. Dem Bestimmungsrecht des Präsidiums hinsichtlich der Spruchkörperbesetzung unterfällt jedoch nicht der Präsident. Er bestimmt gemäß Satz 3 der Bestimmung vielmehr selbst, welchem Spruchkörper er sich als Vorsitzender anschließt. Diese Ausnahmeregelung zum grundsätzlichen Bestimmungsrecht des Präsidiums bezieht sich dabei nun aber zweifelsfrei auf eine Einzelperson: Nur ein Einzelner kann autark bestimmen, in welchem Senat er den Vorsitz übernimmt. Bei zwei Personen bedürfte es dagegen fester Regeln zur Ausübung des Bestimmungsrechts, die indes fehlen.
Im Übrigen verletzt aber auch schon allgemein die Übertragung eines Richteramtes bei einem bestimmten Gericht an einen Lebenszeitrichter, ohne dass hierfür eine Planstelle vorhanden wäre, den Anspruch auf den gesetzlichen Richter (vgl. hierzu etwa Kissel/Mayer, GVG, 4. Aufl., Rdnr. 28 zu § 16).
Nach alledem scheidet es auch von vornherein aus, dass der Kläger neben dem Beigeladenen zum OLG-Präsidenten ernannt wird. Die Klage erweist sich damit, was die Hauptanträge – einschließlich der Hilfsanträge zu 2 b) und 2 c) – angeht, insgesamt als unzulässig.
Unzulässig sind aber auch die beiden Hilfsklageanträge zu 3.
Wie der Kläger in der Berufungsverhandlung klargestellt hat, bezieht sich das erste Feststellungsbegehren auf die Auswahlentscheidung in der Sache selbst.
Es handelt sich insoweit um eine Fortsetzungsfeststellungsklage in doppelter Analogie zu § 113 Abs. 1 Satz 4 der Verwaltungsgerichtsordnung - VwGO -, nämlich eine Fortsetzungsfeststellungsklage nach Erledigung eines Verpflichtungsbegehrens noch vor der Klageerhebung – während des Widerspruchsverfahrens -.
Ob diese Klage bereits mangels Durchführung eines Widerspruchsverfahrens unzulässig ist, lässt der Senat offen. Gemäß § 5 Abs. 1 LRiG i.V.m. § 218 Abs. 3 LBG – der dem § 126 Abs. 3 des Beamtenrechtsrahmengesetzes (BRRG) entspricht– ist zwar vor jeder Klage eines Richters aus dem Richterverhältnis ein Vorverfahren nach §§ 68 ff. VwGO durchzuführen. Damit bedarf es auch vor Erhebung einer
- 17 -
Fortsetzungsfeststellungsklage nach einer vorprozessualen Erledigung grundsätzlich eines auf die Fortsetzungsfeststellung gerichteten Widerspruchsverfahrens (vgl. z.B. Schoch/Schmidt-Aßmann/Pietzner, VwGO, Stand März 2008, Rdnr. 99 zu § 113 und Rdnr. 22 zu § 68). Vorliegend ist allerdings die Erledigung nach Erhebung des (Verpflichtungs-)Widerspruchs in der Sache selbst eingetreten und der Beklagte hat, nachdem er zunächst richtigerweise (vgl. z.B. BVerwG, Urteil vom 20. Januar 1989, BVerwGE 81, 226) keine Sachentscheidung mehr getroffen und den vom Kläger ausdrücklich aufrechterhaltenen Widerspruch vielmehr mit Widerspruchsbescheid vom 1. Oktober 2007 als unzulässig zurückgewiesen hatte, aber doch mit Schreiben vom 22. Oktober 2007 kurz dargelegt, dass und warum der Widerspruch auch als unbegründet zurückzuweisen sei. Dies könnte ungeachtet der Tatsache, dass der Kläger auch in seiner diesem Schreiben zugrunde liegenden Eingabe vom 8. Oktober 2007 nicht zum Ausdruck gebracht hatte, gegebenenfalls Schadensersatzansprüche geltend machen und/oder um seine nachträgliche Rehabilitierung kämpfen zu wollen, hier den Vorgaben des § 5 Abs. 1 LRiG i.V.m. § 218 Abs. 3 LBG genügen.
Soweit der Kläger die Feststellung der Rechtswidrigkeit der Auswahlentscheidung als solcher mit Blick auf die beabsichtigte Schadensersatzklage mit dem Ziel erstrebt, ihn besoldungs- und versorgungsrechtlich so zu stellen, als wäre er befördert worden, ist die Klage bereits aus Gründen der Subsidiarität dieses Feststellungsbegehrens unzulässig.
Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, der sich der Senat anschließt, begründet die Absicht, eine Schadensersatzklage zu erheben, kein schutzwürdiges Interesse an einer verwaltungsgerichtlichen Klage mit dem Ziel, die Rechtswidrigkeit eines erledigten Verwaltungsaktes festzustellen, wenn sich der Verwaltungsakt bereits vor Klageerhebung erledigt hat (vgl. z.B. Beschluss vom 27. Juni 1985, Buchholz 310 § 113 Nr. 150; Urteile vom 17. August 1982, InfAuslR 1982, 276, 25. August 1988, a.a.O., und 20. Januar 1989, a.a.O.; des Weiteren z.B. OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 1. Oktober 2008 – 1 A 4543/06 -, Juris; VGHBW, Urteil vom 29. Juli 2003, VBlBW 2003, 475; BayVGH, Beschluss vom 27. November 1995, NVwZ-RR 1997, 23; Redeker/von Oertzen, VwGO, 14. Aufl., Rdnr. 35 zu § 113; Kopp/Schenke, a.a.O., Rdnr. 136 zu § 113; Schnellenbach, DVBl. 1990, 140). Damit kann auch nach der Ernennung des ausgewählten Konkurrenten in einem Beförderungsauswahlverfahren noch vor Erhebung der „Konkurrentenklage“ bzw. Verpflichtungsklage auf Beförderung wegen der beabsichtigten Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen keine auf die Feststellung der Rechtswidrigkeit der Auswahlentscheidung gerichtete Fortsetzungsfeststellungsklage erhoben werden. Dies gilt auch dann, wenn die Fortsetzungsfeststellungsklage hilfsweise, für den Fall des Unterliegens mit dem zur Weiterverfolgung des Bewerbungsverfahrensanspruchs eingebrachten Hauptantrag erhoben wird. Zur Begründung seiner Rechtsauffassung hat das Bundesverwaltungsgericht mit Blick auf eine beabsichtigte Amtshaftungsklage gemäß Art. 34 GG i.V.m. § 839 des Bürgerlichen Gesetzbuches – BGB – ausgeführt: In Fällen dieser Art würden für das Fortsetzungsfeststellungsinteresse dieselben – strengeren – Maßstäbe wie für das Rechtsschutzinteresse bei einer Feststellungsklage im Sinne des § 43 VwGO gelten. Es fehle dann an der besonderen Schutzwürdigkeit des Interesses an einer Fortsetzungsfeststellungsklage gemäß § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO. Sie beruhe darauf, dass eine Partei nicht ohne Not um die Früchte des bisherigen Prozesses gebracht werden dürfe, insbesondere dann nicht, wenn das Verfahren unter entsprechendem Aufwand einen bestimmten Stand erreicht habe und sich mit der Erledigung des ursprünglichen Antrages die Frage stelle, ob dieser Aufwand nutzlos gewesen sein solle und der Kläger der Erledigung wegen in diesem Verfahren leer ausgehen müsse („Fortsetzungsbonus“). Der Hinweis auf eine beabsichtigte Amtshaftungsklage genüge jedoch nicht zur Begründung des Rechtsschutzinteresses für eine Feststellungsklage gemäß § 43 VwGO. Es müsse vielmehr wegen des erstrebten Schadensersatzes sogleich das zuständige Zivilgericht angerufen werden, das im Amtshaftungsprozess auch für die Klärung öffentlich-rechtlicher Vorfragen zuständig sei. Ein Anspruch auf den (angeblich) „sachnäheren“ Richter bestehe nicht; vielmehr seien die Rechtswege prinzipiell gleichwertig.
Der damit zum Ausdruck gebrachte Subsidiaritätsgedanke greift dabei, wie hier ergänzt sein soll, auch dann Platz, wenn aus Gründen eines Verstoßes gegen das Bestenausleseprinzip (Art. 33 Abs. 2 GG) beabsichtigt ist, eine Schadensersatzklage wegen Verletzung der Fürsorgepflicht (§ 79 des Bundesbeamtengesetzes – BBG – bzw. § 87 LBG) bzw. Verletzung einer eigenen, in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis wurzelnden (quasi-vertraglichen) Verbindlichkeit beim Verwaltungsgericht zu erheben (vgl. zur Zweispurigkeit des Rechtsschutzes z.B. Plog/Wiedow/Lemhöfer/Bayer, BBG, Stand November 2008, Rdnr. 26 zu § 79 BBG; GKÖD, Stand November 2008, Rdnr. 58 zu § 79 BBG). Insoweit gilt nichts anderes wie für die Feststellungsklage gemäß § 43 VwGO, in dessen Absatz 2 der Grundsatz der Subsidiarität der Feststellungsklage
- 18 -
niedergelegt ist. Danach darf keine Feststellungsklage erhoben werden, wenn der Kläger seine Rechte durch Gestaltungs- oder Leistungsklage verfolgen kann. Damit sollen unnötige Feststellungsklagen verhindert werden, wenn für die Rechtsverfolgung unmittelbarere sachnähere und wirksamere Verfahren zur Verfügung stehen. Zur Verfolgung eines Schadensersatzbegehrens im Verwaltungsrechtsweg kann jedoch unmittelbar beim zuständigen Verwaltungsgericht auf die Verpflichtung des Dienstherrn zur Gewährung von Schadensersatz geklagt werden. Für eine vorgeschaltete, auf Feststellung der Rechtswidrigkeit der Auswahlentscheidung gerichtete Klage analog § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO ist daneben kein Raum (vgl. z.B. Schnellenbach, DVBl 1990, 140). Dabei bedarf, wie ebenfalls noch bemerkt sein mag, das Schadensersatzbegehren der erkennbaren und bescheidbaren Konkretisierung gegenüber dem Dienstherrn spätestens im Widerspruch gemäß § 126 Abs. 3 BRRG bzw. § 218 Abs. 3 LBG (vgl. z.B. BVerwG, Beschluss vom 28. Juni 2001, BVerwGE 114, 350; Plog/Wiedow/Lemhöfer /Bayer, a.a.O., Rdnr. 25 zu § 79 BBG).
Ein Fortsetzungsfeststellungsinteresse mit Blick auf die beabsichtigte Schadens-ersatzklage scheidet schließlich auch deshalb aus, weil diese Klage offensichtlich aussichtslos ist (vgl. hierzu z.B. BVerwG, Urteile vom 25. August 1988, a.a.O., und 22. Januar 1998, ZBR 1998, 316; Beschluss vom 9. März 2005, 2 B 111.04, Juris). Das ist in aller Regel der Fall, wenn ein Kollegialgericht das als rechtswidrig und schadenstiftend angegriffene Verwaltungshandeln als objektiv rechtmäßig angesehen hat, weil dann regelmäßig ein behördliches Verschulden trotz Verletzung einer Dienstpflicht ausgeschlossen werden kann (vgl. hierzu die oben angeführten Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts; ferner z.B. BVerwG, Beschlüsse vom 14. Mai 1996, ZBR 1996, 310, und 14. März 1997, ZBR 1997, 229). Vorliegend ist die Auswahlentscheidung des Beklagten als solche jedoch zunächst im Eilverfahren durch das Verwaltungsgericht – mit Beschluss vom 25. April 2007 – sowie auf die Beschwerde des Klägers hin durch den Senat – mit Beschluss vom 13. Juni 2007 – und schließlich nochmals mit dem aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 1. Juli 2008 ergangenen Urteil des Verwaltungsgerichts als objektiv rechtmäßig gewertet worden. Mit Blick auf die im einstweiligen Rechtsschutzverfahren ergangenen Entscheidungen ist dazu ergänzend darauf hinzuweisen, dass diese nach Maßgabe der weiter oben bereits wiedergegebenen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts unter eingehender tatsächlicher und rechtlicher Prüfung des im Hauptverfahren geltend gemachten Anspruchs zu treffen waren.
Zwar gibt es von dem vorgenannten Grundsatz Ausnahmen, doch greifen diese hier nicht Platz. Die Indizwirkung der Bewertung durch ein Kollegialgericht für das behördliche Verschulden, entfällt dabei nicht schon dadurch, dass die gerichtliche Würdigung materiell-rechtlich fehlerhaft ist bzw. nicht in Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts steht (vgl. z.B. BVerwG, Beschluss vom 22. Januar 1998, a.a.O.; Urteil vom 27. Februar 2003, DVBl. 2003, 1548). Eine kollegialgerichtliche Billigung des Verwaltungshandelns schließt behördliches Verschulden allerdings dann nicht aus, wenn besondere Umstände dafür sprechen, dass die Behördenbediensteten es „besser“ hätten wissen müssen, was namentlich dann der Fall sein kann, wenn das Gericht von einem falschen Sachverhalt ausgegangen ist oder eine eindeutige Vorschrift handgreiflich falsch ausgelegt hat (vgl. z.B. den Beschluss des BVerwG vom 9. März 2005, a.a.O., m.w.N.). Für Letzteres ist hier nichts ersichtlich; dafür wird auch vom Kläger mit der Berufung nichts vorgetragen.
In seiner Beschwerdeentscheidung vom 13. Juni 2007 ist allerdings der Senat davon ausgegangen (vgl. S. 15, 1. Absatz), der Justizminister habe den Entwurf seiner Beurteilung des Beigeladenen der Personalreferentin des Ministeriums mit der Bitte um Überprüfung zugeleitet. Dieses Vorbringen des Beklagten erweist sich jedoch als offenbar unzutreffend, nachdem es vom Beklagten im Hauptsacheverfahren nicht mehr aufgegriffen worden ist. Die genannte Sachverhaltsvariante ist nun aber für die Entscheidung des Senats im seinerzeitigen Beschwerdeverfahren nicht tragend gewesen. Zudem hat dieser Gesichtspunkt weder im Eilbeschluss des Verwaltungsgerichts vom 25. April 2007 Niederschlag gefunden – weil er im erstinstanzlichen einstweiligen Anordnungsverfahren vom Beklagten noch nicht geltend gemacht worden war -, noch im mit der Berufung angefochtenen Urteil – weil sich der Beklagte im Hauptsacheverfahren vor dem Verwaltungsgericht hierauf nicht mehr berufen hatte.
Darüber hinaus lässt sich nicht feststellen, dass die Entscheidungen im Ergebnis falsch sind und der Beklagte die Gründe dafür kennt oder kennen müsste. Namentlich gilt dies sowohl in Bezug auf das Gespräch der Staatssekretärin mit den beiden richterlichen Mitgliedern des Richterwahlausschusses vor der Ausschusssitzung vom 8. Februar 2007 als auch im Hinblick auf die vom Kläger geltend gemachte Äußerung des Justizministers
- 19 -
über die Eignung des Beigeladenen zum OLG-Präsidenten zu Beginn des Besetzungsverfahrens noch im Juli 2006.
Was das Gespräch der Staatssekretärin mit den zwei Richterwahlausschussmitgliedern angeht, ist der Beklagte bis ins Hauptsacheverfahren hinein bei seiner Darstellung verblieben, das Gespräch habe der Unterrichtung der beiden Richter über den Ausgang der ihrerseits angeregten Kompromisssuche gedient. Nach wie vor lässt sich nicht ausschließen, dass dieses Vorbringen zutrifft. Dass den Gerichtsentscheidungen insoweit ein falscher Sachverhalt zugrunde gelegt worden wäre, lässt sich somit nicht feststellen. Gegen den vom Kläger gemutmaßten Inhalt des Gesprächs spricht im Übrigen, wie in dem Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben soll, dass zunächst nur ein Richter zur Staatssekretärin gebeten worden sein soll: Mit nur einer Stimmenthaltung – bei einer weiteren Gegenstimme – wäre aber der Besetzungsvorschlag des Justizministers ebenfalls gescheitert, da der Richterwahlausschuss seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen fasst (§ 22 Abs. 1 LRiG). Abgesehen davon kann eine Beweisaufnahme im Rahmen der Prüfung des Fortsetzungsfeststellungsinteresses zur Aufklärung der Frage, ob eine Ausnahme zur Indizwirkung einer kollegialgerichtlichen Billigung vorliegt, nicht stattfinden. Im Übrigen kommt es aus den im Beschluss des Senats vom 13. Juni 2007 zu den „Auswirkungen des Stimmverhaltens der beiden Ausschussmitglieder“ dargelegten Gründen (S. 10, 2. Absatz, S. 11, 1. Absatz) nicht darauf an, ob das Vorbringen des Beklagten richtig ist oder aber das Gespräch dem Zweck diente, wie ihn der Kläger vermutet. Als „weiterer Beleg“ für eine Voreingenommenheit des Justizministers dem Kläger gegenüber kann das Gespräch ohnehin nicht dienen, da es nicht von diesem, sondern eben von der Staatssekretärin geführt wurde.
Auch wegen der vom Kläger erstmals im vorliegenden Prozess vorgetragenen Äußerung des Justizministers über die Eignung des Beigeladenen zum OLG-Präsidenten im Juli 2006 kann der beabsichtigten Schadensersatzklage ungeachtet der verwaltungsgerichtlichen Kollegialentscheidungen keine Erfolgsaussicht beigemessen werden. Diese – angeblichen – Erklärungen des Justizministers fanden zwar bei der Entscheidungsfindung im einstweiligen Anordnungsverfahren keine Berücksichtigung, da sich der Kläger hierauf im Eilverfahren noch nicht berufen hatte. Ihretwegen hätte dem Kläger aber auch nicht der begehrte vorläufige Rechtsschutz gewährt werden können. Es spielt für die nach Maßgabe der nur eingeschränkten gerichtlichen Kontrolldichte gewürdigte Rechtmäßigkeit der zwischen dem Kläger und dem Beigeladenen getroffenen Auswahlentscheidung keine Rolle, wie sich der Justizminister unter Zugrundelegung der Darstellung in den Schriftsätzen des Klägers vom 3. April und 23. Mai 2008 zu einem Zeitpunkt, zu dem sich weder der Beigeladene noch der Kläger auf die Stelle des OLG-Präsidenten beworben hatten, mit Blick auf eine Bewerbung des Präsidenten des Landgerichts Trier zu der Eignung des Beigeladenen für das Amt des Präsidenten des Oberlandesgerichts geäußert hat. Unter Berücksichtigung der Zeit, zu der die Äußerungen gefallen sein sollen, taugen sie vor allem auch nicht dazu, eine Voreingenommenheit des Justizministers dem Kläger gegenüber deutlich zu machen. Von daher ist auch – was der Kläger im Berufungsverfahren rügt – unschädlich, dass das Verwaltungsgericht, nachdem sich der Kläger bereits im erstinstanzlichen Verfahren auf diese Äußerungen berufen hatte, auf sie in seiner Entscheidung nicht weiter eingegangen ist. Daraus kann in Sonderheit nicht geschlossen werden, es habe einen falschen Sachverhalt zugrunde gelegt. Die Gerichte sind nicht verpflichtet, sich mit jedem Vorbringen in den Entscheidungsgründen ausdrücklich zu befassen. Fehlt es an klaren Hinweisen darauf, dass tatsächliches Vorbringen eines Beteiligten nicht zur Kenntnis genommen oder doch nicht erwogen worden ist, genügt es, wenn sich das Gericht mit dem wichtigsten, für die Entscheidung unmittelbar und primär relevanten Parteivorbringen – wie hier geschehen - im Urteil auseinandergesetzt hat (vgl. z.B. BVerfG, Beschluss vom 23. Juli 2003, NVwZ-RR 2004, 3).
Schließlich hat der Kläger auch nicht aus Gründen seiner Rehabilitation ein berechtigtes Interesse an der Feststellung, dass die Auswahlentscheidung in der Sache selbst rechtswidrig gewesen ist.
Der Kläger, der auch insoweit die Umstände darlegen muss, aus denen er sein Feststellungsinteresse – hier also das Interesse an seiner Rehabilitierung – ableitet (vgl. z.B. BVerwG, Beschlüsse vom 4. März 1976, BVerwGE 53, 134, und 15. November 1990, NVwZ 1991, 570), hat sich dazu in seiner Klagebegründung auf mehrere Umstände berufen: die Bedeutung des angestrebten Amtes und das große öffentliche Interesse sowie den Widerhall, den das Besetzungsverfahren und dessen Begleitumstände in der Medienberichterstattung gefunden hat, seine Stellung als Landgerichtspräsident, die Sondersitzungen des Rechtsausschusses und des Landtages sowie die vom Justizminister nach wie vor in den Medien und im Parlament
- 20 -
artikulierte Auffassung, er habe sich in der Sache und rechtlich korrekt verhalten. Soweit er des Weiteren die vom Bundesverfassungsgericht festgestellte Grundrechtsvereitelung des Justizministers geltend gemacht hat, betrifft dies das sich auf die Art und Weise der Ernennung beziehende zweite Feststellungsbegehren im Rahmen des Klageantrags zu 3. In seiner Berufungsbegründung verweist er ergänzend darauf, dass in der Medienberichterstattung hinsichtlich seiner Bewerbung von Anfang an eine positive Tendenz herauszulesen gewesen sei und seine Bewerbung in Justizkreisen und in der Bevölkerung auf eine hohe Akzeptanz getroffen sei, während sich das Besetzungsverfahren als solches einer zunehmenden Kritik in den Medien und der Öffentlichkeit ausgesetzt gesehen habe.
Damit hat der Kläger ein Rehabilitationsinteresse nicht dargetan.
Das Rehabilitationsinteresse für eine Fortsetzungsfeststellungsklage, mit der die Rechtswidrigkeit einer Auswahlentscheidung im beamten-(richter-)rechtlichen Beförderungskonkurrenzverhältnis festgestellt werden soll, setzt voraus, dass von der Bevorzugung des Konkurrenten als solcher, nach ihrer Begründung oder nach den Begleitumständen der Beförderungsentscheidung eine fortdauernde diskriminierende Wirkung für den unterlegenen Mitbewerber ausgeht, oder dass sich diese Entscheidung – weil mit ihr eine grundlegende Befähigung oder Eignung abgesprochen wird – doch jedenfalls ungünstig auf die weitere berufliche Entwicklung auswirken dürfte (vgl. hierzu z.B. BVerwG, Beschlüsse vom 9. August 1990, NVwZ 1991, 270, und 4. März 1976, a.a.O.; Urteile vom 19. März 1992, BayVBl. 1992, 596, 25. August 1988, a.a.O., und 9. Mai 1985, DVBl. 1985, 1233; Schnellenbach, DVBl. 1990, 140; Schoch/Schmidt-Aßmann /Pietzner, a.a.O., Rdnr. 92 zu § 113). Ein bloß ideelles Interesse an der endgültigen Klärung der Frage der Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrigkeit der Auswahlentscheidung ohne Rücksicht darauf, ob sie – weiterhin – ehrverletzend wirkt oder sich jedenfalls nachteilig auf das berufliche Fortkommen des Betroffenen auszuwirken vermag, reicht zur Annahme eines Rehabilitationsinteresses also nicht aus. Die Rechtswidrigkeit als solche diskriminiert nicht.
Der Kläger hat nichts dazu vorgetragen, dass und warum die Auswahlentscheidung als solche, wegen ihrer Begründung oder insoweit infolge ihrer Begleitumstände sein Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt oder ihn in der Achtung der Öffentlichkeit oder der Kollegen herabzusetzen vermag bzw. seine berufliche Entwicklung behindern wird.
Dazu besagt insbesondere nichts, dass es um die Besetzung der herausgehobenen Stelle des Präsidenten des Oberlandesgerichts Koblenz gegangen ist und er sich als Präsident des größten Landgerichts in Rheinland-Pfalz auf diese beworben hatte. So hatte sich der Beigeladene auf dieselbe herausgehobene Stelle als ebenso wie der Kläger besoldeter Präsident eines oberen Landesgerichts beworben. Allein daraus, dass ein Beförderungsbewerber einem Mitbewerber „unterlegen“ ist, ergibt sich ebenfalls noch kein Rehabilitationsinteresse für den nicht berücksichtigten Bewerber. Dabei handelt es sich vielmehr um die zwangsläufige Folge in jedem Beförderungsverfahren mit mehr als einem Bewerber. Hier gilt insofern auch nicht etwa mit Rücksicht auf das „Rangverhältnis“ zwischen dem beförderten und dem leer ausgegangenen Bewerber etwas anderes. Wie bereits bemerkt, hatten der Kläger und der Beigeladene von den Anforderungen des seinerzeit innegehabten Amtes her den gleichen Rang. Mit anderen Worten ergibt sich aus dem Umstand für sich allein, dass sich ein Landgerichtspräsident einem gleich besoldeten Landessozialgerichtspräsidenten geschlagen geben muss, noch keine Diskriminierung für den Landgerichtspräsidenten.
Auch aus der bloßen Umfänglichkeit der Medienberichterstattung folgt noch kein Rehabilitationsinteresse. Das gilt schon deshalb, weil insofern kein dem Dienstherrn zurechenbares Geschehen in Rede steht. Ein Grund, die Rehabilitierung zu betreiben, lässt sich dabei hier zudem nicht aus dem Inhalt der Berichterstattung herleiten. So trägt der Kläger selbst vor, dass in der „Berichterstattung ....in Bezug auf die Bewerbung des Klägers von Anfang an eine positive Tendenz herauszulesen“ gewesen sei und „sich das Besetzungsverfahren als solches .... einer zunehmenden Kritik in den Medien ausgesetzt“ gesehen habe. Entsprechendes gilt, was die Aufnahme der Bewerbung des Klägers in „Justizkreisen und in der Bevölkerung“ betrifft. Hierzu beruft sich der Kläger darauf, dass sie dort „auf eine hohe Akzeptanz“ getroffen habe und „sich das Besetzungsverfahren als solches .... (auch) einer zunehmenden Kritik .... in der Öffentlichkeit ausgesetzt“ gesehen habe.
Eine Diskriminierung des Klägers lässt sich ferner nicht aus der Tatsache herleiten, dass es wegen der Auswahlentscheidung zu Sondersitzungen des Rechtsausschusses und des Landtages gekommen ist. Sie belegen als solche vielmehr nur die „Politisierung“, die die Angelegenheit in Rheinland-Pfalz gefunden hat.
- 21 -
Eine solche Wirkung kommt schließlich auch nicht dem Umstand zu, dass der Justizminister - wie der Kläger geltend macht - „in den Medien und im Parlament .... (die) Auffassung .... (vertreten hat), er habe sich in der Sache und rechtlich korrekt verhalten“. Dies vermag - ebenso wie auch die vorgenannten Gesichtspunkte - vielmehr allein das große Interesse des Klägers daran deutlich zu machen, gerichtlich festgestellt zu sehen, dass ihm - wie er es sieht - „Unrecht“ geschehen ist.
Nach alledem erweist sich das erste Feststellungsbegehren im Rahmen des Klageantrags zu 3. als unzulässig.
Gleichermaßen unzulässig ist aber auch das weitere dort zum Ausdruck gebrachte Feststellungsbegehren, das die Rechtmäßigkeit der „Blitzernennung“ des Beigeladenen am 22. Juni 2007 zum Gegenstand hat.
Bei dieser – hilfsweisen – Feststellungsklage handelt es sich nicht um eine Fortsetzungsfeststellungsklage analog § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO, sondern um eine Feststellungsklage gemäß § 43 VwGO. Die dort angegriffene „Art und Weise der Ernennung“ bezieht sich auf das den Bewerbungsverfahrensanspruch des Klägers erledigende Ereignis selbst; insofern ist nachträglich keine – weitere – Erledigung eingetreten.
Die Feststellungsklage ist bereits deswegen unzulässig, weil ihr kein Widerspruchsverfahren vorausgegangen ist.
Wie oben bereits festgestellt wurde, ist gemäß § 5 Abs. 1 LRiG i.V.m. § 218 Abs. 3 LBG vor jeder Klage eines Richters aus dem Richterverhältnis und damit auch vor Erhebung einer Feststellungsklage, wie sie hier in Rede steht, ein Vorverfahren nach §§ 68 ff. VwGO durchzuführen. Der Anfechtungswiderspruch des Klägers gegen die Ernennung des Beigeladenen – der von Anbeginn an unzulässig war und deshalb auch richtigerweise aus diesem Grund mit dem Widerspruchsbescheid des Beklagten vom 1. Oktober 2007 zurückgewiesen wurde – genügt dem Widerspruchserfordernis für die hier behandelte hilfsweise Feststellungsklage nicht. Es hätte dem Kläger vielmehr oblegen, hilfsweise zum Anfechtungswiderspruch unter Deutlichmachung der das hilfsweise Feststellungsinteresse begründenden Umstände - für die er, wie oben bereits hervorgehoben wurde, die Darlegungslast trägt - auch Feststellungswiderspruch zu erheben. Das gilt hier jedenfalls deshalb, weil mit der Feststellungsklage ein neuer Streitgegenstand in das Verfahren eingeführt wird. Ging es bis zur Klageerhebung – namentlich auch mit dem Widerspruch gegen die Ernennung des Beigeladenen – allein um die Auswahlentscheidung als solche, die Weiterverfolgung des Bewerbungsverfahrensanspruchs mit dem Ziel einer Beförderung des Klägers anstelle des Beigeladenen oder neben dem Beigeladenen zum Präsidenten des Oberlandesgerichts, betrifft die Feststellungsklage – isoliert – die Art und Weise der Ernennung des Beigeladenen unter dem Blickwinkel einer gesonderten Verletzung des Klägers in seinen Rechten. Dementsprechend kommt es hier – anders als im Rahmen der oben behandelten Fortsetzungsfeststellungsklage – von vornherein nicht in Betracht, dass sich jedenfalls mit Rücksicht auf das Schreiben des Beklagten vom 22. Oktober 2007 die Notwendigkeit eines – zumindest hilfsweisen – Feststellungswiderspruchs erübrigt haben könnte. Dass auch der diesem Schreiben zugrunde liegenden Eingabe des Klägers vom 8. Oktober 2007 nicht etwa zu entnehmen war, der Kläger wolle ggf. Schadensersatzansprüche geltend machen bzw. seine Rehabilitation betreiben, wurde dabei ebenfalls oben schon herausgestellt. Da die Durchführung des Vorverfahrens gemäß § 126 Abs. 3 BRRG bzw. § 218 Abs. 3 LBG zwingende Prozessvoraussetzung der Klage (Sachurteilsvoraussetzung) ist, kann auf die Durchführung seitens der Beteiligten auch nicht verzichtet werden. Jedenfalls im Anwendungsbereich dieser Normen kann dies nach Auffassung des Senats auch nicht – seitens der Verwaltung – durch rügelose Einlassung auf eine ohne Vorverfahren erhobene Klage geschehen (so generell z.B. Kopp/Schenke, a.a.O., Rdnrn. 10 und 11 zu Vorbem. § 68, Rndrn. 1 und 28 zu § 68; Schoch/Schmidt-Aßmann/Pietzner, a.a.O., Rdnr. 29 zu § 68; Sodan/Ziekow, VwGO, 2. Aufl., Rdnr. 162 zu § 68; a.M. wohl die überwiegende Rechtsprechung des BVerwG, vgl. z.B. Urteil vom 4. Juli 2002, NVwZ 2002, 1505).
Soweit der Kläger die Feststellung der Rechtswidrigkeit der Art und Weise der Ernennung des Beigeladenen wegen seiner Absicht, eine Schadensersatzklage ‑ mit dem Ziel des Ersatzes der vergeblich aufgewendeten Kosten der Anrufung des Bundesverfassungsgerichts - zu erheben, begehrt, ist die Feststellungsklage darüber hinaus auch deshalb unzulässig, weil ihr die Subsidiarität der Feststellungsklage (§ 43 Abs. 2 VwGO) entgegensteht. Hierzu kann wiederum auf die obigen diesen Gesichtspunkt betreffenden Ausführungen zur Zulässigkeit der Fortsetzungsfeststellungsklage Bezug genommen werden. Wurden dort mangels „Fortsetzungsbonus“ die für die Feststellungsklage gemäß § 43 VwGO geltenden
- 22 -
Grundsätze im Rahmen der Würdigung der Zulässigkeit der Fortsetzungsfest-tellungsklage analog § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO, der Subsidiaritätsgedanke, herangezogen, gelangt hier § 43 Abs. 2 VwGO unmittelbar zur Anwendung.
Aber auch, soweit der Kläger die Feststellung der Rechtswidrigkeit der Ernennung des Beigeladenen mit Blick auf deren Begleitumstände aus Gründen seiner Rehabilitierung begehrt, ist die Feststellungsklage aus einem weiteren Grund unzulässig. Der Kläger hat sich für die Feststellungsklage zwar auf den Gesichtspunkt des Rehabilitationsinteresses berufen, ohne dass sich jedoch auf der Grundlage seines Vorbringens hierzu ein dahingehendes berechtigtes Interesse, d.h. feststellen ließe, dass – über die vom Bundesverfassungsgericht in seinem Kammerbeschluss vom 24. September 2007 (a.a.O.) hervorgehobene Verletzung des Klägers in seinen Rechten aus Art. 33 Abs. 2 i.V.m. Art. 19 Abs. 4 GG hinaus – von der Art und Weise der Ernennung des Beigeladenen nach wie vor eine ihn diskriminierende Wirkung ausgeht. Wie oben schon betont wurde, reicht insofern ein ideelles Interesse an der endgültigen Klärung der Frage der Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrigkeit der in Rede stehenden Maßnahme nicht aus.
In seiner Berufungsschrift macht der Kläger zu seinem Rehabilitationsinteresse aus Gründen der Art und Weise der Ernennung des Beigeladenen geltend, die „Blitzernennung“ sei mit Blick auf den Gesichtspunkt der Rehabilitierung umso bemerkenswerter, als der Kläger zu diesem Zeitpunkt als Richter über 27 Jahre hinweg, davon allein 11 Jahre als Landgerichtspräsidentin der rheinland-pfälzischen Justiz tätig gewesen sei und der Aufsicht, aber auch der Fürsorge des Dienstvorgesetzten unterstehe; er habe davon ausgehen dürfen, dass seine schriftlich angekündigte Absicht der Einlegung der Verfassungsbeschwerde nicht durch eine Blitzaktion des Justizministers konterkariert werde. Das Bundesverfassungsgericht habe in seiner Entscheidung vom 24. September 2007 ausgeführt, dass der Justizminister ihm durch diese Vorgehensweise den Zugang zum Verfassungsgericht vereitelt und ihn hierdurch in seinen Grundrechten verletzt habe. Diese Entscheidung sei Gegenstand einer Sondersitzung des Rechtsausschusses sowie einer Sondersitzung des Landtages gewesen. Gleichwohl habe der Justizminister gegenüber der Öffentlichkeit beständig die Auffassung vertreten, sich mit seiner Verfahrensweise völlig korrekt verhalten zu haben.
Die in der Berufungsbegründung speziell in Bezug auf die „Blitzernennung“ angeführten Umstände, namentlich die langjährige Verbundenheit zwischen dem Kläger und seinem Dienstvorgesetzten zur vertrauensvollen Zusammenarbeit mit ihren gegenseitigen Rechten und Pflichten, insbesondere der Treue- bzw. Fürsorgepflicht, könnten durchaus bei einer „Blitzernennung“ trotz bekannter Absicht, das Bundesverfassungsgericht anzurufen, wegen der damit verbundenen Herabwürdigung zum „Manipulationsobjekt“ ein Rehabilitationsinteresse begründen.
Das setzte jedoch ein nicht zu erwartendes – arglistiges – gezieltes „Ausmanövrieren“ voraus. Davon kann hier aber nun trotz der dem Beklagten bekannten Absicht des Klägers, im Falle des Unterliegens im verwaltungsgerichtlichen einstweiligen Rechtsschutzverfahren einen Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht zu stellen, aufgrund der hier gegebenen weiteren Besonderheiten nicht die Rede sein. Dem Justizminister musste sich nämlich, wie oben bereits festgestellt wurde, nach dem seinerzeitigen Stand der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung keineswegs aufdrängen, dass die ihm bekannte bloße Ankündigung eines einstweiligen Anordnungsantrages seitens des Klägers gegenüber dem Bundesverfassungsgericht ihn von Verfassungswegen daran hindern könnte, den Beigeladenen nach der unanfechtbaren Ablehnung des Antrags des Klägers auf Gewährung verwaltungsgerichtlichen Eilrechtsschutzes zum Oberlandesgerichtspräsidenten zu ernennen; das brauchte sich ihm dabei nicht zuletzt auch deshalb nicht aufzudrängen, weil darüber hinaus das Bundesverfassungsgericht die dem Beklagen bekannte Bitte des Klägers an das Bundesverfassungsgericht, eine Zwischenregelung zu treffen bzw. auf eine „Stillhalteabsprache“ mit dem Justizministerium hinzuwirken, 9 Tage lang nicht zum Anlass genommen hatte, in dieser Richtung aktiv zu werden. Hierzu sind im Rahmen der Prüfung, ob zwischen der Ernennung eines Mitbewerbers ohne vorherige Negativmitteilung an den unterlegenen Bewerber und einer Ernennung unter den hier gegebenen Umständen „sachliche Übereinstimmung“ besteht, umfängliche Ausführungen gemacht worden, auf die im hier behandelten Zusammenhang zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen werden kann.
Nach alledem erweist sich die Klage in vollem Umfang als unzulässig. Deshalb brauchte auch den gestellten Beweisanträgen nicht nachgegangen werden.
Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 154 Abs. 2, 162 Abs. 3 VwGO. Es entspricht nicht der Billigkeit, dem Antragsteller auch die außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen
- 23 -
aufzuerlegen, weil dieser keinen eigenen Antrag gestellt und damit auch kein Kostenrisiko übernommen hat (vgl. hierzu § 154 Abs. 3 VwGO).
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils wegen der Kosten beruht auf § 167 VwGO.
Die Revision wird wegen grundsätzlicher Bedeutung (§ 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO) zugelassen. Sie kann dem Bundesverwaltungsgericht die Gelegenheit geben, die nach seiner Entscheidung vom 21. August 2003 (a.a.O.) offenen Fragen einer weiteren Klärung zuzuführen sowie zum Grundsatz der Ämterstabilität nochmals seine Rechtsauffassung deutlich zu machen.
Rechtsmittelbelehrung
gez. Steppling gez. Hennig gez. Möller
Beschluss
Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 51.800,-- € festgesetzt (§§ 47, 53 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1, Satz 2 des Gerichtskostengesetzes - GKG -).
gez. Steppling
gez. Hennig
gez. Möller
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gern:
 |
Dr. Martin Hensche Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hensche@hensche.de |
 |
Christoph Hildebrandt Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hildebrandt@hensche.de |
 |
Nina Wesemann Rechtsanwältin Fachanwältin für Arbeitsrecht Kontakt: 040 / 69 20 68 04 wesemann@hensche.de |